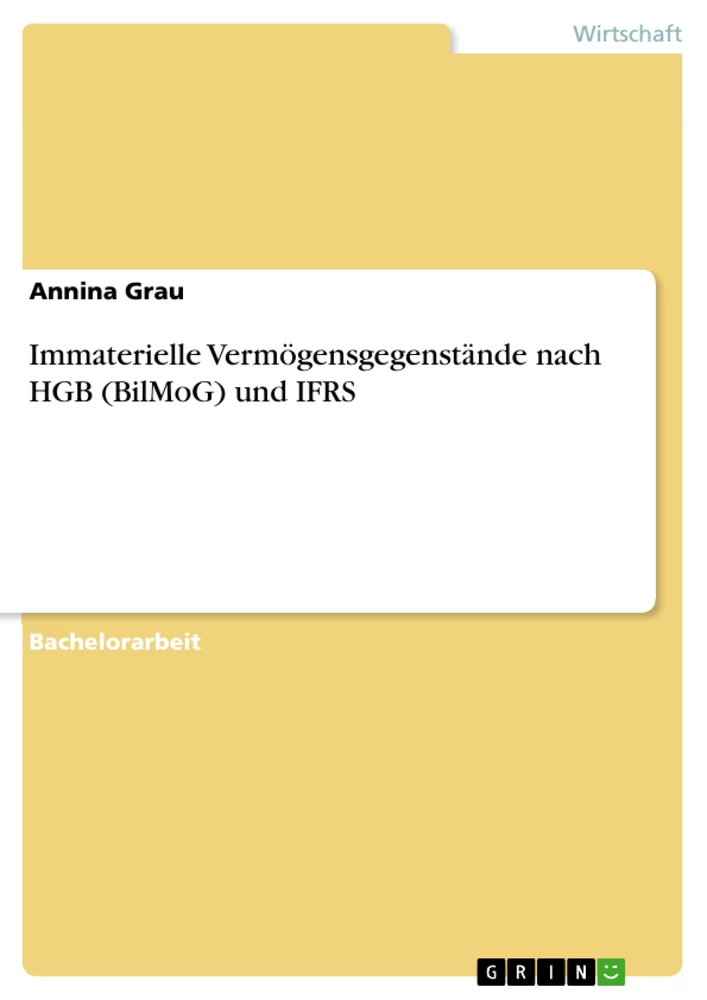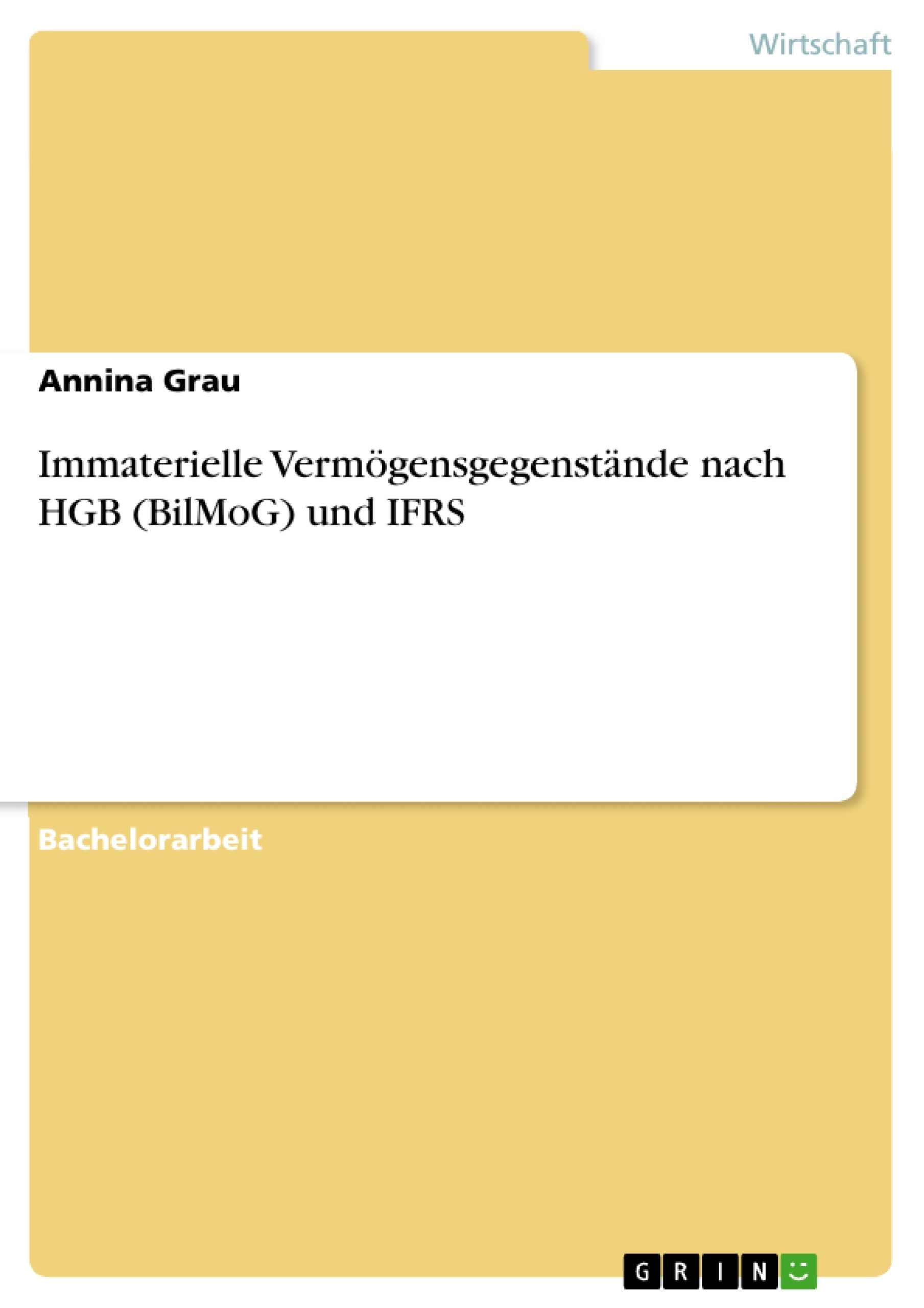Im Verlauf dieser Arbeit soll die Problematik der immateriellen Vermögenswerte diskutiert werden. Dabei wird sowohl auf die Regelungen des deutschen Handelsrechts als auch auf die der internationalen Rechnungslegung eingegangen.
Zunächst wird allerdings nur auf die Rechnungslegung nach deutschem Handelsrecht eingegangen. Wichtig ist hierbei, dass als erstes die Funktionen des Jahresabschlusses nach deutschem Handelsrecht festgehalten werden. Des Weiteren werden die immateriellen Vermögensgegenstände wie sie nach § 266 Abs. 2 A I HGB gegliedert sind definiert. Im nächsten Schritt wird auf die Besonderheiten der selbst erstellten immateriellen Vermögensgegenstände eingegangen. Hierbei wird die Problematik der Abgrenzung von Forschungs- und Entwicklungskosten tiefgründiger erläutert, da dies eines der Hauptprobleme ist, das bei der Aktivierung von selbst erstellten immateriellen Vermögensgegenständen auftritt.
Als nächstes folgt eine Erläuterung zu Ansatz, Bewertung, Ausweis und Anhangsangaben der immateriellen Vermögensgegenstände. Dabei wird hauptsächlich auf die selbst erstellten immateriellen Vermögensgegenstände, sowie auf den Geschäfts- oder Firmenwert eingegangen, da diese beiden Posten die meisten Probleme in Bezug auf ihre Bilanzierung bergen.
Im Rahmen der IFRS werden zunächst die Funktionen eines Jahresabschlusses nach IFRS dargestellt. Dann werden die Begriffe der Immateriellen Vermögenswerte und des Geschäfts- oder Firmenwerts erläutert. Dazu ist erforderlich, dass zunächst geklärt werden muss, was nach IFRS einen Vermögenswert generell ausmacht.
Im Rahmen der Erläuterungen zum Ansatz der immateriellen Vermögenswerte wird wiederum auf die Forschungs- und Entwicklungskosten eingegangen. In diesem Abschnitt wird der Problematik jedoch kein separater Unterpunkt gewidmet, da die Hauptprobleme bereits bei der Rechnungslegung nach deutschem Handelsrecht diskutiert wurden. Es wird lediglich auf die abweichenden Regelungen eingegangen.
Unter dem Punkt 4 „Kritische Würdigung“ sollen dann die in der Arbeit erlangten Erkenntnisse mit kritischem Hintergedanken zusammengefasst werden. Dabei soll vor allem auch auf die Unterschiede zwischen deutschem Handelsrecht und internationalem Recht eingegangen werden und diskutiert werden, ob die Informationsfunktion tatsächlich durch die Änderungen im deutschen Handelsrecht gestärkt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Rechnungslegung nach deutschem Handelsrecht
- Funktionen des Jahresabschlusses nach HGB
- Definition immaterielle Vermögensgegenstände
- Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
- Geschäfts- oder Firmenwert
- Geleistete Anzahlungen
- Besonderheiten bei selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen
- Grundsätzliches
- Folgebewertung
- Ansatz
- Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- Geschäfts- oder Firmenwert
- Bewertung
- Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- Zugangsbewertung
- Folgebewertung
- Geschäfts- oder Firmenwert
- Zugangsbewertung
- Folgebewertung
- Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- Ausweis/Angaben im Anhang
- Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- Geschäfts- oder Firmenwert
- Latente Steuern
- Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- Geschäfts- oder Firmenwert
- Rechnungslegung nach International Financial Reporting Standards (IFRS)
- Funktion des Jahresabschlusses nach IFRS
- Begriff des Vermögenswertes
- Immaterielle Vermögenswerte
- Geschäfts- oder Firmenwert
- Ansatz
- Immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens
- Geschäfts- oder Firmenwert
- Bewertung
- Immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens
- Erstbewertung
- Folgebewertung
- Geschäfts- oder Firmenwert
- Erstbewertung
- Folgebewertung
- Immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens
- Ausweis/Angaben im Anhang
- Immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens
- Geschäfts- oder Firmenwert
- Latente Steuern
- Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- Geschäfts- oder Firmenwert
- Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Rechnungslegung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach HGB (unter Berücksichtigung des BilMoG) und IFRS. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Rechnungslegungsstandards herauszuarbeiten und kritisch zu würdigen.
- Definition und Abgrenzung immaterieller Vermögensgegenstände nach HGB und IFRS
- Ansatz und Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände, insbesondere von selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen
- Unterschiede in der Behandlung des Geschäfts- oder Firmenwertes nach HGB und IFRS
- Auswirkungen latenter Steuern auf die Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände
- Kritische Betrachtung der jeweiligen Regelungen und deren Auswirkungen auf die Transparenz und Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen
Zusammenfassung der Kapitel
Problemstellung: Die Arbeit leitet mit einer prägnanten Problemstellung ein, die die Notwendigkeit einer detaillierten Untersuchung der Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände nach HGB und IFRS begründet. Die unterschiedlichen Regelungen und deren Auswirkungen auf die Unternehmenspraxis werden als zentrale Fragestellung hervorgehoben.
Rechnungslegung nach deutschem Handelsrecht: Dieses Kapitel analysiert umfassend die Rechnungslegung immaterieller Vermögensgegenstände nach HGB unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Es werden die Funktionen des Jahresabschlusses, die Definition immaterieller Vermögensgegenstände (inkl. selbst geschaffener und entgeltlich erworbener Rechte), Besonderheiten bei selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen, sowie die Aspekte des Ansatzes, der Bewertung (Zugangs- und Folgebewertung) und der Ausweisung im Anhang detailliert behandelt. Der Geschäfts- oder Firmenwert wird als spezifischer Fall eingehend betrachtet, inklusive der Behandlung latenter Steuern.
Rechnungslegung nach International Financial Reporting Standards (IFRS): Analog zum vorherigen Kapitel, konzentriert sich dieses auf die IFRS-Regelungen. Es werden die Funktion des Jahresabschlusses nach IFRS, der Begriff des Vermögenswertes, die Definition immaterieller Vermögenswerte und des Geschäfts- oder Firmenwertes präzise erläutert. Die Kapitel behandeln den Ansatz, die Bewertung (Erst- und Folgebewertung) und die Ausweisung im Anhang nach IFRS. Besonderheiten der Behandlung latenter Steuern werden ebenfalls untersucht. Der Vergleich mit den HGB-Regelungen wird implizit durch die parallele Struktur der Kapitel ermöglicht.
Kritische Würdigung: Dieses Kapitel dient der kritischen Gegenüberstellung der HGB und IFRS-Regelungen. Es analysiert die Stärken und Schwächen beider Systeme hinsichtlich der Transparenz, Vergleichbarkeit und Aussagekraft der Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände. Die Arbeit bewertet die Auswirkungen der unterschiedlichen Regelungen auf die Entscheidungsfindung von Anlegern und anderen Stakeholdern. Die kritische Auseinandersetzung liefert Schlussfolgerungen zur Optimierung der Rechnungslegungsvorschriften.
Schlüsselwörter
Immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagevermögen, HGB, IFRS, BilMoG, Geschäfts- oder Firmenwert, Bewertung, Ansatz, Folgebewertung, latente Steuern, Rechnungslegung, Jahresabschluss, Vergleichbarkeit, Transparenz.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Rechnungslegung immaterieller Vermögensgegenstände nach HGB und IFRS
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Rechnungslegung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) unter Berücksichtigung des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und nach den International Financial Reporting Standards (IFRS). Sie konzentriert sich auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Rechnungslegungsstandards und deren kritische Würdigung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung immaterieller Vermögensgegenstände nach HGB und IFRS, den Ansatz und die Bewertung (insbesondere von selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen), die Unterschiede in der Behandlung des Geschäfts- oder Firmenwerts, die Auswirkungen latenter Steuern auf die Bilanzierung und eine kritische Betrachtung der Regelungen hinsichtlich Transparenz und Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel „Problemstellung“, „Rechnungslegung nach deutschem Handelsrecht (HGB)“, „Rechnungslegung nach International Financial Reporting Standards (IFRS)“ und „Kritische Würdigung“. Jedes Kapitel behandelt die jeweiligen Aspekte des Themas detailliert, wobei die Kapitel zu HGB und IFRS parallel aufgebaut sind, um einen einfachen Vergleich zu ermöglichen.
Was wird im Kapitel „Rechnungslegung nach deutschem Handelsrecht (HGB)“ behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Funktionen des Jahresabschlusses nach HGB, die Definition immaterieller Vermögensgegenstände (inkl. selbst geschaffener und entgeltlich erworbener Rechte), Besonderheiten bei selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen, den Ansatz, die Bewertung (Zugangs- und Folgebewertung), die Ausweisung im Anhang und die Behandlung des Geschäfts- oder Firmenwerts einschließlich latenter Steuern.
Was wird im Kapitel „Rechnungslegung nach IFRS“ behandelt?
Analog zum HGB-Kapitel behandelt dieses Kapitel die Funktion des Jahresabschlusses nach IFRS, den Begriff des Vermögenswertes, die Definition immaterieller Vermögenswerte und des Geschäfts- oder Firmenwerts. Es werden der Ansatz, die Bewertung (Erst- und Folgebewertung), die Ausweisung im Anhang und die Behandlung latenter Steuern nach IFRS erläutert. Ein impliziter Vergleich mit den HGB-Regelungen wird durch die parallele Struktur ermöglicht.
Was beinhaltet die „Kritische Würdigung“?
Das Kapitel „Kritische Würdigung“ vergleicht die HGB- und IFRS-Regelungen kritisch hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen bezüglich Transparenz, Vergleichbarkeit und Aussagekraft der Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände. Es bewertet die Auswirkungen der unterschiedlichen Regelungen auf die Entscheidungsfindung von Anlegern und anderen Stakeholdern und liefert Schlussfolgerungen zur Optimierung der Rechnungslegungsvorschriften.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagevermögen, HGB, IFRS, BilMoG, Geschäfts- oder Firmenwert, Bewertung, Ansatz, Folgebewertung, latente Steuern, Rechnungslegung, Jahresabschluss, Vergleichbarkeit, Transparenz.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Rechnungslegung immaterieller Vermögensgegenstände nach HGB und IFRS herauszuarbeiten und kritisch zu würdigen. Es soll ein umfassendes Verständnis der jeweiligen Regelungen und deren Auswirkungen auf die Unternehmenspraxis geschaffen werden.
- Quote paper
- Annina Grau (Author), 2010, Immaterielle Vermögensgegenstände nach HGB (BilMoG) und IFRS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321238