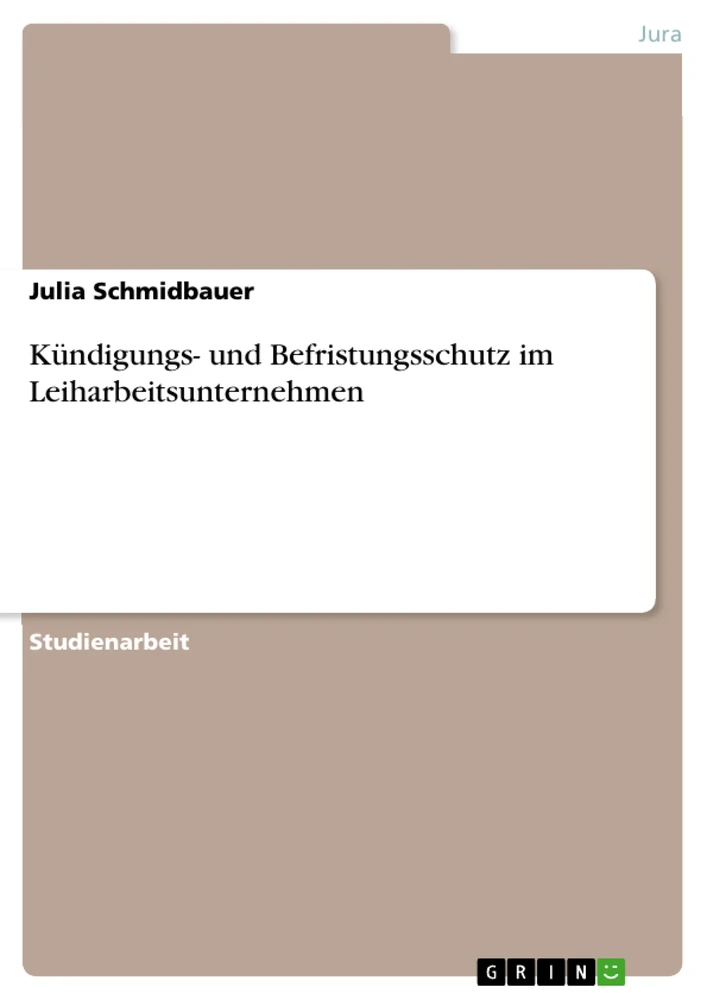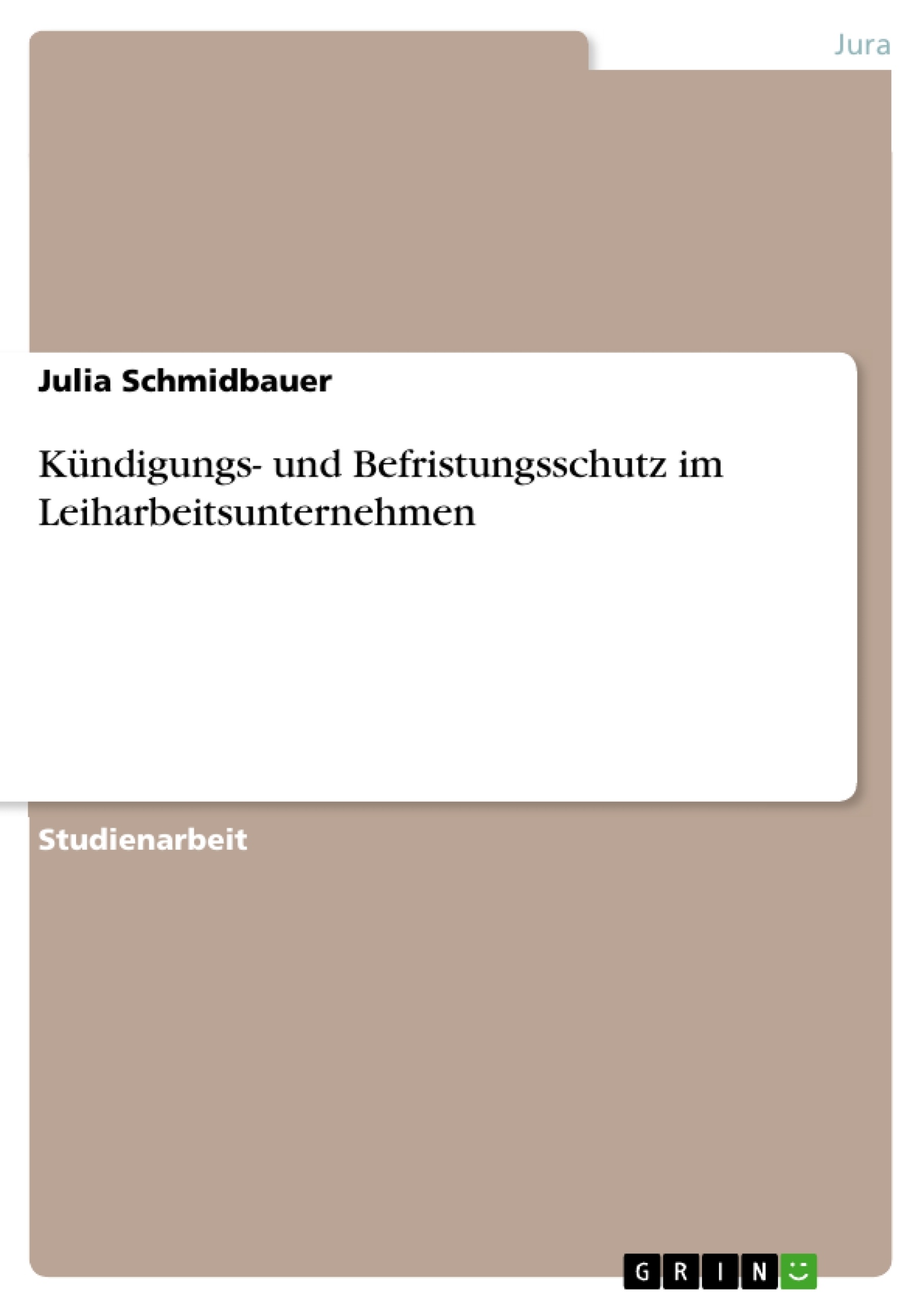Die folgende Darstellung soll die gesetzliche Ausgestaltung des Kündigungs- und Befristungsschutzes im Leiharbeitsunternehmen erläutern. Dabei wird insbesondere die aktuelle Rechtsprechung herangezogen, um die allgemeinen gesetzlichen Schutznormen in Bezug auf die individuellen Besonderheiten des Leiharbeitsverhältnisses zu konkretisieren.
Die Anzahl der Leiharbeitsverhältnisse in Deutschland ist im Berichtszeitraum des zwölften Erfahrungsberichtes der Bundesregierung bei der Anwendung des AÜG weiter gestiegen. Im Durchschnitt waren es im Jahr 2009 noch 625.411 Leiharbeitsverhältnisse, 2012 bereits 877.599. Blickt man bis ins Jahr 2004 zurück hat sich die Zahl der Leiharbeitsverhältnisse sogar mehr als verdoppelt. Dies ist nicht zuletzt auf die hohe Flexibilität der Beschäftigungsform zurückzuführen, die es den Arbeitgebern ermöglicht, ihre Personalplanung den an Auftragsschwankungen schnell anzupassen. Zeitarbeitsverhältnisse werden häufiger geschlossen bzw. beendet.
Die durchschnittliche Beschäftigungsdauer ist deutlich kürzer. Auch der Gesetzgeber betont in seiner Gesetzesbegründung des Gesetzes zur Änderung des AÜG, das in Umsetzung der Leiharbeitsrichtlinie erging, die besondere Schutzbedürftigkeit des Leiharbeitnehmers. Da das wirtschaftliche Interesse des Verleihers, die Vergütungspflichten für unproduktive Zeiten möglichst gering zu halten, dem Wesen des vom Gesetzgeber vorgesehenen, unbefristeten Dauerschuldverhältnisses entgegensteht, greifen Verleihunternehmen auf Befristungsregelungen und Kündigungen zurück.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung - Besondere Schutzbedürftigkeit des Leiharbeitnehmers
- II. Kündigungsschutz
- 1. Beschränkung der Kündigung durch gesetzliche Anforderungen
- a) Außerordentliche und ordentliche Kündigung
- b) Abweichende Regelungen in der Praxis
- 2. Präventiv-kollektivrechtlicher Kündigungsschutz
- a) Ordentliche und außerordentliche Kündigung
- b) Betriebsräte in der Leiharbeitspraxis
- 3. Allgemeiner Kündigungsschutz (ohne KSchG)
- a) Kleinbetriebe, § 23 I 2 KSchG
- b) Wartezeit, § 1 I KSchG
- c) Schutzvorschriften
- 4. Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz
- a) Betriebsbedingte Kündigung
- aa) Kündigungsgründe
- (1) Inner- und außerbetriebliche Ursachen
- (2) Wegfall der Erlaubnis
- bb) Sonderfall: Betriebsbedingte Änderungskündigung zur Entgeltanpassung
- cc) Fehlende Weiterbeschäftigungsmöglichkeit
- dd) Sozialauswahl
- b) Personenbedingte Kündigung
- c) Verhaltensbedingte Kündigung
- 5. Besonderer Kündigungsschutz
- III. Befristungsschutz
- 1. Bestandschutz und Synchronisationsverbot
- 2. Sachgrundbefristungen, § 14 I TzBfG
- a) Vorübergehender betrieblicher Bedarf, § 14 I Nr.1 TzBfG
- b) Vertretung eines anderen Arbeitnehmers, § 14 I Nr. 3 TzBfG
- c) Erstanstellung im Anschluss an Ausbildung oder Studium, § 14 I Nr. 2 TzBfG
- d) Erprobung, § 14 I Nr. 5 TzBfG
- e) Gründe in der Person des Arbeitnehmers, § 14 I Nr. 6 TzBfG
- f) Weitere Befristungsgründe
- 3. Sachgrundlose Befristung, § 14 II TzBfG
- 4. Befristung außerhalb des TzBFG
- a) „Befristung“ durch Aufhebungsvertrag
- b) Faktische Befristung durch Vereinbarung unbezahlten Urlaubs
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der besonderen Schutzbedürftigkeit von Leiharbeitnehmern im Arbeitsverhältnis und untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen, die für diese Arbeitnehmergruppe gelten.
- Kündigungsschutz für Leiharbeitnehmer
- Befristungsschutz im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung
- Abweichende Regelungen in der Praxis im Vergleich zu den gesetzlichen Anforderungen
- Rechtliche Besonderheiten und Herausforderungen im Zusammenhang mit Leiharbeit
- Sicherung der Gleichbehandlung von Leiharbeitnehmern und Stammmitarbeitern
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung - Besondere Schutzbedürftigkeit des Leiharbeitnehmers: Diese Einleitung stellt die besondere Situation von Leiharbeitnehmern dar und erläutert die Gründe für ihre Schutzbedürftigkeit. Sie gibt einen Überblick über die Themen, die in den folgenden Kapiteln behandelt werden.
- II. Kündigungsschutz: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Formen des Kündigungsschutzes, die für Leiharbeitnehmer gelten. Es werden sowohl die gesetzlichen Anforderungen als auch die Abweichungen in der Praxis behandelt. Insbesondere werden die Themen der außerordentlichen und ordentlichen Kündigung, der präventiv-kollektivrechtlichen Kündigungsschutz, des allgemeinen Kündigungsschutzes und des Kündigungsschutzes nach dem Kündigungsschutzgesetz beleuchtet.
- III. Befristungsschutz: Dieses Kapitel befasst sich mit den Regelungen zum Befristungsschutz von Leiharbeitnehmern. Es werden die verschiedenen Formen der Befristung, wie beispielsweise Sachgrundbefristungen und sachgrundlose Befristungen, sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Befristung von Arbeitsverträgen erläutert.
Schlüsselwörter
Leiharbeit, Arbeitnehmerüberlassung, Kündigungsschutz, Befristungsschutz, Arbeitsrecht, Sonderkündigungsschutz, Betriebsbedingte Kündigung, Personenbedingte Kündigung, Verhaltensbedingte Kündigung, Sachgrundbefristung, Sachgrundlose Befristung, Gleichbehandlung, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), Kündigungsschutzgesetz (KSchG), Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG).
- Quote paper
- Julia Schmidbauer (Author), 2014, Kündigungs- und Befristungsschutz im Leiharbeitsunternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320831