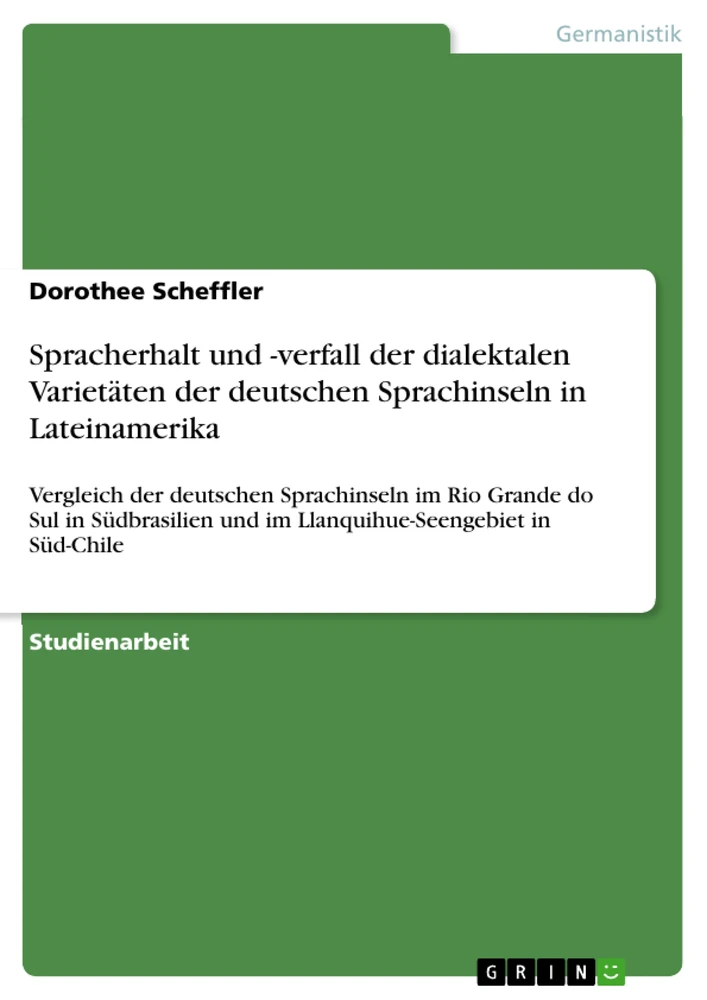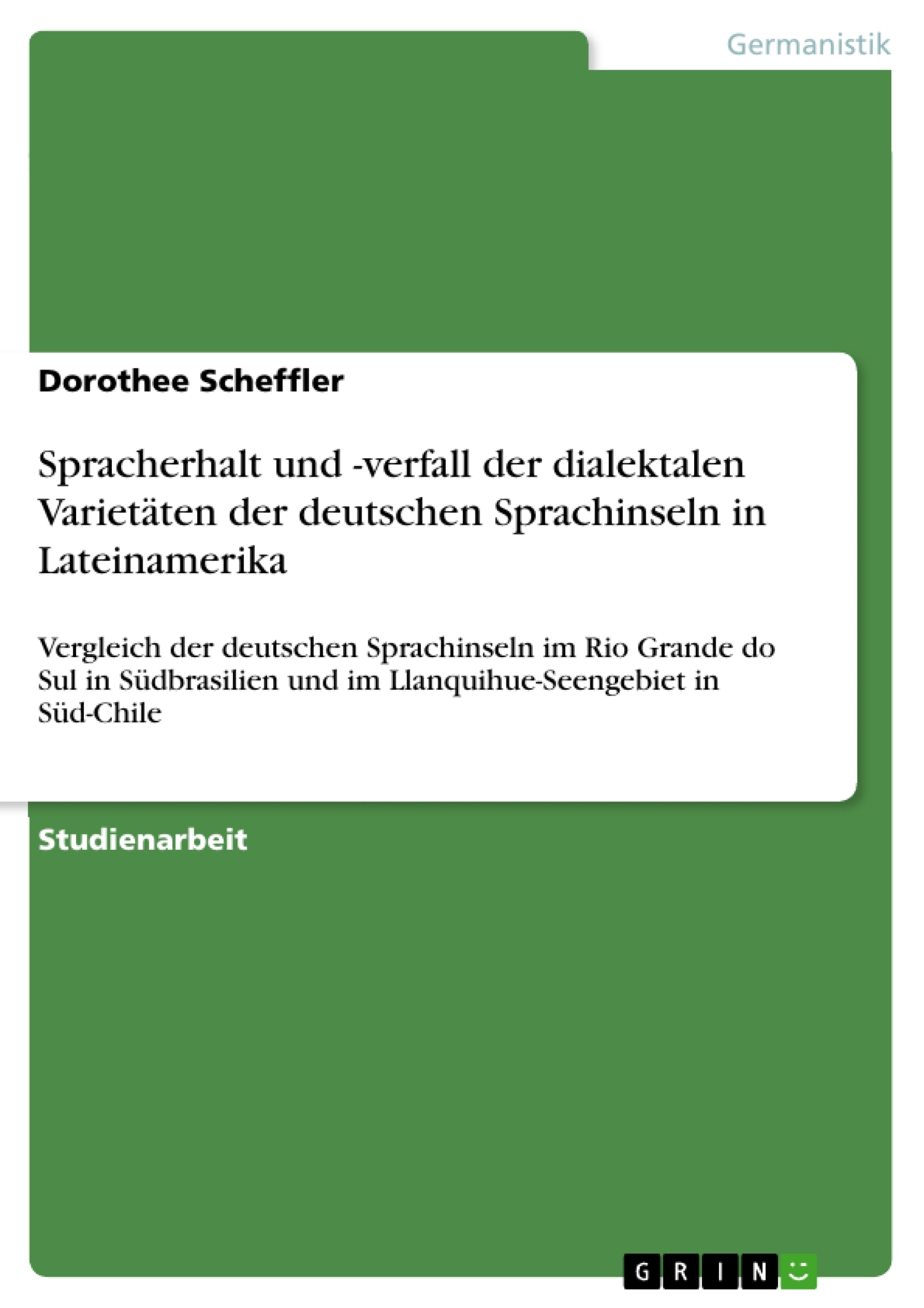„Der Mensch spricht und vernimmt die Sprache, er liest sie und schreibt sie auf. Sie gibt ihm Bewusstsein, Identität und Selbstverständnis. […] Über die Sprache lernen wir, in die Familie, die Kultur und unser Gemeinwesen hineinzuwachsen. […].“ (Pleines, Jochen 1989) Ausgehend von dieser Definition der Sprache, welcher hier ein sehr hoher Rang zukommt, ist es nicht verwunderlich, dass sich in Lateinamerika mit der Einwanderung vieler Deutschstämmiger zahlreiche deutsche Sprachinseln etabliert haben. Genauer in Augenschein genommen werden in der vorliegenden Arbeit die Sprachinseln in Südbrasilien und in Süd-Chile. Dabei stehen hauptsächlich die Aspekte des Sprachkontaktes im Vordergrund.
Während im ersten Abschnitt der Arbeit ein kurzer historischer Rückblick ausgehend von der genauen Eingrenzung der Gebiete, in denen die Sprachinseln heute noch existieren, über die Entstehung der deutschen Sprachinseln bis hin zur Herausbildung der dialektalen Varietäten gegeben wird, beschäftigt sich der daran anschließende Abschnitt mit dem soziolinguistischen Vergleich beider deutscher Sprachinseln.
Dabei soll vor allem der zweite Part Auskunft über ihre heutige Situation geben und inwieweit die Sprachinseln heute noch existent sind. Der Vergleich soll zeigen, ob sich die bestimmten Faktoren, die für den dialektalen Spracherhalt bzw. -verfall verantwortlich sind, ähneln oder weit auseinander gehen. Des Weiteren steht zum Schluss die Frage der möglichen Weiterexistenz der dialektalen Varietäten im Fokus. Vor allem in Bezug auf diese Frage, wird sich allerdings eine Beantwortung oder sogar Klärung als außerordentlich schwierig erweisen. Eine Frage also, die sich vielleicht nur, einhergehend mit der weiteren Verfolgung der deutschen Sprachinseln in Lateinamerika, in den nächsten Jahrzehnten klären lässt.
Besonders eine umfangreiche, wenn auch heute leider nicht mehr so aktuelle Literatur über diese beiden deutschen Sprachinseln, macht eine umfangreiche Analyse dessen möglich und lässt dennoch auch darüber hinaus noch viel Raum für weitere Untersuchungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- Part 1: Die Entstehung der Sprachinseln - ein geschichtlicher Rückblick
- 2. Definition einer Sprachinsel
- 3. Rio Grande do Sul
- 3.1. Die Auswanderung von Deutschstämmigen nach Südbrasilien
- 3.2. Die Gründe für die Auswanderung
- 3.3. Die Entstehung der deutschen Kolonie in Rio Grande do Sul
- 3.4. Die deutsche Sprache in Brasilien
- 3.5. Das Riograndenser Hunsrück
- 3.6. Die Herkunft der Sprecher
- 4. Der Kleine Süden Chiles
- 4.1. Die Auswanderung der Deutschstämmigen nach Süd-Chile
- 4.2. Die Gründe für die Auswanderung
- 4.3. Die Entstehung deutscher Kolonie
- 4.4. Die deutsche Sprache in den Siedlungsgebieten
- 4.5. Das Launa-Deutsch
- 4.6. Die Herkunft der Sprecher
- Part 2: Der Vergleich
- 5. Sprachkontakt, Spracherhalt, Sprachverfall
- 5.1. Faktoren für den Spracherhalt
- 5.2. Faktoren für den Sprachverfall
- 6. Schluss
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Vergleich deutscher Sprachinseln in Südbrasilien (Rio Grande do Sul) und Süd-Chile (Llanquihue-Seengebiet), fokussiert auf den Aspekt des Sprachkontakts und die Faktoren, die den Spracherhalt bzw. -verfall der dialektalen Varietäten beeinflussen. Ziel ist es, die heutige soziolinguistische Situation beider Sprachinseln zu analysieren und Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Hinblick auf den Spracherhalt zu identifizieren.
- Historische Entwicklung der deutschen Sprachinseln in Brasilien und Chile
- Analyse der Gründe für die Auswanderung der Deutschstämmigen
- Sprachkontakt und dessen Einfluss auf die dialektalen Varietäten
- Faktoren, die den Spracherhalt bzw. -verfall der deutschen Dialekte beeinflussen
- Vergleich der soziolinguistischen Situation der beiden Sprachinseln
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung legt die Grundlage der Arbeit, indem sie die Bedeutung der Sprache für Identität und Zugehörigkeit betont und die Fokussierung auf deutsche Sprachinseln in Südamerika einführt. Sie umreißt den Aufbau der Arbeit, der einen historischen Rückblick und einen soziolinguistischen Vergleich der Sprachinseln in Brasilien und Chile beinhaltet, mit dem Ziel, den Spracherhalt bzw. -verfall zu untersuchen und die zukünftige Existenz der dialektalen Varietäten zu beleuchten.
2. Definition einer Sprachinsel: Dieses Kapitel liefert eine präzise Definition des Begriffs "Sprachinsel", basierend auf bestehenden wissenschaftlichen Definitionen. Es betont die anfängliche geschlossene Struktur solcher Sprachgemeinschaften und die allmähliche Assimilation an die Umgebungssprache. Die Bedeutung des Gruppenbewusstseins und gemeinsamer Identitätssymbole für den Spracherhalt werden ebenfalls hervorgehoben.
3. Rio Grande do Sul: Das Kapitel beschreibt die Einwanderung der Deutschstämmigen nach Rio Grande do Sul, beginnend im 19. Jahrhundert. Es beleuchtet die Gründe für die Auswanderung, die sowohl aus wirtschaftlicher Not, politischen Instabilitäten in Europa, als auch aus der gezielten Anwerbung durch die brasilianische Regierung resultierten. Der Fokus liegt auf der Entstehung der deutschen Kolonie und der Entwicklung der deutschen Sprache in dieser Region. Die verschiedenen Einwanderungswellen und deren Hintergründe werden detailliert dargestellt.
4. Der Kleine Süden Chiles: Ähnlich wie Kapitel 3, konzentriert sich dieses Kapitel auf die Auswanderung und die Entstehung der deutschen Sprachinsel in Süd-Chile. Es beleuchtet die Gründe für die Auswanderung, die Entwicklung der deutschen Kolonie und die Herausbildung der spezifischen sprachlichen Varietät "Launa-Deutsch". Auch hier wird der Fokus auf die historischen und sozioökonomischen Faktoren gelegt, die die Entwicklung der Sprachinsel beeinflusst haben.
5. Sprachkontakt, Spracherhalt, Sprachverfall: Dieses Kapitel bildet den Kern des Vergleichs. Es analysiert die Faktoren, die den Spracherhalt oder -verfall in beiden Sprachinseln beeinflussen. Es wird erwartet, dass hier der Einfluss von Faktoren wie Sprachkontakt, sozioökonomische Bedingungen und politische Entwicklungen auf die Sprachsituation untersucht werden.
Schlüsselwörter
Sprachinsel, Rio Grande do Sul, Süd-Chile, Deutschstämmig, Spracherhalt, Sprachverfall, Sprachkontakt, Soziolinguistik, Dialekt, Auswanderung, Kolonisation, Brasilien, Chile.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema: Deutsche Sprachinseln in Südamerika
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht und vergleicht deutsche Sprachinseln in Südbrasilien (Rio Grande do Sul) und Süd-Chile (Llanquihue-Seengebiet). Der Fokus liegt auf dem Sprachkontakt und den Faktoren, die den Spracherhalt bzw. -verfall der dialektalen Varietäten beeinflussen. Ziel ist die Analyse der soziolinguistischen Situation und die Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Hinblick auf den Spracherhalt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der deutschen Sprachinseln in Brasilien und Chile, die Gründe für die Auswanderung der Deutschstämmigen, den Sprachkontakt und dessen Einfluss, Faktoren des Spracherhalts und -verfalls, sowie einen Vergleich der soziolinguistischen Situation beider Sprachinseln.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile: Teil 1 beleuchtet die Entstehung der Sprachinseln in Brasilien (Rio Grande do Sul) und Chile (Llanquihue-Seengebiet) historisch. Teil 2 vergleicht beide Sprachinseln hinsichtlich Sprachkontakt, Spracherhalt und -verfall. Zusätzlich enthält die Arbeit eine Einleitung, eine Definition des Begriffs "Sprachinsel", eine Zusammenfassung der Kapitel, ein Literaturverzeichnis und ein Schlüsselwortverzeichnis.
Welche Regionen werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf zwei spezifische Regionen: Rio Grande do Sul in Brasilien und den Kleinen Süden Chiles (Llanquihue-Seengebiet). Für beide Regionen werden die Einwanderung der Deutschstämmigen, die Gründe der Auswanderung, die Entwicklung der deutschen Kolonien und die sprachliche Entwicklung detailliert beschrieben.
Welche Faktoren beeinflussen den Spracherhalt bzw. -verfall?
Die Arbeit analysiert verschiedene Faktoren, die den Spracherhalt oder -verfall in den untersuchten Sprachinseln beeinflussen. Dazu gehören der Sprachkontakt mit der jeweiligen Umgebungssprache, sozioökonomische Bedingungen, politische Entwicklungen und das Gruppenbewusstsein der Sprachgemeinschaft.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, die heutige soziolinguistische Situation der deutschen Sprachinseln in Brasilien und Chile zu analysieren und die Faktoren zu identifizieren, die den Spracherhalt bzw. den Sprachverlust der deutschen Dialekte beeinflussen. Es sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Hinblick auf den Spracherhalt herausgearbeitet werden.
Welche Definition von "Sprachinsel" wird verwendet?
Die Arbeit verwendet eine präzise Definition des Begriffs "Sprachinsel", die auf bestehenden wissenschaftlichen Definitionen basiert. Besonderes Augenmerk wird auf die anfängliche geschlossene Struktur solcher Sprachgemeinschaften und die allmähliche Assimilation an die Umgebungssprache gelegt. Die Bedeutung des Gruppenbewusstseins und gemeinsamer Identitätssymbole für den Spracherhalt wird ebenfalls hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Sprachinsel, Rio Grande do Sul, Süd-Chile, Deutschstämmig, Spracherhalt, Sprachverfall, Sprachkontakt, Soziolinguistik, Dialekt, Auswanderung, Kolonisation, Brasilien, Chile.
- Quote paper
- Dorothee Scheffler (Author), 2012, Spracherhalt und -verfall der dialektalen Varietäten der deutschen Sprachinseln in Lateinamerika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320827