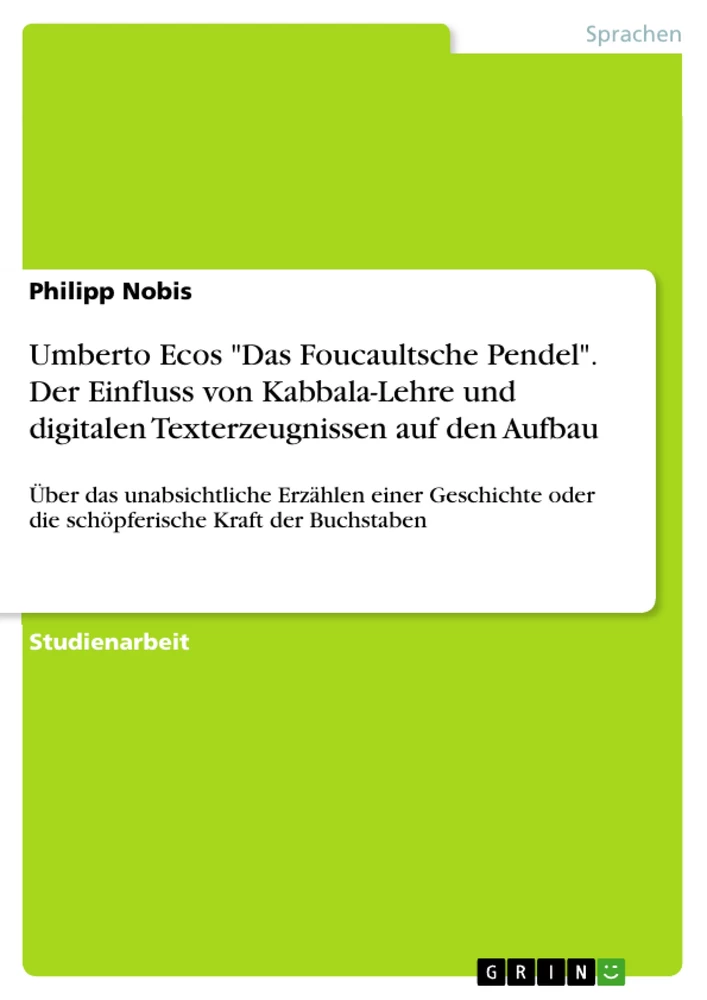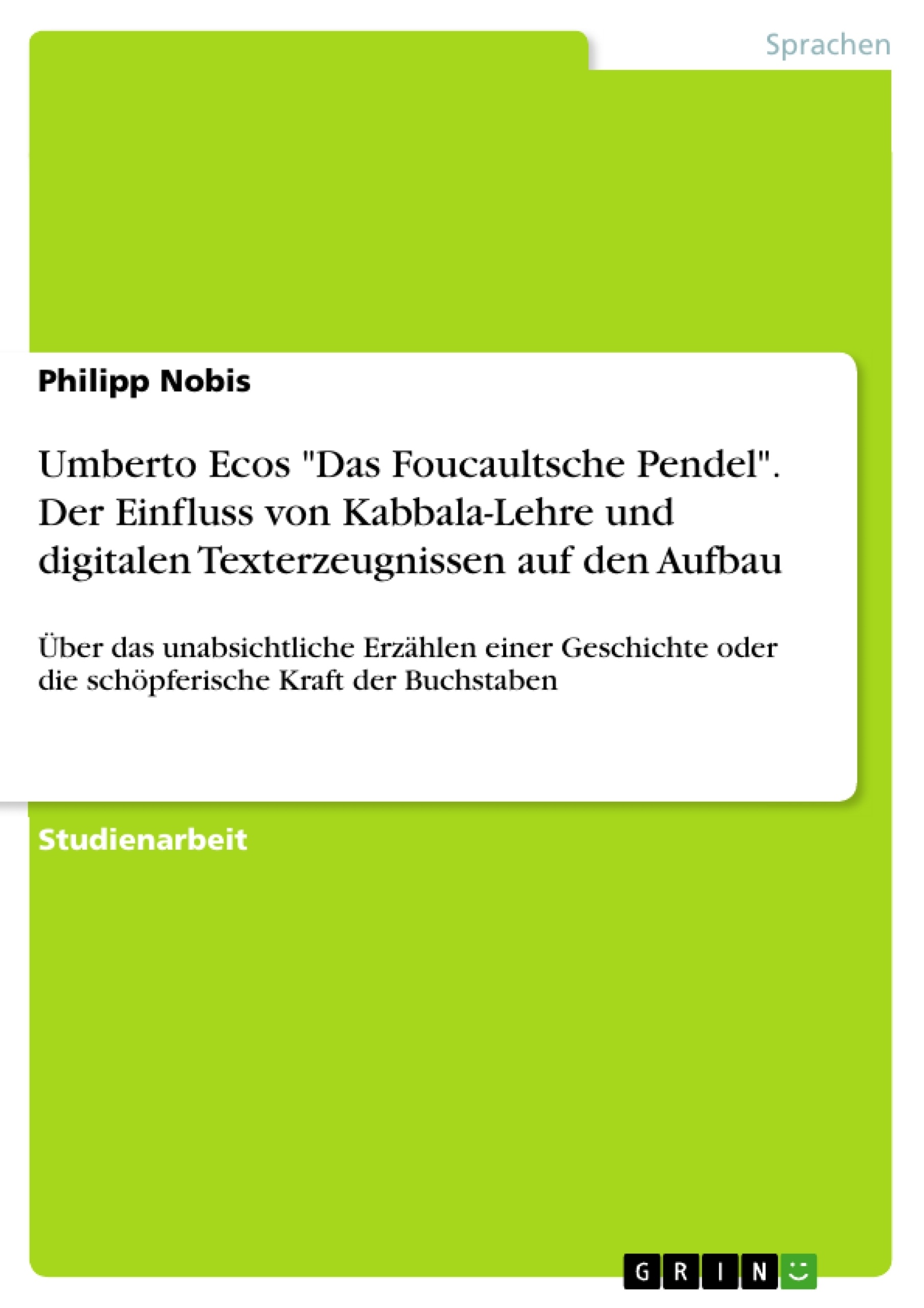Schon lange vor Dan Brown setzte sich Umberto Eco mit Verschwörungstheorien aller Art auseinander. In seinem quasi allumfassenden Werk "Das Foucaultsche Pendel" zeichnet Eco eine Geschichte der Verschwörungstheorien, die im Mittelalter bei den Templern beginnt und bis ins 20 Jh. reicht. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie die Lehren der jüdischen und mystischen Kabbala (besonders hervorzuheben ist hier das System der zehn Sefirot) und die Theorie der digitale Texterzeugnisse den Aufbau des Buches beeinflussen.
Dazu werde ich zunächst die beiden eben genannten Begriffe näher eingrenzen. Danach soll es um das System der zehn Sefirot gehen. Dies wird den größten Teil der Arbeit ausmachen. Darauf folgend werde ich den Umgang mit Texten seitens der Kabbalisten und der drei Hauptfiguren im Buch betrachten und zum Schluss auf die besondere Rolle des Computers Abulafia eingehen. Dabei werde ich die Gemeinsamkeiten der Arbeitsweisen zur Textgenerieung im Buch und von Theo Lutz und Rul Gunzehäuser aufzeigen. Um ein einfacheres Lesen dieses Textes zu ermöglichen, gebe ich meine Textverweise in Fußnoten an.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Begriffsklärung
- Die zehn Sefirot
- Symbolisches Verstehen von Texten
- Abulaifia und die Stochastischen Texte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Roman "Das Foucaultsche Pendel" von Umberto Eco und analysiert, wie die Lehren der Kabbala und digitale Texterzeugnisse den Aufbau des Buches beeinflussen. Dabei werden die Begriffe "digitale Texterzeugnisse" und "Kabbala" näher erläutert, das System der zehn Sefirot vorgestellt und der Umgang mit Texten seitens der Kabbalisten und der drei Hauptfiguren im Buch betrachtet.
- Die Rolle der Kabbala im Roman
- Digitale Texterzeugnisse als narrative Elemente
- Das System der zehn Sefirot und seine Bedeutung
- Textgenerierung und ihre Gemeinsamkeiten in der fiktiven Welt und der Realität
- Die Bedeutung des Computers "Abulafia" im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des Romans "Das Foucaultsche Pendel" und die darin behandelten Konzepte der Kabbala und digitaler Texterzeugnisse ein. Im zweiten Kapitel wird eine allgemeine Begriffsklärung der beiden genannten Begriffe vorgenommen. Das dritte Kapitel widmet sich dem System der zehn Sefirot, einem zentralen Element der Kabbala. Die folgenden Kapitel analysieren den Umgang mit Texten seitens der Kabbalisten und der drei Hauptfiguren im Roman, wobei der Fokus auf der besonderen Rolle des Computers "Abulafia" und den Gemeinsamkeiten der Arbeitsweisen zur Textgenerierung im Buch und in der realen Welt liegt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Kabbala, digitale Texterzeugnisse, Sefirot, Textgenerierung, Umberto Eco, "Das Foucaultsche Pendel", Abulafia, homodiegetische Erzählinstanz und intertextuelle Anspielungen.
- Quote paper
- Philipp Nobis (Author), 2015, Umberto Ecos "Das Foucaultsche Pendel". Der Einfluss von Kabbala-Lehre und digitalen Texterzeugnissen auf den Aufbau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320424