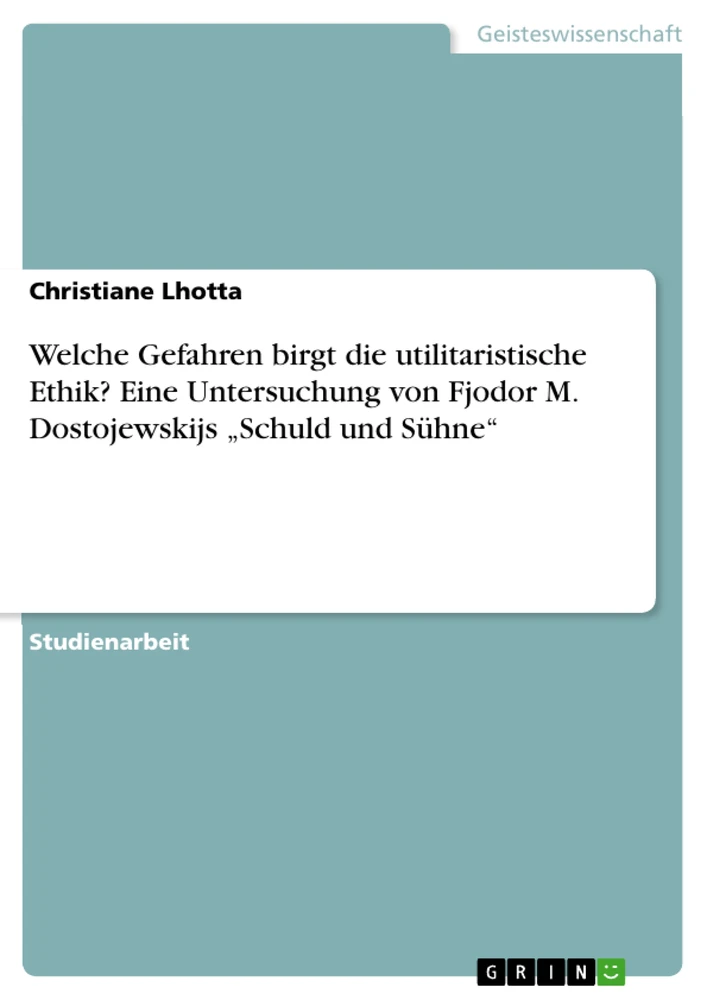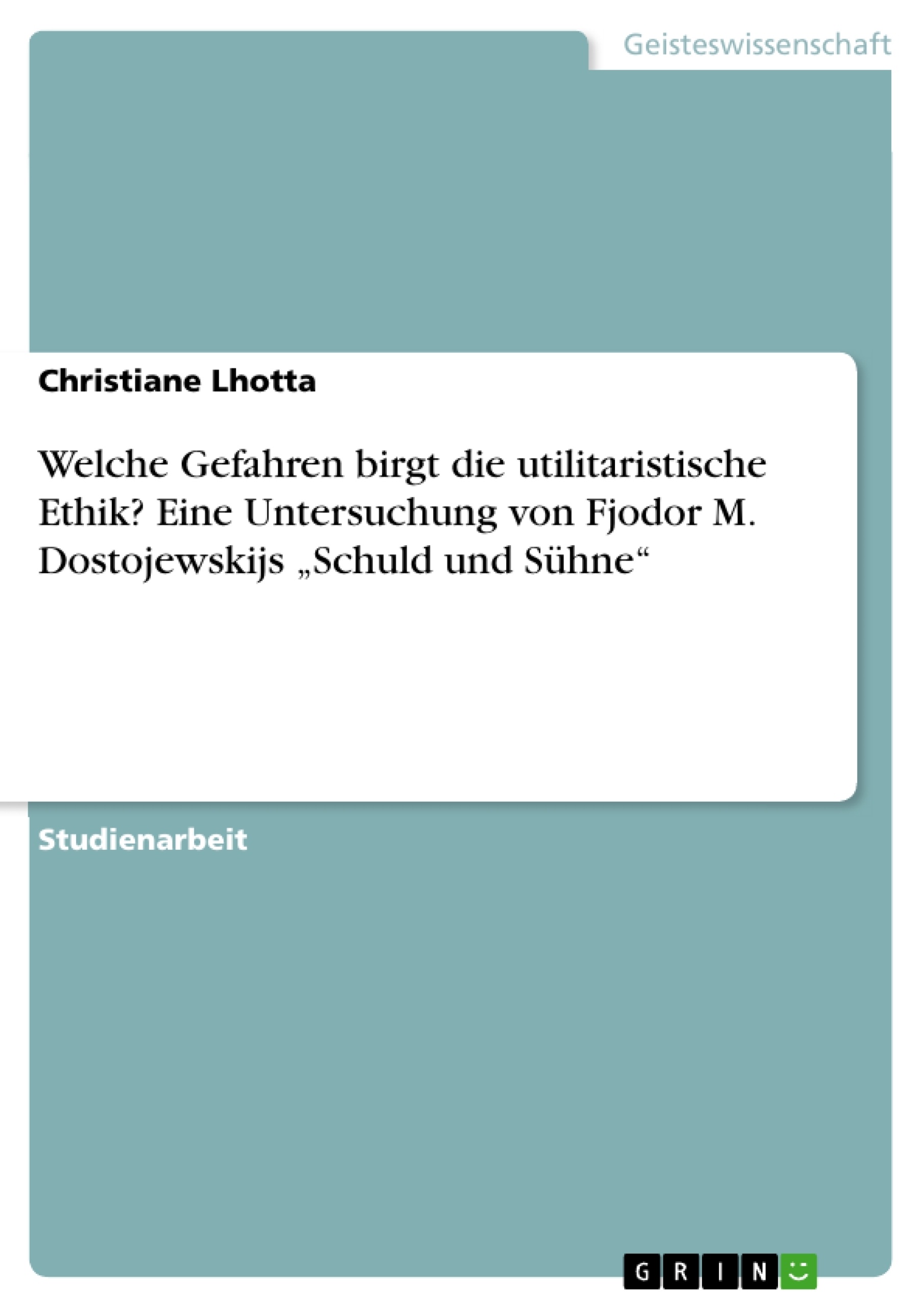Was ist humanes Leben? Ab welchem Entwicklungsstadium gilt ein Embryo als Mensch? Oder lässt ihn erst die Geburt zum menschlichen Wesen werden? Diese und weitere Fragen werden im Folgenden am Beispiel der utilitaristischen Ethik sowie unter Rückgriff auf die literarische Vorlage "Schuld und Sühne" des russischen Autors Fjodor. M. Dostojewskij untersucht. Beispiele aus dem Bereich der Bioethik erläutern den Bezug dieser Theorie zu gegenwärtigen Sichtweisen.
Während die utilitaristische Ethik der Durchschnittsbevölkerung weniger bekannt sein dürfte, hat sie doch seit ihrer Entstehung Einfluss auf das gesellschaftliche Leben und auf moralische Vorstellungen genommen.
Als Beispiel sind u. a. Diskussionen über den § 218 zu nennen. Das Thema Abtreibung erfordert stets die Auseinandersetzung mit der Frage, zu welchem Zeitpunkt menschliches Leben entsteht, ab welchem Entwicklungsstadium ein Embryo als Mensch angesehen werden soll oder ob ihn erst die Geburt zum menschlichen Wesen werden lässt. Für prinzipielle Abtreibungsgegner bedeutet eine Schwangerschaftsunterbrechung in jedem Fall Tötung menschlichen Lebens.
Kürzlich geriet die Mannheimer Ausstellung „Körperwelten“ in die öffentliche Kritik. Insbesondere seitens der Kirchen wurden die unterschiedlichen plastischen Darstellungen des menschlichen Organismus als unwürdig bezeichnet.
Nicht zuletzt eröffnet das Thema der Euthanasie die Notwendigkeit, derzeit bestehende oder praktizierte sittliche Grenzen neu zu überdenken, um letztlich auch seinen eigenen Standpunkt diesbezüglich finden zu können.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. 1. Zur utilitaristischen Ethik
- 1.1 Ursprung des Utilitarismus
- 1.2 Grundelemente der utilitaristischen Ethik
- 2. Literarischer Bezug: Dostojewskijs „Schuld und Sühne“
- 2.1 Raskolnikows Theorie über das Verbrechen
- 2.2 Deutung des Romans
- 3. Zur gegenwärtigen Auseinandersetzung des Utilitarismus
- 3.1 Utilitarismus als Angriff auf die Würde des Menschen
- 3.2 Grenzen der Bioethik
- III. Fazit / Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Grundprinzipien des Utilitarismus und seine Anwendung auf ethische Dilemmata. Sie analysiert die potenziellen Gefahren und Grenzen dieser ethischen Theorie anhand literarischer Beispiele und aktueller bioethischer Debatten. Das Ziel ist es, ein kritisches Verständnis des Utilitarismus zu fördern und seine Anwendbarkeit auf reale Situationen zu hinterfragen.
- Ursprung und Entwicklung des Utilitarismus
- Grundelemente und Prinzipien der utilitaristischen Ethik
- Dostojewskijs „Schuld und Sühne“ als literarische Fallstudie
- Anwendung des Utilitarismus in der Bioethik
- Grenzen und Kritik des Utilitarismus
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Utilitarismus ein und beleuchtet seine Relevanz für gesellschaftliche Diskussionen, beispielsweise im Kontext von Abtreibung, der Ausstellung „Körperwelten“ und Euthanasie. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und hebt die zentrale Fragestellung hervor: die kritische Auseinandersetzung mit den Grundgedanken des Utilitarismus und seinen potenziellen Gefahren.
II. 1. Zur utilitaristischen Ethik: Dieses Kapitel erörtert den Ursprung des Utilitarismus im 18. Jahrhundert, beginnend mit den Beiträgen von Bentham und Mill. Es beschreibt den Utilitarismus als Versuch, allgemein verbindliche Normen wissenschaftlich zu begründen, unabhängig von metaphysischen oder religiösen Einflüssen. Der Hedonismus, der Universalismus und der radikale Egoismus werden als historische Vorläufer erwähnt. Das Kapitel differenziert verschiedene Varianten des Utilitarismus, ohne diese im Detail zu behandeln. Die vier zentralen Kriterien für die Beurteilung moralischer Handlungen werden detailliert erläutert: die Fokussierung auf Folgen, das allgemeine "Gute" als Maßstab, die Maximierung menschlichen Glücks und die Berücksichtigung des Wohlergehens aller Betroffenen. Das utilitaristische Prinzip, wonach die Handlung mit den optimalen Folgen für das Wohlergehen aller moralisch richtig ist, wird abschließend formuliert.
II. 2. Literarischer Bezug: Dostojewskijs „Schuld und Sühne“: Dieses Kapitel analysiert Dostojewskijs Roman „Schuld und Sühne“ im Hinblick auf utilitaristische Aspekte. Es wird die Geschichte von Raskolnikow und seinem Doppelmord im Kontext des Utilitarismus interpretiert. Der Fokus liegt auf Raskolnikows persönlicher Theorie und der Darstellung seiner psychischen Belastung nach der Tat. Der Roman wird als Beispiel dafür verwendet, wie die praktische Umsetzung utilitaristischer Prinzipien zu negativen Folgen führen kann. Raskolnikows letztlicher Zusammenbruch und sein Geständnis werden als Konsequenz seiner Handlung interpretiert.
Schlüsselwörter
Utilitarismus, Ethik, Moral, Handlungsfolgen, Allgemeinwohl, Glück, Bedürfnisbefriedigung, Dostojewskij, Schuld und Sühne, Bioethik, Würde des Menschen, Grenzen der Moral.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Utilitarismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Grundprinzipien des Utilitarismus und seine Anwendung auf ethische Dilemmata. Sie untersucht die potenziellen Gefahren und Grenzen dieser ethischen Theorie anhand literarischer Beispiele (Dostojewskijs „Schuld und Sühne“) und aktueller bioethischer Debatten. Das Ziel ist ein kritisches Verständnis des Utilitarismus und die Hinterfragung seiner Anwendbarkeit auf reale Situationen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Ursprung und die Entwicklung des Utilitarismus, seine Grundelemente und Prinzipien, die Anwendung in der Bioethik, Grenzen und Kritik des Utilitarismus sowie eine detaillierte literarische Analyse von Dostojewskijs „Schuld und Sühne“ im Kontext utilitaristischer Aspekte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Eine Einleitung, ein Hauptteil mit Unterkapiteln zum Utilitarismus, Dostojewskijs „Schuld und Sühne“ und der gegenwärtigen Auseinandersetzung mit dem Utilitarismus, sowie ein abschließendes Fazit/Stellungnahme.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik des Utilitarismus ein und beleuchtet seine Relevanz für gesellschaftliche Diskussionen (Abtreibung, „Körperwelten“, Euthanasie). Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und hebt die zentrale Fragestellung hervor: die kritische Auseinandersetzung mit den Grundgedanken des Utilitarismus und seinen potenziellen Gefahren.
Was wird im Kapitel über den Utilitarismus behandelt?
Dieses Kapitel erörtert den Ursprung des Utilitarismus (Bentham, Mill), beschreibt ihn als Versuch, allgemein verbindliche Normen wissenschaftlich zu begründen, und differenziert verschiedene Varianten. Es erläutert detailliert die vier zentralen Kriterien zur Beurteilung moralischer Handlungen: Fokussierung auf Folgen, das allgemeine "Gute" als Maßstab, Maximierung menschlichen Glücks und Berücksichtigung des Wohlergehens aller Betroffenen.
Wie wird Dostojewskijs „Schuld und Sühne“ in die Analyse einbezogen?
Dieses Kapitel analysiert Dostojewskijs Roman im Hinblick auf utilitaristische Aspekte. Es interpretiert Raskolnikows Geschichte und seinen Doppelmord im Kontext des Utilitarismus, fokussiert auf seine Theorie und die Darstellung seiner psychischen Belastung. Der Roman dient als Beispiel für die negativen Folgen der praktischen Umsetzung utilitaristischer Prinzipien.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Utilitarismus, Ethik, Moral, Handlungsfolgen, Allgemeinwohl, Glück, Bedürfnisbefriedigung, Dostojewskij, Schuld und Sühne, Bioethik, Würde des Menschen, Grenzen der Moral.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
(Der Inhalt des Fazits/der Stellungnahme wird in der vorliegenden Zusammenfassung nicht explizit dargestellt. Diese Information müsste aus dem vollständigen Text entnommen werden.)
- Quote paper
- Christiane Lhotta (Author), 1998, Welche Gefahren birgt die utilitaristische Ethik? Eine Untersuchung von Fjodor M. Dostojewskijs „Schuld und Sühne“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320007