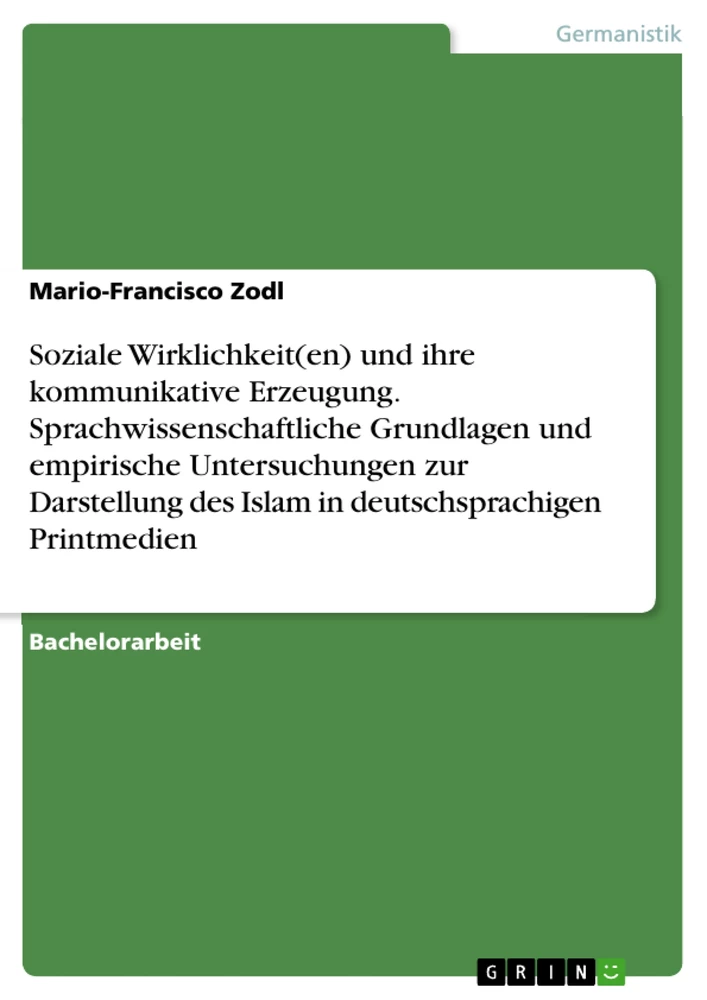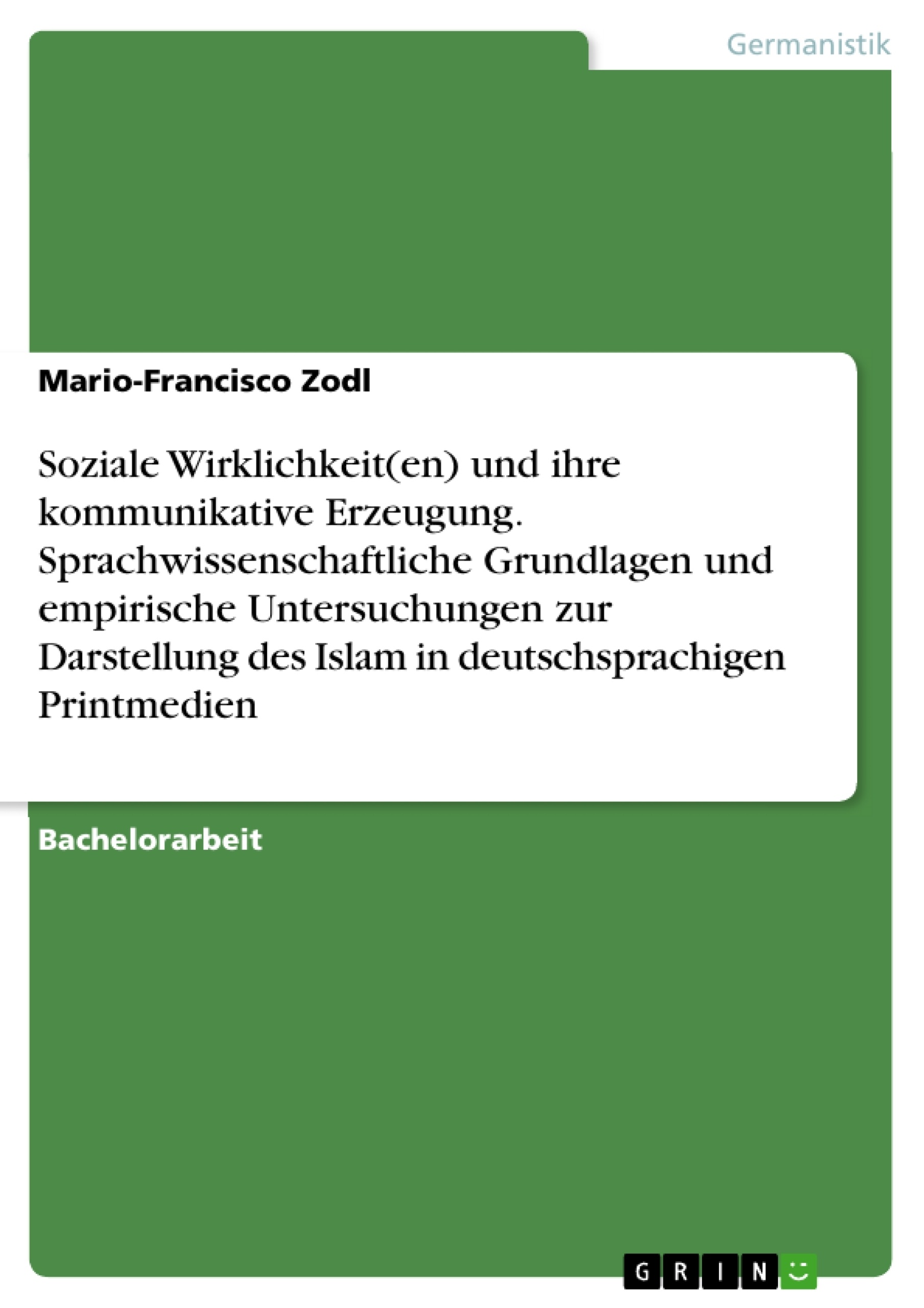Die Soziologie, vor allem der Sozialkonstruktivismus, eine der vielen Strömungen innerhalb konstruktivistischer Positionen, beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Wissen und Wirklichkeit. Dabei gehen die Wissenssoziologen davon aus, dass eben das Wissen die Ursache für die Konstruktion einer Wirklichkeit sei.
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, dieses Verhältnis näher zu bestimmen, wobei eine Perspektivenerweiterung auf den Gegenstand vollzogen wird. Durch die Erweiterung kommt es zur Berücksichtigung der kommunikativen Erzeugung der sozialen Wirklichkeit. Sie bildet demnach den Schwerpunkt und den linguistischen Rahmen dieser Arbeit und wird dadurch konkretisiert, dass empirisch untersucht wird, welches Bild die deutschen Printmedien vom Islam erzeugen. Dieser Ansatz scheint insofern von Bedeutung zu sein, als dass er eine eventuelle Parallele zum Judenbild im Dritten Reich ermöglicht. Sind die Muslime in Deutschland die neuen Fremden, die durch modernere Formen der Mediengestaltung stigmatisiert werden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Konstruktivismus und seine Wirklichkeitsbestimmungen
- Wirklichkeitskonstruktion und Massenmedien
- Die verzerrte Wirklichkeit in den Medien
- Die Wirklichkeit als mediale Konstruktion
- Die Inszenierung einer Realität
- Darstellung der islamischen Welt: Das Islambild der Medien
- Fallstudie
- Forschungsstand
- Daten und Methoden
- Kontrastive Betrachtung: Bedeutung und Konzepte
- Fatwa
- Dschihad
- Salafismus
- Scharia
- Ergebnisse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen Wissen und Wirklichkeit, insbesondere im Kontext der kommunikativen Erzeugung sozialer Realität. Der Schwerpunkt liegt auf der empirischen Analyse des Islambildes in deutschsprachigen Printmedien. Es wird geprüft, ob Parallelen zum Judenbild im Dritten Reich bestehen und ob Muslime heute durch moderne Medien stigmatisiert werden. Die Arbeit kritisiert den erkenntnistheoretischen Relativismus des Sozialkonstruktivismus.
- Analyse des Verhältnisses von Wissen und Wirklichkeit im Sozialkonstruktivismus
- Kritik am erkenntnistheoretischen Relativismus des Sozialkonstruktivismus
- Empirische Untersuchung des Islambildes in deutschen Printmedien
- Vergleich mit der medialen Darstellung von Minderheiten in der Vergangenheit (z.B. Juden im Dritten Reich)
- Bewertung des Einflusses der Medien auf die Wirklichkeitskonstruktion
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des gesellschaftlichen Pluralismus und der unterschiedlichen Wahrnehmungen von Wirklichkeit ein. Sie betont die Bedeutung interkultureller Kompetenzen und verweist auf die Rolle der Medien bei der Konstruktion von Wirklichkeitsbildern, exemplarisch dargestellt an der NS-Propaganda. Die Arbeit untersucht das Verhältnis von Wissen und Wirklichkeit, fokussiert auf die mediale Konstruktion des Islambildes in Deutschland und fragt nach möglichen Parallelen zur Vergangenheit. Die zentralen Forschungsfragen und die These der Arbeit werden vorgestellt.
Der Konstruktivismus und seine Wirklichkeitsbestimmungen: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in den Konstruktivismus und seine verschiedenen Richtungen. Der Fokus liegt auf dem Sozialkonstruktivismus und seiner Relevanz für die Untersuchung der Wirklichkeitskonstruktion durch Medien. Die unterschiedlichen konstruktivistischen Positionen werden erläutert und im Hinblick auf die Forschungsfrage analysiert. Die Kapitel bildet die theoretische Grundlage für die weitere Analyse.
Wirklichkeitskonstruktion und Massenmedien: Dieses Kapitel analysiert die Rolle von Massenmedien bei der Konstruktion von Wirklichkeit. Es untersucht, wie Medien Wissen vermitteln und dadurch die Wahrnehmung der Realität beeinflussen. Die Kapitel beleuchtet die Mechanismen der medialen Wirklichkeitsgestaltung und deren Einfluss auf das individuelle und gesellschaftliche Denken und Handeln.
Darstellung der islamischen Welt: Das Islambild der Medien: Dieses Kapitel bildet den empirischen Kern der Arbeit. Es untersucht die Darstellung des Islams in deutschen Printmedien, analysiert die verwendeten Sprachmittel und untersucht die thematische Einordnung des Islams. Es wird die Forschungsfrage nach der möglichen Stigmatisierung von Muslimen durch die Medien untersucht und diskutiert. Die Kapitel betrachtet Fallstudien und den Forschungsstand um die eigene Untersuchung zu kontextualisieren und zu interpretieren.
Schlüsselwörter
Sozialkonstruktivismus, Massenmedien, Wirklichkeitskonstruktion, Islambild, Printmedien, Islamophobie, Medienwirkung, interkulturelle Kommunikation, Wissenssoziologie, Repräsentation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Medienkonstruktionen des Islambildes
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie das Bild des Islams in deutschsprachigen Printmedien konstruiert wird und welche Auswirkungen diese mediale Konstruktion auf die Wahrnehmung und das Verständnis des Islams in der Gesellschaft hat. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Frage, ob Parallelen zur Stigmatisierung von Juden im Dritten Reich bestehen.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf den Sozialkonstruktivismus, um die Wirklichkeitskonstruktion durch Medien zu analysieren. Sie beleuchtet verschiedene konstruktivistische Positionen und deren Relevanz für die Untersuchung der medialen Darstellung des Islams. Die Arbeit kritisiert dabei den erkenntnistheoretischen Relativismus des Sozialkonstruktivismus.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Der empirische Teil der Arbeit basiert auf einer Analyse deutschsprachiger Printmedien. Die Arbeit untersucht die verwendeten Sprachmittel, die thematische Einordnung des Islams und sucht nach Anzeichen von Stigmatisierung. Es werden Fallstudien herangezogen und der bestehende Forschungsstand berücksichtigt.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Begriffe sind Sozialkonstruktivismus, Massenmedien, Wirklichkeitskonstruktion, Islambild, Printmedien, Islamophobie, Medienwirkung, interkulturelle Kommunikation, Wissenssoziologie und Repräsentation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Konstruktivismus und seinen Wirklichkeitsbestimmungen, ein Kapitel zu Wirklichkeitskonstruktion und Massenmedien, ein Kapitel zur Darstellung der islamischen Welt in den Medien (inkl. Fallstudie, Forschungsstand, Daten und Methoden, kontrastiver Betrachtung wichtiger Begriffe wie Fatwa, Dschihad, Salafismus und Scharia sowie Ergebnisse) und ein Fazit.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht das Verhältnis von Wissen und Wirklichkeit im Kontext der medialen Konstruktion sozialer Realität. Sie fragt nach dem Einfluss der Medien auf die Wirklichkeitskonstruktion, nach möglichen Parallelen zur medialen Darstellung von Minderheiten in der Vergangenheit (z.B. Juden im Dritten Reich) und ob Muslime durch moderne Medien stigmatisiert werden.
Welche These vertritt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die These, dass die mediale Darstellung des Islams in Deutschland Parallelen zur Stigmatisierung von Minderheiten in der Vergangenheit aufweisen könnte und somit einen Beitrag zur Islamophobie leistet. Die genaue These wird in der Einleitung detailliert vorgestellt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Die konkreten Schlussfolgerungen werden im Fazit der Arbeit präsentiert und können hier nicht im Detail wiedergegeben werden. Das Fazit fasst die Ergebnisse der empirischen Analyse zusammen und bewertet deren Bedeutung im Kontext der Forschungsfragen.)
- Citar trabajo
- Mario-Francisco Zodl (Autor), 2014, Soziale Wirklichkeit(en) und ihre kommunikative Erzeugung. Sprachwissenschaftliche Grundlagen und empirische Untersuchungen zur Darstellung des Islam in deutschsprachigen Printmedien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319840