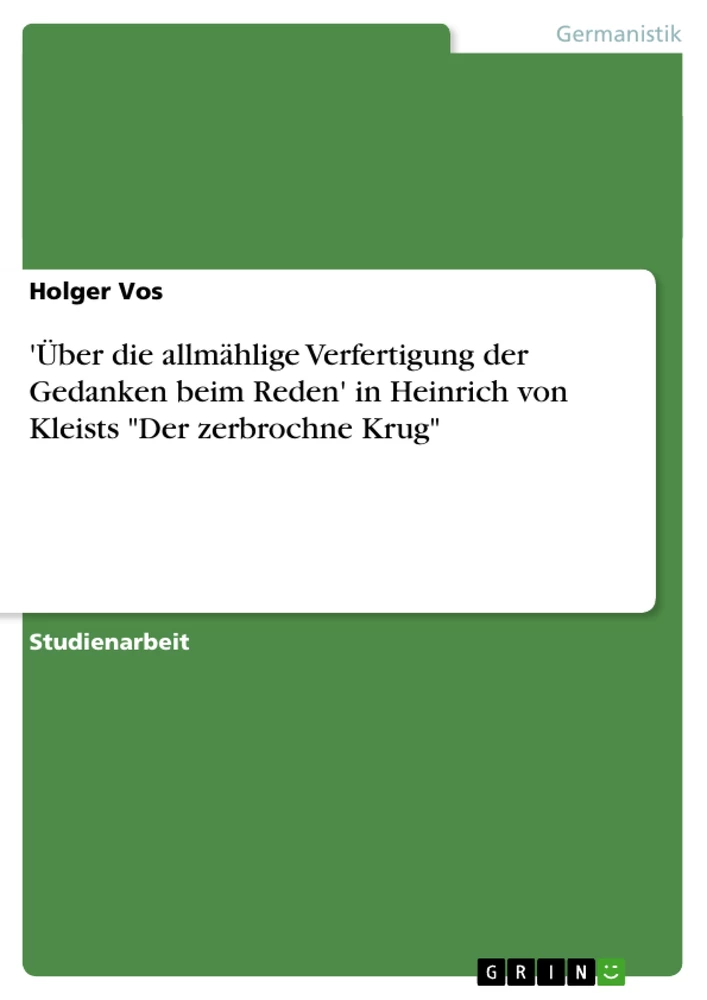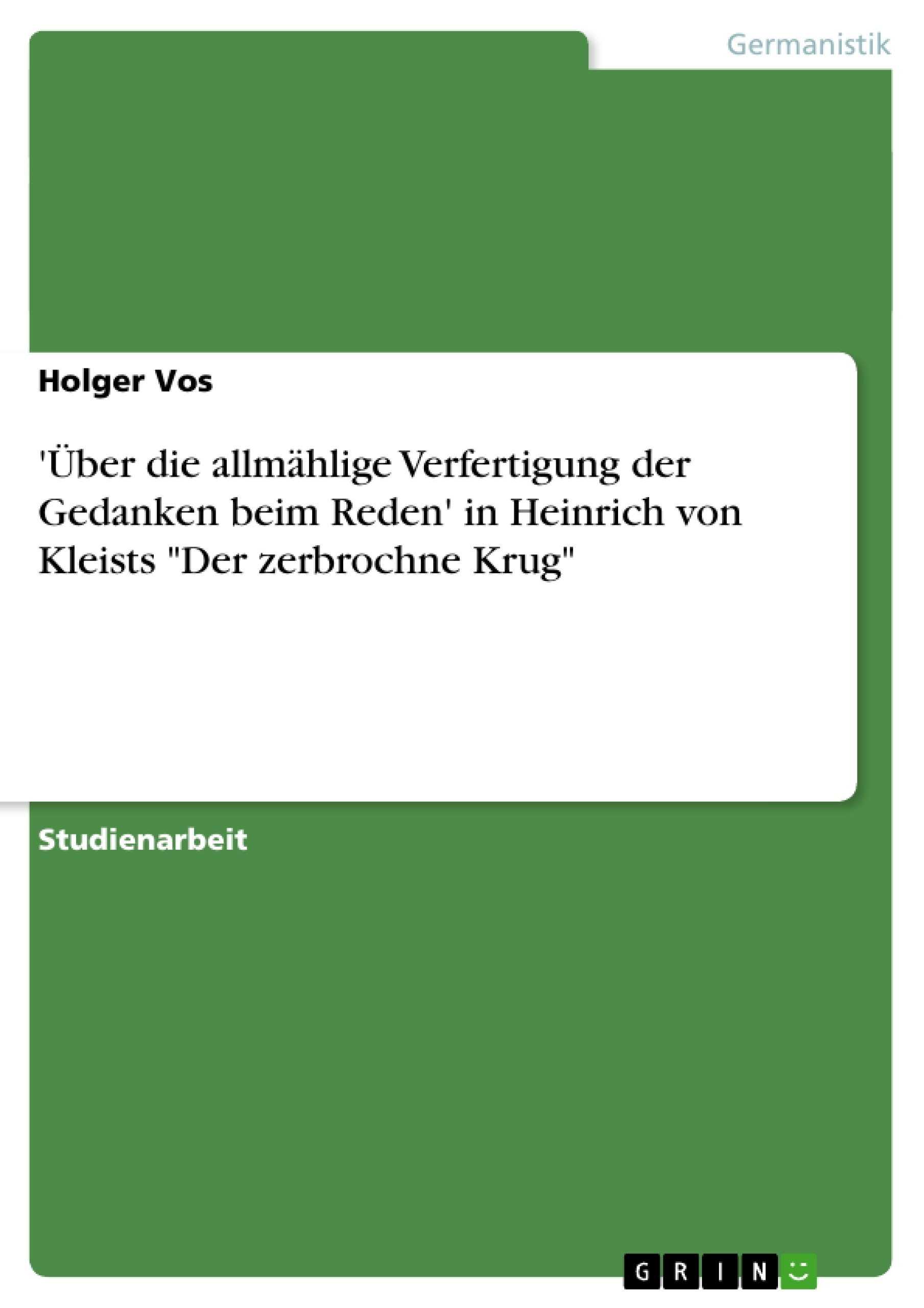Auf welche Weise entstehen die Gedanken und welche Rolle spielt die mündliche Rede in diesem Zusammenhang?
Zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts beschäftigte sich Heinrich von Kleist (1777-1811) mit dieser Thematik; er entwickelte in seinem Aufsatz „Über die allmählige Verfertigung der Gedanken beim Reden“ völlig neue Ansichten über Sprache, Denken und die Entstehung von Gedanken. Damit stellte er die traditionellen Ansichten und Vorstellungen über Sprache und Denken in Frage. In dieser Hausarbeit sollen beide Modelle – das Kleist´sche und das traditionelle Modell – gegenübergestellt und ihre wesentlichen Merkmale dargestellt werden; dabei wird seine Abhandlung über die Gedankenverfertigung beim Reden mit Kleists Leben und seinem Gesamtwerk in Beziehung gesetzt. Weiterhin soll geklärt werden, welche Konsequenzen die jeweiligen Modelle für Sprache im Allgemeinen und auch für die Literatur haben.
Außerdem wird der Frage nachgegangen, ob und inwieweit es Kleist gelingt, sein Modell der Gedankenverfertigung beim Reden in seinem Lustspiel „Der zerbrochne Krug“ anzuwenden und darzustellen.
Könnte die Figur des Dorfrichters Adam die dramentechnische Umsetzung des Kleist´schen Modells sein?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Worte und Fragestellung
- Denken beim Reden - Reden vor dem Denken
- Die Gedankenverfertigung in Kleists „Der zerbrochne Krug“
- Zusammenfassender Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, Heinrich von Kleists Modell der „allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden“ in seinem Aufsatz mit dem traditionellen Sprach- und Denkmodell zu vergleichen und die wichtigsten Merkmale beider Modelle darzustellen. Dabei wird Kleists Abhandlung in den Kontext seines Lebens und seines Gesamtwerks gestellt, um die Hintergründe seiner Theorie zu verstehen. Die Arbeit untersucht auch die Konsequenzen, die beide Modelle für Sprache im Allgemeinen und für die Literatur haben. Darüber hinaus wird untersucht, inwieweit Kleist sein Modell in seinem Lustspiel „Der zerbrochne Krug“ umsetzt und ob die Figur des Dorfrichters Adam als dramentechnische Umsetzung des Kleist’schen Modells betrachtet werden kann.
- Kleists Kritik am traditionellen Sprachmodell und seine Suche nach einem unmittelbaren Ausdruck der Seele
- Die „allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ als alternatives Kommunikationsmodell
- Die Rolle der Sprache in Kleists Werk und seine Auswirkungen auf die Literatur
- Die dramentechnische Umsetzung des Kleist’schen Modells in „Der zerbrochne Krug“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitende Worte und Fragestellung
Das Kapitel stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Wie entstehen Gedanken und welche Rolle spielt die mündliche Rede in diesem Zusammenhang? Es stellt Heinrich von Kleists Aufsatz „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ als Ausgangspunkt der Untersuchung dar und skizziert die Gegenüberstellung des Kleist’schen Modells mit dem traditionellen Sprach- und Denkmodell.
2. Denken beim Reden - Reden vor dem Denken
In diesem Kapitel werden die beiden Modelle des Denkens und Sprechens gegenübergestellt. Das traditionelle Modell betrachtet Sprache als ein System zur Übermittlung von Informationen, während Kleist ein alternatives Modell vorschlägt, in dem Gedanken durch den Prozess des Sprechens selbst entstehen. Das Kapitel analysiert Kleists Kritik am traditionellen Modell und seine Suche nach einer Sprache, die den unmittelbaren Ausdruck der Seele ermöglicht.
Schlüsselwörter
Heinrich von Kleist, Gedankenverfertigung beim Reden, Sprachmodell, Kommunikationsmodell, unmittelbarer Ausdruck der Seele, „Der zerbrochne Krug“, Dorfrichter Adam, Tradition und Moderne, Sprache und Denken, Literatur
- Quote paper
- Holger Vos (Author), 2001, 'Über die allmählige Verfertigung der Gedanken beim Reden' in Heinrich von Kleists "Der zerbrochne Krug", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31976