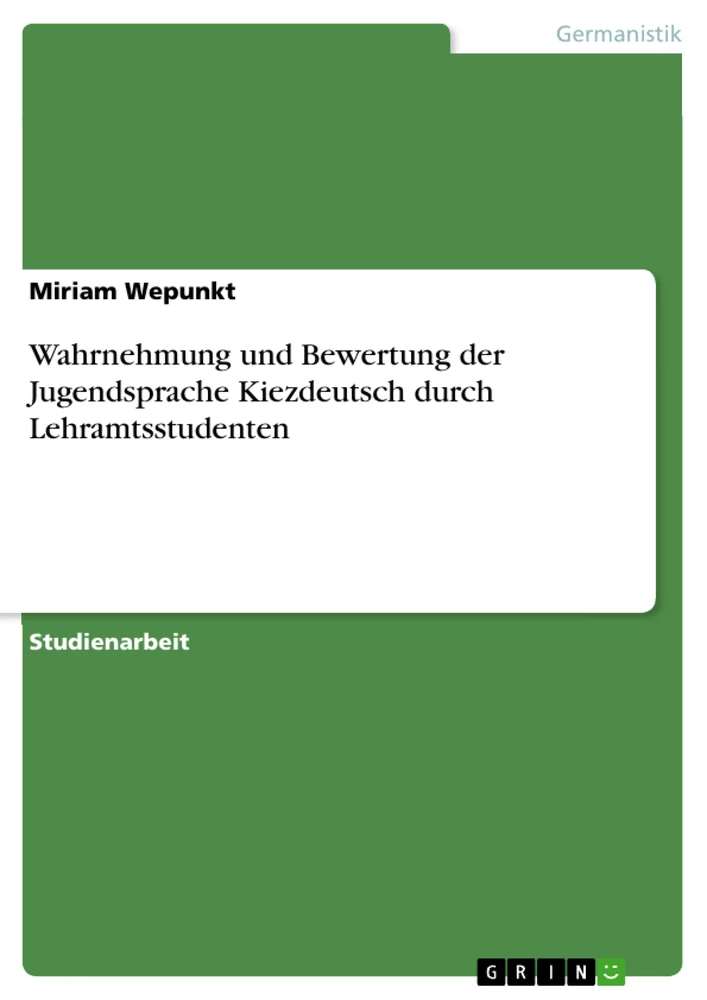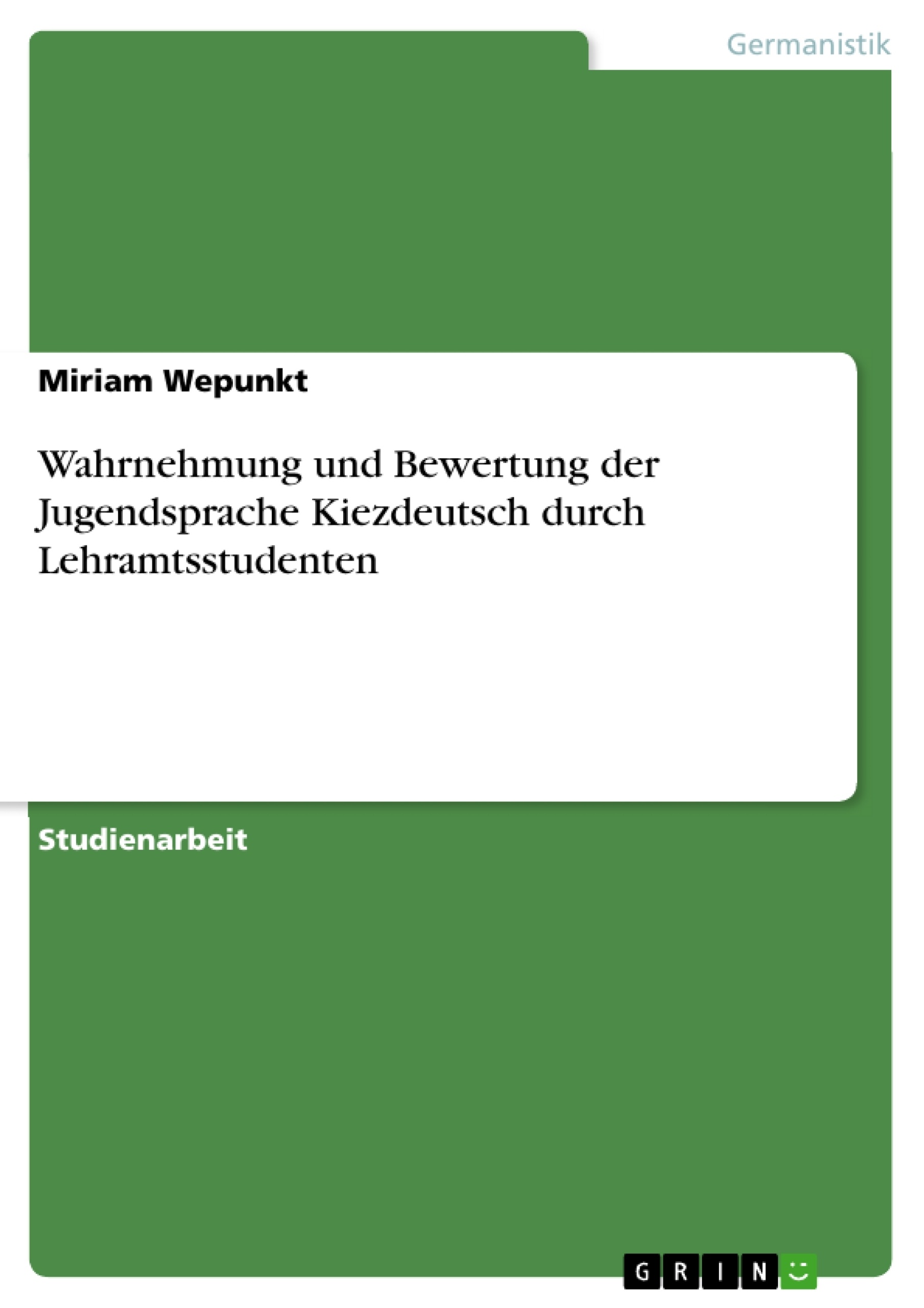Lehrer, die aufgrund ihrer Herkunft oder (erst) ihrer Ausbildung überwiegend daran gewöhnt sind, in gehobener Standardsprache zu kommunizieren und die diese Sprache sowohl als Unterrichtssprache nutzen als auch als Zielsprache für die Unterrichteten anstreben, werden im Kontakt mit Schülern und Eltern mit den unterschiedlichsten Sprachen, Dialekten, Soziolekten und Sprachstilen etc. konfrontiert.
Da jeder Sprecher durch seine Sprachwahl seine Identität wesentlich mit konstruiert und ihm gleichzeitig entsprechend den Konnotationen des Rezipienten durch diesen eine bestimmte Identität zugeschrieben wird, sind Lehrer in ihrem beruflichen Handeln ständig in der Gefahr, im Kontakt mit Kindern, Jugendlichen und Eltern vorurteilsvoll zu begegnen und bei ihrer Leistungsbewertung über subjektive Fehlerquellen zu stolpern.
Die Stigmatisierung durch den Rezipienten, der mit einer bestimmten Sprache bestimmte Eigenschaften verbindet, ohne sich dessen bewusst zu sein, kann sich demnach vor allem im Kontext von Schule nachteilig darauf auswirken, welche Leistungsfähigkeit den Sprechern zugetraut wird. Deshalb müssen sich gerade Lehrer Rechenschaft darüber ablegen, mit welchen Zuschreibungen sie ihre Schüler belegen, wenn sie von diesen mit einem bestimmten Sprachverhalten konfrontiert werden. Im Interesse der pädagogischen Verantwortung des Lehrers und des Rechtes des Schülers auf differenzierte Wahrnehmung ist es deshalb wichtig, dass der Zusammenhang zwischen Sprachverhalten des Schülers und der Einschätzung des Lehrers bei abweichendem Sprachverhalten reflektiert wird.
Ein Aspekt dieses komplexen Problembündels, die Wahrnehmung und Bewertung der Jugendsprache Kiezdeutsch durch angehende Lehrer, soll hier untersucht werden. Im Rahmen des Seminars habe ich gemeinsam mit drei Kommilitonen eine Befragung zum Kiezdeutschen unter Hamburger Lehramtsstudenten durchgeführt, die ich hier hinsichtlich der Frage nach der persönlichen Wahrnehmung und dem erwarteten Einfluss des Kiezdeutschen auf das Hochdeutsch der Sprecher auswerten werde.
Zunächst kläre ich dafür die dieser Arbeit zugrunde gelegten Begrifflichkeiten, den Sprecherkreis des Kiezdeutschen und die Unterschiede des Kiezdeutschen zum Standarddeutschen. Ich umreiße kurz die Hauptdiskussionspunkte der aktuellen Forschung und kläre dann, was unter sprachlichen Varietäten und Dialekten zu verstehen ist, um mich so der Frage nach der Klassifizierung des sprachlichen Phänomens zu nähern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Fragestellung
- 2. Begrifflichkeiten
- 3. Sprecher
- 4. Charakteristika des Kiezdeutschen in Abgrenzung zum Standarddeutschen
- 4.1 Wortschöpfungen und Übernahme von Ausdrücken
- 4.2 Möglichkeiten der Informationsstruktur
- 4.3 Einheitliche grammatikalische Muster
- 4.4 Gebrauch von Flexionen und Funktionswörtern
- 5. Aktueller Forschungsstand
- 6. Linguistische Varietäten und Dialekte
- 7. Erhebung im Rahmen des Seminars
- 7.1 Problematik bei der Bewertung von Sprache durch Laien
- 7.2 Matched Guise Technique
- 7.3 Methodisches Vorgehen
- 7.4 Stichprobe
- 7.5 Auswertung der Ergebnisse allgemein
- 7.6 Auswertung bezüglich des Einflusses des Kiezdeutschen auf das Hochdeutsch der Sprecher
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wahrnehmung und Bewertung der Jugendsprache Kiezdeutsch durch Lehramtsstudenten. Ziel ist es, die subjektiven Einschätzungen und Vorurteile gegenüber dieser Sprachvarietät zu beleuchten und deren potenziellen Einfluss auf die Beurteilung von Schülerleistungen zu analysieren. Die Studie basiert auf einer Erhebung unter Hamburger Lehramtsstudenten.
- Wahrnehmung von Kiezdeutsch durch Lehramtsstudenten
- Vorurteile und Stigmatisierung im Kontext von Schule
- Linguistische Charakteristika des Kiezdeutschen
- Methodische Herausforderungen bei der Erhebung von Sprachbewertungen
- Potenzieller Einfluss von Kiezdeutsch auf Hochdeutsch
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Fragestellung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit: Lehrer begegnen im Schulalltag verschiedenen Sprachvarietäten und müssen ihre eigene Sprachwahrnehmung reflektieren, um Vorurteile zu vermeiden. Die Studie untersucht die Wahrnehmung von Kiezdeutsch durch angehende Lehrer und deren Einschätzung des Einflusses dieser Sprache auf das Hochdeutsch der Sprecher. Die Forschungsfrage wird prägnant formuliert und der methodische Ansatz der Erhebung unter Hamburger Lehramtsstudenten erläutert.
2. Begrifflichkeiten: Dieses Kapitel klärt zentrale Begriffe. Es wird die Entwicklung von Jugendsprachen wie „Kanak Sprak“ und „Kiezdeutsch“ beschrieben, wobei der Fokus auf der Abgrenzung von defizitären Sprachvarianten und der positiven Konnotation des Begriffs „Kiezdeutsch“ liegt. Der Begriff „Kiezdeutsch“ wird im Kontext der Studie definiert und von anderen Jugendsprachen abgegrenzt. Die verschiedenen Konnotationen der Begriffe werden diskutiert, besonders im Hinblick auf die soziale Einordnung der Sprecher.
3. Sprecher: Hier wird das gängige Bild des „typischen Kiezdeutschsprechers“ hinterfragt und korrigiert. Es wird betont, dass Kiezdeutsch von Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft gesprochen wird und vor allem im Freundeskreis Verwendung findet. Das Kapitel verdeutlicht den Gebrauch von Kiezdeutsch als Ausdruck jugendlicher Identität und Emanzipation. Die sprachliche Vielfalt der Sprecher wird hervorgehoben.
4. Charakteristika des Kiezdeutschen in Abgrenzung zum Standarddeutschen: Dieses Kapitel analysiert die sprachlichen Besonderheiten des Kiezdeutschen, die es vom Standarddeutschen unterscheiden. Es beleuchtet die Wortschöpfungen, die spezifische Informationsstruktur, die grammatikalischen Muster und den Gebrauch von Flexionen und Funktionswörtern. Es wird darauf eingegangen, dass viele Bereiche des Kiezdeutschen noch in der Entwicklung begriffen sind und sich stetig weiterentwickeln.
Schlüsselwörter
Kiezdeutsch, Jugendsprache, Sprachwahrnehmung, Vorurteile, Lehramtsstudenten, Sprachbewertung, Standarddeutsch, Linguistische Varietäten, Soziolekt, Migrationshintergrund, Identität, Sprachkontakt, Methodisches Vorgehen, Erhebung, Hochdeutsch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wahrnehmung und Bewertung von Kiezdeutsch durch Lehramtsstudenten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Wahrnehmung und Bewertung der Jugendsprache „Kiezdeutsch“ durch Lehramtsstudenten in Hamburg. Sie beleuchtet subjektive Einschätzungen, Vorurteile und den potenziellen Einfluss dieser Sprachvarietät auf die Beurteilung von Schülerleistungen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Wahrnehmung von Kiezdeutsch, Vorurteile und Stigmatisierung im schulischen Kontext, die linguistischen Charakteristika des Kiezdeutschen, methodische Herausforderungen bei der Erhebung von Sprachbewertungen und den potenziellen Einfluss von Kiezdeutsch auf Hochdeutsch. Die Studie basiert auf einer empirischen Erhebung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung und Fragestellung, Begrifflichkeiten, Sprecher, Charakteristika des Kiezdeutschen im Vergleich zum Standarddeutschen, aktueller Forschungsstand, linguistische Varietäten und Dialekte, die Erhebungsmethode (inkl. Matched Guise Technique), Auswertung und Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die Arbeit zielt darauf ab, die subjektive Wahrnehmung von Kiezdeutsch durch Lehramtsstudenten zu analysieren und zu verstehen, wie diese Wahrnehmung den Umgang mit dieser Sprachvarietät im schulischen Kontext beeinflusst. Es wird untersucht, ob und wie Vorurteile die Beurteilung von Schülerleistungen beeinflussen.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet eine empirische Erhebungsmethode unter Hamburger Lehramtsstudenten. Die „Matched Guise Technique“ wurde eingesetzt, um die Auswirkungen von Sprachvarianten auf die Wahrnehmung zu untersuchen. Die methodischen Herausforderungen bei der Erhebung von Sprachbewertungen durch Laien werden explizit thematisiert.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse (ohne detaillierte Auswertung)?
Die Ergebnisse der Studie werden in den Kapiteln zur Erhebung und Auswertung präsentiert und analysieren den Einfluss der Wahrnehmung von Kiezdeutsch auf die Beurteilung von Schülerleistungen durch Lehramtsstudenten. Der Einfluss von Kiezdeutsch auf das Hochdeutsch der Sprecher wird ebenfalls untersucht. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.
Welche Schlüsselbegriffe werden verwendet?
Schlüsselbegriffe umfassen Kiezdeutsch, Jugendsprache, Sprachwahrnehmung, Vorurteile, Lehramtsstudenten, Sprachbewertung, Standarddeutsch, linguistische Varietäten, Soziolekt, Migrationshintergrund, Identität, Sprachkontakt, methodisches Vorgehen, Erhebung und Hochdeutsch.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Zielgruppe dieser Arbeit sind primär Lehramtsstudenten, Lehrende und Sprachwissenschaftler, die sich mit Jugendsprache, Sprachvarietäten und deren Wahrnehmung im Bildungskontext auseinandersetzen. Sie ist für alle relevant, die an der Thematik von Vorurteilen im Kontext von Sprache und Bildung interessiert sind.
Wie wird Kiezdeutsch in dieser Arbeit definiert?
Der Begriff "Kiezdeutsch" wird im Kontext der Studie präzise definiert und von anderen Jugendsprachen abgegrenzt. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Konnotationen des Begriffs und seine soziale Einordnung der Sprecher.
Wie wird der "typische Kiezdeutschsprecher" dargestellt?
Die Arbeit hinterfragt und korrigiert das gängige Bild des "typischen Kiezdeutschsprechers". Es wird betont, dass Kiezdeutsch von Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft gesprochen wird und vor allem im Freundeskreis Verwendung findet. Der Gebrauch von Kiezdeutsch als Ausdruck jugendlicher Identität und Emanzipation wird hervorgehoben.
- Quote paper
- Miriam Wepunkt (Author), 2015, Wahrnehmung und Bewertung der Jugendsprache Kiezdeutsch durch Lehramtsstudenten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319722