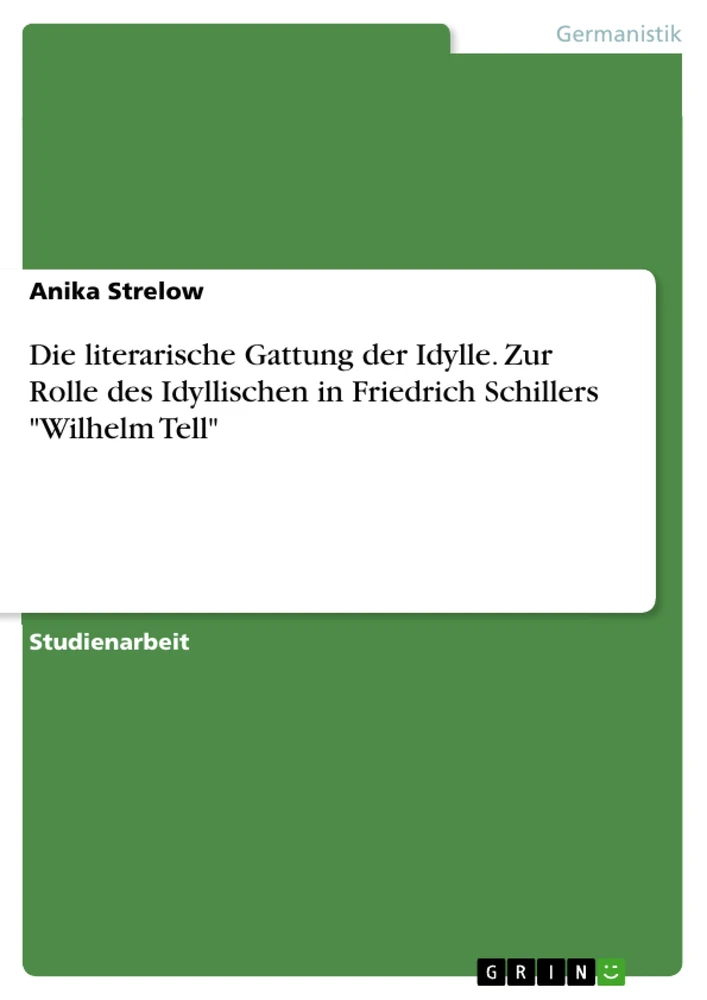Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den idyllischen Elementen in Schillers "Wilhelm Tell". Bevor mithilfe einer ausführlichen Inhaltsanalyse die idyllischen Elemente des Dramas untersucht und die Rolle des Idyllischen für die Gesamtinterpretation des Dramas herausgearbeitet werden, soll der Begriff Idylle definiert und auf Probleme bei der Gattungsabgrenzung aufmerksam gemacht werden. Den Abschluss dieser Arbeit bildet ein zusammenfassendes Fazit.
1793 ordnete das französische Nationalkonvent an, die Tragödie des „Wilhelm Tell und andere Stücke, die die ruhmvollen Ereignisse der [französischen] Revolution und die Tugenden der Verteidiger der Freiheit darstellen“, dreimal wöchentlich auf den Pariser Bühnen aufführen zu lassen. Straßen, Plätze und Ortschaften wurden während der Revolutionsjahre nach Wilhelm Tell benannt. Auch 1798 noch stürmten die französischen Revolutionäre mit Parolen wie „Vive Guillaume Tell! Vive les descendants de Guillaume Tell!“ über die Schweizer Grenze und gründeten die bis 1803 bestehende Helvetische Republik.
Diese und viele weitere Beispiele zeigen auf, dass der Tell-Mythos, der seit dem 15. Jahrhundert bis über die deutschsprachigen Grenzen hinaus eine ungeheure Popularität erfährt, zu einer zentralen Identifikationsfigur verschiedener konservativer und patriotischer Kreise geworden ist und gerne als Analogie zur Französischen Revolution gesetzt wird. Auch der Dichter Friedrich Schiller griff die Legende um Wilhelm Tell und den Befreiungskampf der Schweizer Eidgenossenschaft wieder auf und verfasste in seiner späten Schaffensphase das gleichnamige Bühnenwerk "Wilhelm Tell", welches 1804 am Weimarer Hoftheater uraufgeführt wurde.
Schillers Dramatisierung verkörpert hingegen weniger die Verherrlichung der Französischen Revolution mit der nachfolgenden Jakobiner-Herrschaft, sondern verbindet vielmehr die Vorstellung einer friedlichen Revolution gegen die Tyrannei. Mit seinem Drama "Wilhelm Tell" schuf er ein „politisch-ästhetisches Gegenmodell“ (Borchmeyer 1982, S. 70), das seine Idealvorstellungen von einem ästhetischen und moralischen Staat widerspiegelt. Gleichsam integrierte Schiller in seine Idee von einer „ursprünglich-harmonischen Naturgesellschaft“ (Kaiser 1971, S. 109) die Konzeption der Idylle – einer Gattung, welche im 18. Jahrhundert grundlegende semantische und literarische Erweiterungen erfuhr.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärung Idyll(e) im literaturgeschichtlichen Überblick
- Wege zur Idylle: Die triadische Disposition nach Schiller
- Zur Darstellung des Idyllischen in „Wilhelm Tell“
- Locus amoenus und die Natur des Vaterlandes
- Trauer um die vergangene Idylle
- Idylle als Gemeinschaftsgedanke und menschliches Freiheitsstreben
- Verkörperung der Idylle durch den Protagonisten Wilhelm Tell
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die idyllischen Elemente in Schillers „Wilhelm Tell“ und deren Bedeutung für die Gesamtinterpretation des Dramas. Zunächst wird der Begriff „Idylle“ im literaturgeschichtlichen Kontext definiert und die Problematik der Gattungsabgrenzung beleuchtet. Anschließend wird anhand einer Inhaltsanalyse die Darstellung des Idyllischen im Drama analysiert.
- Definition und historische Entwicklung des Begriffs „Idylle“
- Die Rolle des „Locus Amoenus“ und der Natur in „Wilhelm Tell“
- Die Gegenüberstellung von idealisierter Idylle und der Realität der Unterdrückung
- Idylle als Ausdruck von Gemeinschaftsgefühl und Freiheitsstreben
- Wilhelm Tell als Verkörperung der idyllischen Ideale
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den historischen Kontext von Schillers „Wilhelm Tell“ heraus, indem sie dessen Rezeption während der Französischen Revolution und die Verwendung des Tell-Mythos als Identifikationsfigur für verschiedene politische Gruppen beleuchtet. Sie betont, dass Schillers Drama im Gegensatz zur Verherrlichung der Revolution ein Gegenmodell einer friedlichen Revolution gegen Tyrannei darstellt und die Idee einer „ursprünglich-harmonischen Naturgesellschaft“ mit der Konzeption der Idylle verbindet. Die Arbeit kündigt die bevorstehende Analyse der idyllischen Elemente in „Wilhelm Tell“ an.
Begriffserklärung Idyll(e) im literaturgeschichtlichen Überblick: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Idylle“ und verfolgt dessen Entwicklung von der griechischen Antike bis ins 18. Jahrhundert. Es beschreibt die semantische Entwicklung des Begriffs, von der ursprünglichen Bedeutung als epische und dramatische Dichtform bis hin zur Verwendung als Motiv in verschiedenen Gattungen. Der Fokus liegt auf der Darstellung des ländlichen Lebens, der Harmonie zwischen Mensch und Natur, und dem Topos des „locus amoenus“. Wichtige Vertreter der Idyllendichtung wie Salomon Gessner und Johann Heinrich Voß werden erwähnt, um die thematischen Erweiterungen und die Verbindung mit gesellschaftskritischen Aspekten zu beleuchten.
Wege zur Idylle: Die triadische Disposition nach Schiller: [Anmerkung: Da der Text keine explizite Erläuterung dieses Kapitels enthält, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.]
Zur Darstellung des Idyllischen in „Wilhelm Tell“: Dieses Kapitel, bestehend aus mehreren Unterkapiteln, untersucht die idyllischen Elemente in Schillers Drama. Es analysiert verschiedene Aspekte, wie die Darstellung der Natur, die Sehnsucht nach einer vergangenen Idylle, die Verbindung zwischen Idylle und Gemeinschaftsgedanken sowie die Rolle Tells als Verkörperung idyllischer Ideale. Eine detaillierte Analyse der einzelnen Unterkapitel fehlt im vorliegenden Textausschnitt.
Schlüsselwörter
Idylle, Wilhelm Tell, Schiller, Locus Amoenus, Natur, Harmonisches Gesellschaftsmodell, Freiheitsstreben, Französische Revolution, Patriotismus, Idealvorstellungen.
Häufig gestellte Fragen zu: Idyllische Elemente in Schillers "Wilhelm Tell"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert die idyllischen Elemente in Friedrich Schillers Drama "Wilhelm Tell" und deren Bedeutung für die Gesamtinterpretation des Stücks. Die Arbeit untersucht, wie die Idylle in dem Drama dargestellt wird und welche Rolle sie für die Charaktere und die Handlung spielt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Definition und historische Entwicklung des Begriffs "Idylle", die Rolle des "Locus Amoenus" und der Natur in "Wilhelm Tell", den Gegensatz zwischen idealisierter Idylle und der Realität der Unterdrückung, die Idylle als Ausdruck von Gemeinschaftsgefühl und Freiheitsstreben, sowie Wilhelm Tell als Verkörperung idyllischer Ideale. Die Arbeit beleuchtet außerdem den historischen Kontext von Schillers Drama im Hinblick auf die Französische Revolution und die Verwendung des Tell-Mythos als Identifikationsfigur für verschiedene politische Gruppen.
Wie wird der Begriff "Idylle" in der Arbeit definiert?
Die Arbeit definiert den Begriff "Idylle" und verfolgt dessen Entwicklung von der griechischen Antike bis ins 18. Jahrhundert. Sie beschreibt die semantische Entwicklung des Begriffs und konzentriert sich auf die Darstellung des ländlichen Lebens, die Harmonie zwischen Mensch und Natur, und den Topos des "locus amoenus". Wichtige Vertreter der Idyllendichtung werden erwähnt, um die thematischen Erweiterungen und die Verbindung mit gesellschaftskritischen Aspekten zu beleuchten.
Welche Rolle spielt der "Locus Amoenus" in "Wilhelm Tell"?
Die Arbeit untersucht die Rolle des "Locus Amoenus" (idealisierter Ort) und der Natur in "Wilhelm Tell" im Kontext der idyllischen Elemente. Die Analyse beleuchtet, wie die Natur im Drama dargestellt wird und welche Bedeutung sie für die Charaktere und die Handlung hat.
Wie wird die Gegenüberstellung von idealisierter Idylle und Realität dargestellt?
Die Arbeit analysiert den Gegensatz zwischen der idealisierten Idylle und der Realität der Unterdrückung im Drama. Sie untersucht, wie Schiller diese Gegenüberstellung inszeniert und welche Bedeutung sie für die Gesamtinterpretation des Stücks hat.
Welche Bedeutung hat die Idylle im Hinblick auf Gemeinschaftsgefühl und Freiheitsstreben?
Die Arbeit untersucht die Idylle als Ausdruck von Gemeinschaftsgefühl und Freiheitsstreben in "Wilhelm Tell". Sie analysiert, wie die idyllischen Elemente mit dem Kampf gegen die Unterdrückung und dem Streben nach Freiheit verbunden sind.
Welche Rolle spielt Wilhelm Tell als Verkörperung idyllischer Ideale?
Die Arbeit untersucht die Rolle Wilhelm Tells als Verkörperung idyllischer Ideale. Sie analysiert, inwieweit Tell als Figur die idyllischen Vorstellungen repräsentiert und wie seine Handlungen mit diesen Idealen zusammenhängen.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Begriffserklärung von "Idylle", ein Kapitel zu Schillers "triadischer Disposition" (deren Inhalt im vorliegenden Textfragment leider nicht erläutert wird), ein Kapitel zur Darstellung des Idyllischen in "Wilhelm Tell" (mit Unterkapiteln zu "Locus amoenus", Trauer um vergangene Idylle, Idylle als Gemeinschaftsgedanke und Freiheitsstreben, sowie Tell als Verkörperung der Idylle) und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die Schlüsselwörter der Arbeit sind: Idylle, Wilhelm Tell, Schiller, Locus Amoenus, Natur, Harmonisches Gesellschaftsmodell, Freiheitsstreben, Französische Revolution, Patriotismus und Idealvorstellungen.
- Quote paper
- Anika Strelow (Author), 2015, Die literarische Gattung der Idylle. Zur Rolle des Idyllischen in Friedrich Schillers "Wilhelm Tell", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319591