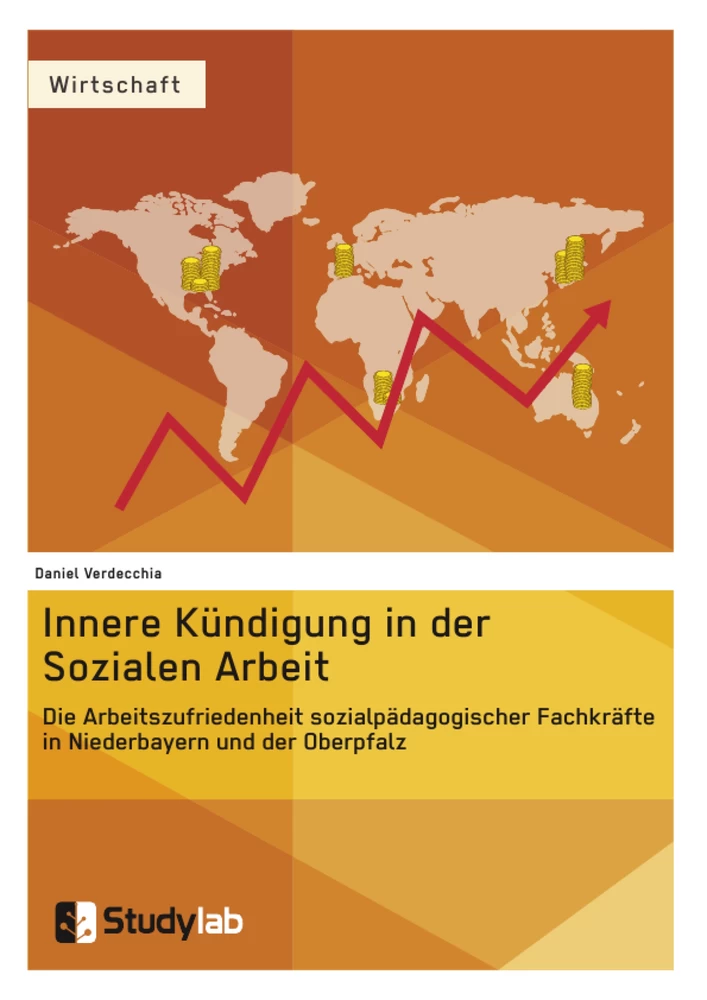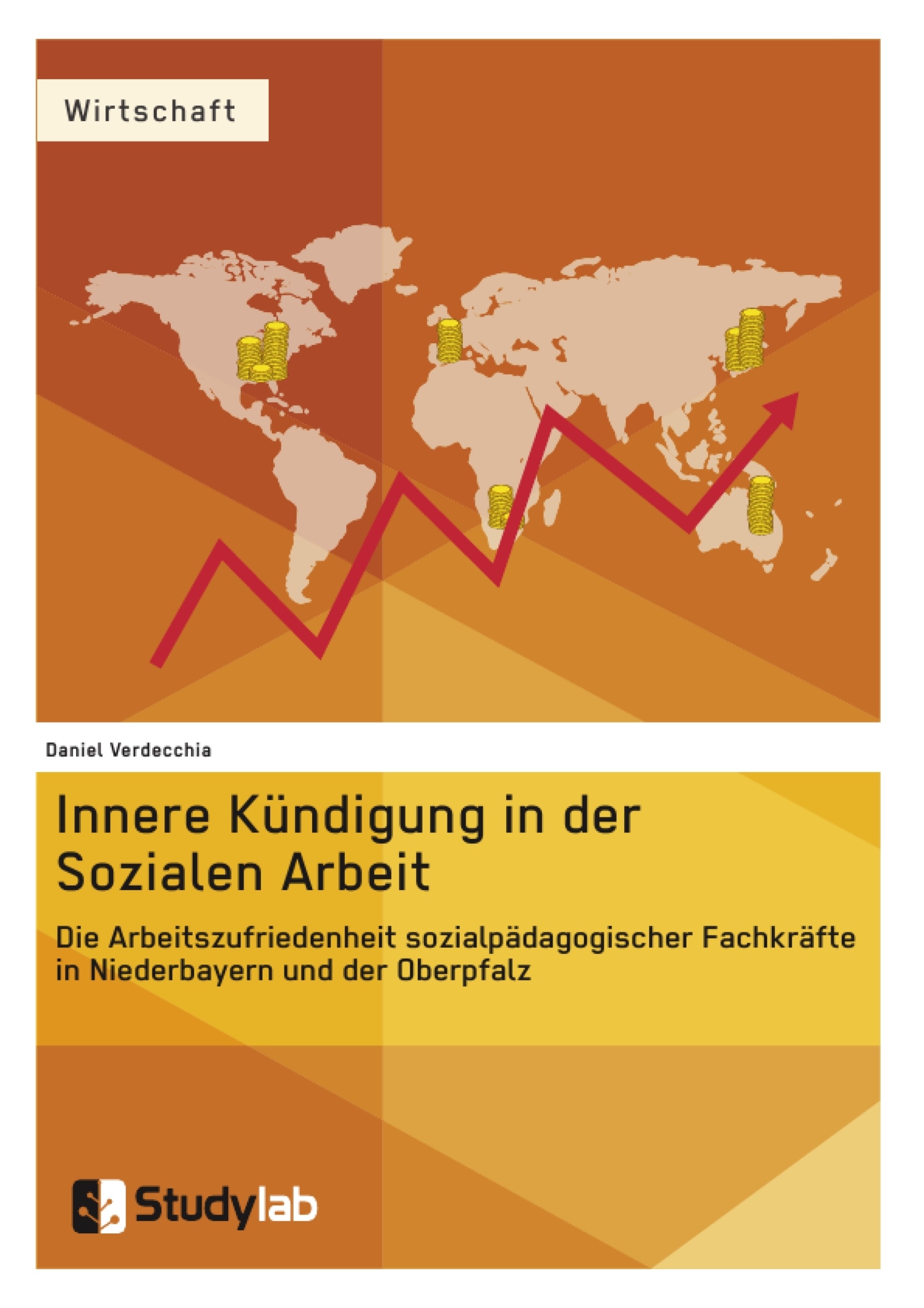Laut dem aktuellen Gallup Engagement Index macht über die Hälfte der Deutschen nur Dienst nach Vorschrift. Jeder sechste hat dabei bereits innerlich gekündigt. Nicht nur für die sozialen Berufe sind diese Zahlen alarmierend: Denn das Fehlen von Engagement verursacht hohe wirtschaftliche Kosten. Es kann sich aber auch negativ auf die sozialpädagogische Arbeit mit den Klienten auswirken.
Daniel Verdecchia geht der Frage nach, wie sich die Innere Kündigung in der Sozialen Arbeit darstellt. Welche Gründe gibt es für sozialpädagogische Fachkräfte innerlich zu kündigen. Wie schätzen die Betroffenen ihr Arbeitsumfeld ein, wie zufrieden sind sie mit ihren Vorgesetzten und wie viel Selbstbestimmung im Beruf erwarten sie – auch im Vergleich zu Mitarbeitern, die glücklich im Job sind.
Aus dem Inhalt:
- Arbeitszufriedenheit, Arbeitsmotivation
- Berufliche Realitäten
- Der psychologische Vertrag
- Involvement und Commitment
- Empirische Forschung, Zufriedenheitsforschung
- Rahmenmodell nach Faller, Prozessmodell nach Krenuz-Maes, Bruggemann-Modell, Job-Characteristics-Modell
Das Phänomen der Inneren Kündigung wird seit Anfang der 1980er Jahre in Deutschland vermehrt diskutiert und auch zunehmend empirisch erforscht. Hierbei stellt die Innere Kündigung, wie der Name schon sagt, eine Kündigung im Inneren eines Menschen dar. Dieser kündigt nicht seinen Arbeitsvertrag, sondern will seinen Arbeitsplatz behalten, reduziert jedoch sein Engagement und seine Leistungsbereitschaft und macht nur noch Dienst nach Vorschrift.
Mit dieser Arbeit wird versucht, das Phänomen der Inneren Kündigung durch den Fokus auf die Profession der Sozialen Arbeit zu beleuchten und somit den Wissensstand über die Erscheinung in der Realität zu erweitern. Konkret wird untersucht, wie sich die Innere Kündigung in der Profession der Sozialen Arbeit zeigt. Denn es gibt bisher noch keine Untersuchung, die Aufschluss darüber gibt, welches Ausmaß die Innere Emigration in diesem Berufsfeld annimmt. Ganz konkret soll die Frage beantwortet werden, in welchem Ausmaß die Innere Kündigung bei den sozialpädagogischen Fachkräften auftritt. Weiterhin soll erforscht werden, wie der berufliche Alltag von den sozialpädagogischen Fachkräften wahrgenommen wird. Dabei interessiert vor allem, inwiefern Innere Emigranten ihre Tätigkeit einschätzen und welche Unterschiede sich im Vergleich zu Fachkräften, die sich nicht im Zustand der Inneren Kündigung befinden, zeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1. Einleitung
- 2. Innere Kündigung
- 2.1 Definition
- 2.2 Erklärungsansätze
- 2.2.1 Psychologischer Arbeitsvertrag
- 2.2.2 Rahmenmodell nach Faller
- 2.2.3 Prozessmodell nach Krenz-Maes
- 2.2.4 Involvement und Commitment
- 2.2.5 Zusammenfassung
- 2.3 Empirische Forschung
- 2.3.1 Messinstrumente
- 2.3.2 Aktueller Forschungsstand
- 3. Arbeitszufriedenheit
- 3.1 Theorien und Modelle
- 3.1.1 Bruggemann-Modell
- 3.1.2 Job-Characteristics-Modell
- 3.2 Zusammenfassung
- 3.1 Theorien und Modelle
- 4. Soziale Arbeit
- 4.1 Berufsmotivation und Erwartungen vor dem Studium
- 4.2 Berufliche Realität in der Sozialen Arbeit
- 4.3 Zufriedenheitsforschung
- 4.4 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Inneren Kündigung bei sozialpädagogischen Fachkräften in Niederbayern und der Oberpfalz. Die Studie zielt darauf ab, das Ausmaß der Inneren Kündigung zu ermitteln und die subjektive Bewertung der beruflichen Tätigkeit der Betroffenen zu analysieren. Die Ergebnisse sollen Aufschluss über die Faktoren geben, die zur Inneren Kündigung beitragen.
- Definition und Erklärungsmodelle der Inneren Kündigung
- Zusammenhang zwischen Innerer Kündigung und Arbeitszufriedenheit
- Spezifische Aspekte der Inneren Kündigung in der Sozialen Arbeit
- Empirische Untersuchung der Inneren Kündigung bei sozialpädagogischen Fachkräften
- Analyse der Einflussfaktoren auf die Arbeitszufriedenheit in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Inneren Kündigung in der Sozialen Arbeit ein und legt die Forschungsfrage sowie die Methodik der Untersuchung dar. Es skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zentralen Forschungsfragen, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen. Die Einleitung dient als Orientierungshilfe für den Leser und bietet einen Überblick über den Inhalt der folgenden Kapitel.
2. Innere Kündigung: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit dem Konstrukt der Inneren Kündigung. Es definiert den Begriff, präsentiert verschiedene Erklärungsansätze wie den psychologischen Arbeitsvertrag, das Rahmenmodell nach Faller und das Prozessmodell nach Krenz-Maes, und diskutiert die Konzepte Involvement und Commitment im Kontext der Inneren Kündigung. Der Kapitel schliesst mit einer Übersicht über den aktuellen Forschungsstand ab, einschließlich der verwendeten Messinstrumente. Die verschiedenen theoretischen Perspektiven werden miteinander verglichen und kritisch bewertet, um ein umfassendes Verständnis des Phänomens zu ermöglichen.
3. Arbeitszufriedenheit: Dieses Kapitel widmet sich dem Konstrukt der Arbeitszufriedenheit. Es werden verschiedene Theorien und Modelle vorgestellt, darunter das Bruggemann-Modell und das Job-Characteristics-Modell. Die Kapitel analysiert die verschiedenen Faktoren, die zur Arbeitszufriedenheit beitragen oder diese beeinträchtigen, und diskutiert deren Bedeutung im Kontext der Inneren Kündigung. Die verschiedenen Theorien und Modelle werden kritisch hinterfragt und im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit auf die vorliegende Fragestellung bewertet. Der Fokus liegt dabei auf dem Verständnis der Zusammenhänge zwischen Arbeitszufriedenheit und der Entstehung von Innerer Kündigung.
4. Soziale Arbeit: Dieses Kapitel untersucht die spezifischen Herausforderungen und Arbeitsbedingungen in der Sozialen Arbeit, die zur Inneren Kündigung beitragen können. Es beleuchtet die berufliche Motivation und Erwartungen von Sozialpädagogen vor dem Studium und vergleicht diese mit der beruflichen Realität. Der Abschnitt befasst sich ausführlich mit der Zufriedenheitsforschung im Bereich der Sozialen Arbeit und integriert die Ergebnisse in den Gesamtkontext der Inneren Kündigung. Hier werden die spezifischen Bedingungen der Sozialen Arbeit, wie z.B. hoher Arbeitsdruck, emotionale Belastung und geringe Anerkennung, in Bezug zu den vorgestellten Theorien gesetzt.
Schlüsselwörter
Innere Kündigung, Arbeitszufriedenheit, Soziale Arbeit, Sozialpädagogische Fachkräfte, Niederbayern, Oberpfalz, Empirische Forschung, Psychologischer Arbeitsvertrag, Berufsmotivation, Arbeitsbedingungen, Anerkennung, Wertschätzung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Innere Kündigung bei sozialpädagogischen Fachkräften
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Inneren Kündigung bei sozialpädagogischen Fachkräften in Niederbayern und der Oberpfalz. Sie zielt darauf ab, das Ausmaß der Inneren Kündigung zu ermitteln und die subjektive Bewertung der beruflichen Tätigkeit der Betroffenen zu analysieren. Die Ergebnisse sollen Aufschluss über die Faktoren geben, die zur Inneren Kündigung beitragen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Studie behandelt folgende Schwerpunkte: Definition und Erklärungsmodelle der Inneren Kündigung, den Zusammenhang zwischen Innerer Kündigung und Arbeitszufriedenheit, spezifische Aspekte der Inneren Kündigung in der Sozialen Arbeit, eine empirische Untersuchung der Inneren Kündigung bei sozialpädagogischen Fachkräften und die Analyse der Einflussfaktoren auf die Arbeitszufriedenheit in der Sozialen Arbeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Thematik, Forschungsfrage, Methodik und Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 (Innere Kündigung): Definition, Erklärungsansätze (psychologischer Arbeitsvertrag, Modelle nach Faller und Krenz-Maes), Involvement, Commitment und aktueller Forschungsstand. Kapitel 3 (Arbeitszufriedenheit): Theorien und Modelle (Bruggemann-Modell, Job-Characteristics-Modell) und deren Bedeutung im Kontext der Inneren Kündigung. Kapitel 4 (Soziale Arbeit): Berufsmotivation und -realität in der Sozialen Arbeit, Zufriedenheitsforschung und spezifische Herausforderungen in diesem Bereich.
Welche Erklärungsansätze zur Inneren Kündigung werden vorgestellt?
Die Studie präsentiert verschiedene Erklärungsansätze, darunter den psychologischen Arbeitsvertrag, das Rahmenmodell nach Faller und das Prozessmodell nach Krenz-Maes. Zusätzlich werden die Konzepte Involvement und Commitment im Kontext der Inneren Kündigung diskutiert.
Welche Theorien und Modelle zur Arbeitszufriedenheit werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Bruggemann-Modell und das Job-Characteristics-Modell der Arbeitszufriedenheit und analysiert deren Relevanz für das Verständnis der Inneren Kündigung.
Welche spezifischen Aspekte der Inneren Kündigung in der Sozialen Arbeit werden betrachtet?
Die Studie beleuchtet die berufliche Motivation und Erwartungen vor dem Studium im Vergleich zur beruflichen Realität in der Sozialen Arbeit, die Zufriedenheitsforschung in diesem Bereich und die spezifischen Arbeitsbedingungen (z.B. hoher Arbeitsdruck, emotionale Belastung, geringe Anerkennung), die zur Inneren Kündigung beitragen können.
Welche Methodik wird in der Studie angewendet?
Die Einleitung erwähnt die Methodik der Untersuchung, jedoch werden die Details der Methodik nicht im vorliegenden Inhaltsverzeichnis aufgeführt. Weitere Informationen hierzu müssen aus dem vollständigen Text entnommen werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie am besten?
Schlüsselwörter sind: Innere Kündigung, Arbeitszufriedenheit, Soziale Arbeit, Sozialpädagogische Fachkräfte, Niederbayern, Oberpfalz, Empirische Forschung, Psychologischer Arbeitsvertrag, Berufsmotivation, Arbeitsbedingungen, Anerkennung, Wertschätzung.
- Citation du texte
- Daniel Verdecchia (Auteur), 2012, Innere Kündigung in der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319571