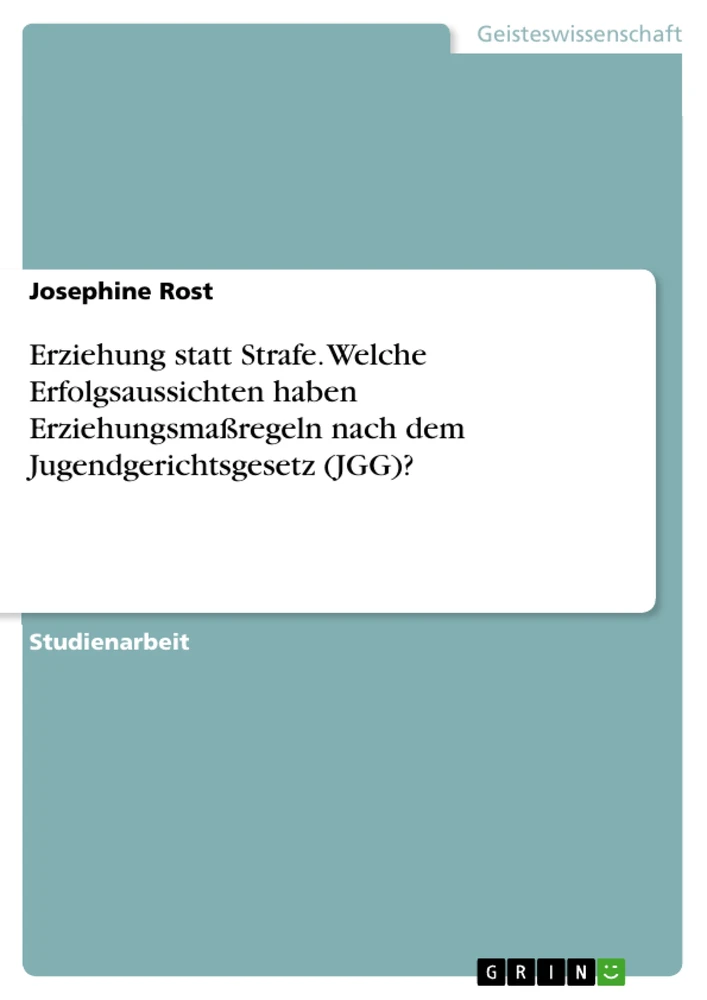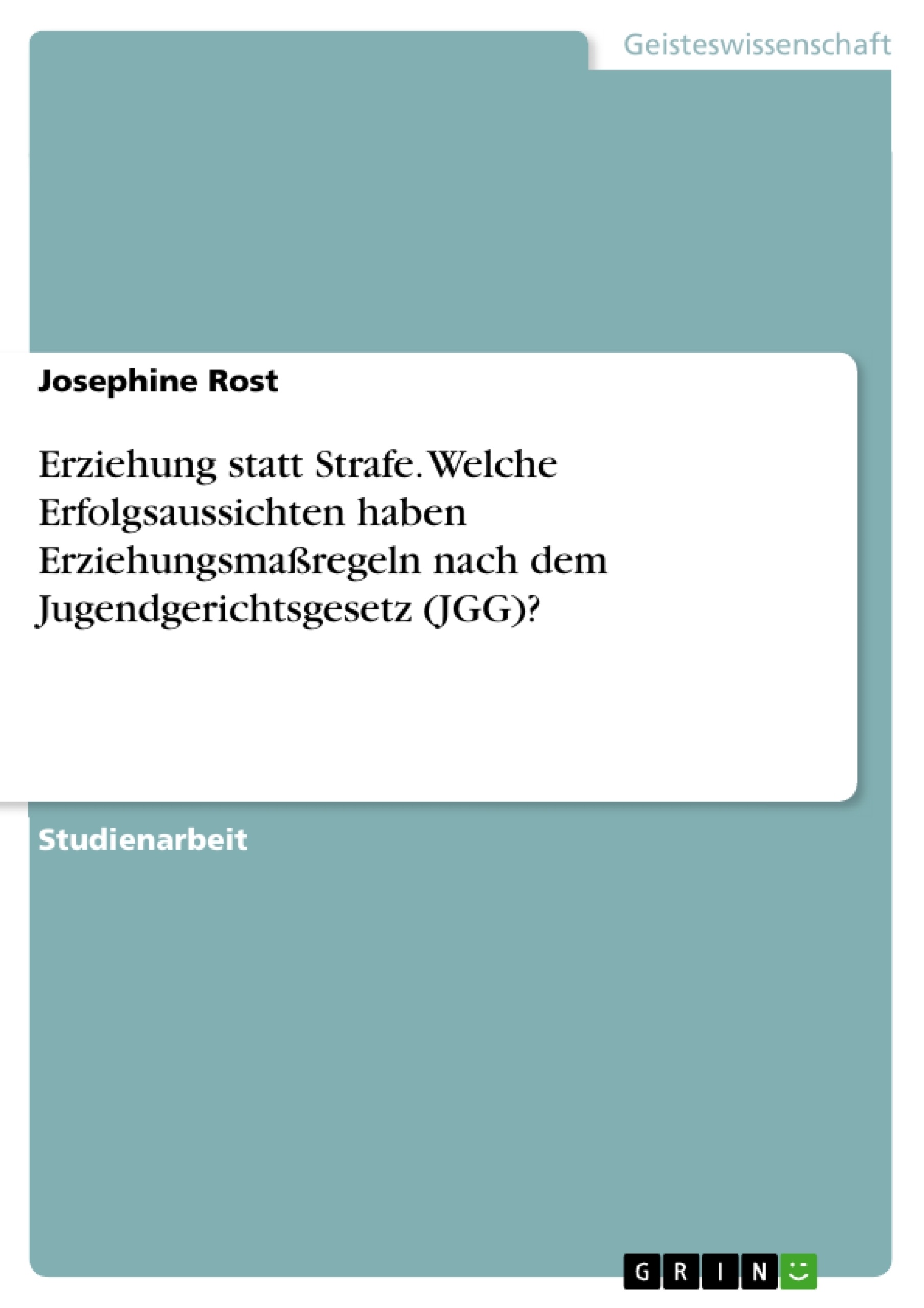Lange Zeit war man sich des Unterschiedes von Kindern und Erwachsenen in Bezug auf das Strafrecht nicht klar. Kinder wurden strafrechtlich als kleine Erwachsene angesehen. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde man sich darüber bewusst, dass die Phase der Kindheit und Jugend die Betroffenen vor besondere Herausforderungen und Nöte stellt. Als sich die Akzeptanz für die Phase des Hineinwachsens in die Gesellschaft bildete, schien es nicht mehr zeitgemäß Verhaltensauffälligkeiten einfach nur strafrechtlich zu behandeln.
Aus diesem Grund wurde der Gedanke der Erziehung im Recht aufgegriffen. Zunächst wurde im Jahr 1922 das Jugendwohlfahrtsgesetz verabschiedet. Es enthielt das Recht auf Erziehung für die Jugendlichen. Durch diese Erziehung sollten sie gesellschaftstauglich werden. Ein Jahr später, 1923, wurde das Jugendgerichtsgesetz erlassen. Es enthielt Regelungen für die Strafe und die Erziehungsmaßregeln. Bei der nationalsozialistischen Gesetzesreform in 1943 wurden als weitere Sanktion, neben Strafe und Erziehungsmaßnahmen, die Zuchtmittel eingeführt, die auch nach der Neufassung des Gesetzes im Jahr 1953 ihre Gültigkeit behielten.
In dieser Arbeit soll der Fragestellung nachgegangen werden, welche Erfolgsaussichten die erzieherischen Maßnahmen aufweisen. Dafür werden zunächst die Anwendungsbereiche sowie die allgemeinen Rechtsfolgen des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) aufgezeigt. Im Anschluss daran soll detailliert auf die Erziehungsmaßregeln eingegangen werden. Im weiteren Verlauf sollen dann die Rückfallquoten nach der Verhängung von Erziehungsmaßregeln aufgezeigt werden. Anschließend sollen die Daten exemplarisch mit den Rückfallquoten nach der Jugendstrafe ohne Bewährung verglichen und Gründe für die eventuellen Abweichungen gefunden werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Jugendgerichtsgesetz (JGG)
- Anwendungsbereich
- Rechtsfolgen
- Erziehungsmaßregeln
- Definition / Zweck
- Arten
- Weisungen
- Weisungen nach § 10 Abs. 1 JGG
- Weisungen nach § 10 Abs. 2 JGG
- Hilfen zur Erziehung
- Rückfallquoten
- Rückfallquoten der Erziehungsmaßregeln
- Rückfallquoten im Vergleich
- Gründe für die Unterschiede
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erfolgsaussichten erzieherischer Maßnahmen im Jugendgerichtsgesetz (JGG). Sie analysiert den Anwendungsbereich und die Rechtsfolgen des JGG, beschreibt detailliert die verschiedenen Erziehungsmaßregeln und vergleicht deren Rückfallquoten mit denen von Jugendstrafen ohne Bewährung. Ziel ist es, die Unterschiede zu beleuchten und mögliche Gründe dafür zu identifizieren.
- Anwendungsbereich des JGG und Unterscheidung zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden
- Arten und Zweck von Erziehungsmaßregeln nach dem JGG
- Analyse der Rückfallquoten nach Erziehungsmaßregeln
- Vergleich der Rückfallquoten von Erziehungsmaßregeln und Jugendstrafen
- Identifizierung möglicher Gründe für Unterschiede in den Rückfallquoten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert die historische Entwicklung des Jugendstrafrechts, vom Verständnis von Kindern als kleinen Erwachsenen bis zur Akzeptanz des Erziehungsgedankens. Sie hebt die Bedeutung des Jugendwohlfahrtsgesetzes (1922) und des Jugendgerichtsgesetzes (1923) hervor und führt in die zentrale Fragestellung der Arbeit ein: die Untersuchung der Erfolgsaussichten erzieherischer Maßnahmen im JGG. Die Arbeit kündigt die methodische Vorgehensweise an: Analyse des Anwendungsbereichs und der Rechtsfolgen des JGG, detaillierte Betrachtung der Erziehungsmaßregeln, Aufzeigen der Rückfallquoten und Vergleich mit Jugendstrafen ohne Bewährung.
2. Das Jugendgerichtsgesetz (JGG): Dieses Kapitel beschreibt den Anwendungsbereich des JGG, der Jugendliche und Heranwachsende umfasst, die eine nach dem StGB strafbare Handlung begangen haben. Es definiert die Altersgruppen und erläutert die Voraussetzungen für die strafrechtliche Verantwortlichkeit, insbesondere die Berücksichtigung der sittlichen und geistigen Reife. Für Heranwachsende wird die Anwendung des JGG von der Gesamtwürdigung ihrer Persönlichkeit abhängig gemacht. Das Kapitel legt dar, dass Kinder unter 14 Jahren schuldunfähig sind. Schließlich werden die Rechtsfolgen des JGG vorgestellt: Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel und Strafen.
3. Erziehungsmaßregeln: Dieses Kapitel beschreibt die Erziehungsmaßregeln als zentrale Rechtsfolge des JGG. Es definiert deren Zweck und erläutert verschiedene Arten von Erziehungsmaßregeln, unterteilt in Weisungen (nach § 10 Abs. 1 und § 10 Abs. 2 JGG) und Hilfen zur Erziehung. Die Ausführungen beleuchten die verschiedenen Formen und Zielsetzungen dieser Maßnahmen im Detail, und die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie der Gesetzgeber versucht, durch erzieherische Maßnahmen eine positive Entwicklung des Jugendlichen zu fördern und Rückfälle zu verhindern.
4. Rückfallquoten: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert empirische Daten zu Rückfallquoten nach Verhängung von Erziehungsmaßregeln. Es vergleicht diese Daten mit Rückfallquoten nach Jugendstrafen ohne Bewährung und sucht nach Gründen für mögliche Unterschiede. Die Analyse fokussiert auf die Faktoren, die zu unterschiedlichen Erfolgsraten bei den verschiedenen Sanktionsformen beitragen könnten. Die Interpretation der Daten spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der Effektivität von Erziehungsmaßregeln im Vergleich zu strafrechtlichen Sanktionen. Das Kapitel könnte beispielsweise die Bedeutung von individuellen Faktoren, den Umfang der Unterstützung und die Qualität der Betreuungsprogramme beleuchten.
Schlüsselwörter
Jugendgerichtsgesetz (JGG), Erziehungsmaßregeln, Jugendstrafrecht, Rückfallquoten, Hilfen zur Erziehung, Weisungen, Jugendlicher, Heranwachsender, Schuldunfähigkeit, sittliche und geistige Reife.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Jugendgerichtsgesetz (JGG) und Erziehungsmaßregeln
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Jugendgerichtsgesetz (JGG) und die darin vorgesehenen Erziehungsmaßregeln. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der behandelten Themen, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der Erfolgsaussichten erzieherischer Maßnahmen im Vergleich zu Jugendstrafen und der Identifizierung möglicher Gründe für Unterschiede in den Rückfallquoten.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: den Anwendungsbereich des JGG (Jugendliche und Heranwachsende), die Arten und Zwecke von Erziehungsmaßregeln (Weisungen, Hilfen zur Erziehung), die Analyse der Rückfallquoten nach Erziehungsmaßregeln im Vergleich zu Jugendstrafen ohne Bewährung, die Identifizierung möglicher Gründe für Unterschiede in den Rückfallquoten und die Unterscheidung zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden im Kontext des JGG.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in verschiedene Kapitel unterteilt: Einleitung, Das Jugendgerichtsgesetz (JGG), Erziehungsmaßregeln, Rückfallquoten und Fazit. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst und die wichtigsten Punkte werden hervorgehoben. Zusätzlich findet sich ein Inhaltsverzeichnis und eine Liste der Schlüsselwörter.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse der Rückfallquoten?
Das Dokument präsentiert und analysiert empirische Daten zu Rückfallquoten nach Erziehungsmaßregeln und vergleicht diese mit den Rückfallquoten nach Jugendstrafen ohne Bewährung. Die genauen Ergebnisse der Analyse der Rückfallquoten sind im Dokument selbst detailliert dargestellt, jedoch wird auf mögliche Einflussfaktoren wie individuelle Faktoren, Umfang der Unterstützung und Qualität der Betreuungsprogramme hingewiesen. Der Vergleich dient der Bewertung der Effektivität von Erziehungsmaßregeln im Vergleich zu strafrechtlichen Sanktionen.
Welche Arten von Erziehungsmaßregeln werden im JGG beschrieben?
Das Dokument beschreibt Erziehungsmaßregeln als zentrale Rechtsfolge des JGG. Es unterscheidet zwischen Weisungen (nach § 10 Abs. 1 und § 10 Abs. 2 JGG) und Hilfen zur Erziehung. Die verschiedenen Formen und Zielsetzungen dieser Maßnahmen werden detailliert erläutert.
Wer ist nach dem JGG strafrechtlich verantwortlich?
Das JGG gilt für Jugendliche und Heranwachsende, die eine nach dem StGB strafbare Handlung begangen haben. Kinder unter 14 Jahren sind schuldunfähig. Für Heranwachsende hängt die Anwendung des JGG von der Gesamtwürdigung ihrer Persönlichkeit ab. Das Dokument erläutert die Voraussetzungen für die strafrechtliche Verantwortlichkeit, insbesondere die Berücksichtigung der sittlichen und geistigen Reife.
Welche Rechtsfolgen sieht das JGG vor?
Das JGG sieht als Rechtsfolgen Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel und Strafen vor. Das Dokument konzentriert sich vor allem auf die Erziehungsmaßregeln und deren Vergleich mit Jugendstrafen ohne Bewährung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Jugendgerichtsgesetz (JGG), Erziehungsmaßregeln, Jugendstrafrecht, Rückfallquoten, Hilfen zur Erziehung, Weisungen, Jugendlicher, Heranwachsender, Schuldunfähigkeit, sittliche und geistige Reife.
- Quote paper
- Josephine Rost (Author), 2009, Erziehung statt Strafe. Welche Erfolgsaussichten haben Erziehungsmaßregeln nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319509