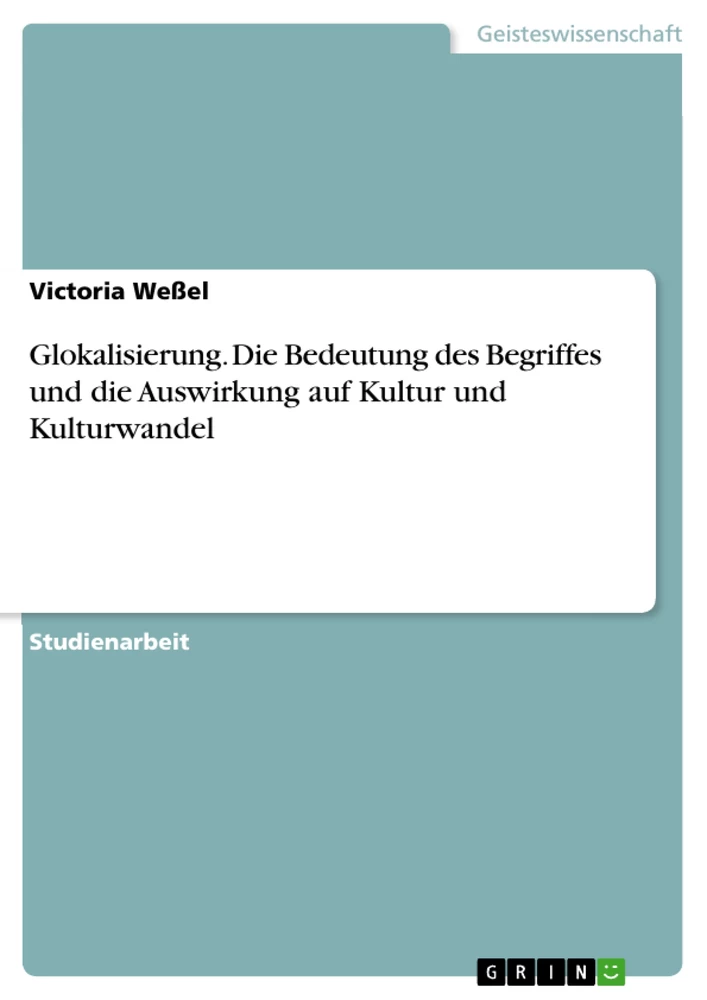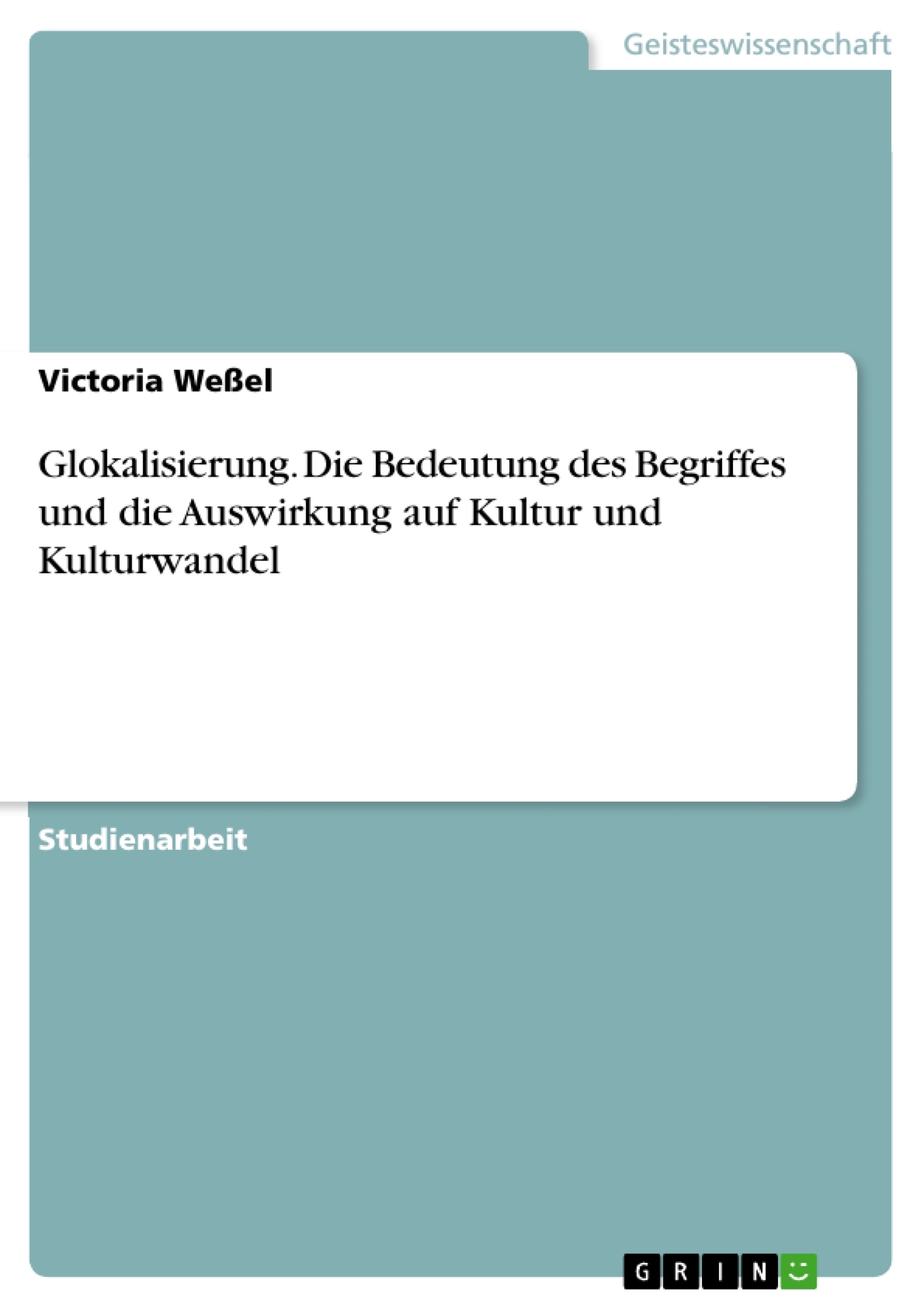Ziel dieser Arbeit ist, den Begriff 'Glokalisierung' genau zu definieren und die Thesen von Roland Robertson zu erläutern. Weiter wird sich der Frage zugewendet, auf welche Idee von Kultur und Kulturwandel das Konzept der Glokalisierung reagiert und spezifisch auch auf die Identitätsbildung durch die Globalisierung. Am Schluss möchte ich noch aufzeigen, wie wichtig das Zusammenspiel von Lokalem und Globalem ist und den Begriff Glokalisierung damit etablieren.
Geprägt wurde der Begriff von Roland Robertson mit seinem Werk „Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity“, auf welches im zweiten Kapitel eingegangen wird. Wie auf den ersten Blick sichtbar ist, besteht der Begriff aus der Verknüpfung von Global und Lokal. Die Globalisierung ist heutzutage in aller Munde, es scheint als ob jeder Mensch und jedes Unternehmen anstrebt immer globaler zu werden. Man strebt die Entgrenzung an und spricht von Global Player, Global Sourcing, Global Marketing und vielem mehr. Doch je umfassender und dynamischer die Globalisierung vorankommt, desto spürbarer werden die lokalen Probleme. Die Lokalität weicht also nicht einer Globalität, sondern geht einher damit. Aus Ethnologischer Sicht wird daher von einer Glokalisierung gesprochen und damit der Homogenisierung der Welt widersprochen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Glokalisierung
- Grundlegende Definition
- Glokalisierung in der Ethnologie
- Prägung des Begriffes Glokalisierung
- Roland Robertson
- Reaktion des Konzeptes Glokalisierung auf Kultur und Kulturwandel
- Schlussbetrachtung
- „Glokalisierung“ - ein Zukunftsmodell?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, den Begriff „Glokalisierung“ präzise zu definieren und die Thesen von Roland Robertson zu erläutern. Sie untersucht, wie das Konzept der Glokalisierung Kultur und Kulturwandel beeinflusst und insbesondere die Identitätsbildung im Kontext der Globalisierung prägt. Abschließend wird die Bedeutung des Zusammenspiels von lokalen und globalen Faktoren hervorgehoben, um den Begriff der Glokalisierung zu etablieren.
- Definition und Entstehung des Begriffs „Glokalisierung“
- Die Rolle der Glokalisierung in der Ethnologie
- Der Einfluss der Glokalisierung auf Kultur und Kulturwandel
- Identitätsbildung im Kontext der Globalisierung
- Das Zusammenspiel von lokalen und globalen Faktoren
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Glokalisierung ein und benennt Roland Robertson als prägenden Denker des Begriffs. Sie hebt den scheinbaren Widerspruch zwischen der angestrebten Globalisierung und den weiterhin bestehenden lokalen Problemen hervor, wodurch die Notwendigkeit des Begriffs Glokalisierung als Synthese von globalen und lokalen Prozessen begründet wird. Die Arbeit skizziert ihre Zielsetzung: eine genaue Definition des Begriffs, die Erläuterung von Robertsons Thesen und die Untersuchung des Einflusses der Glokalisierung auf Kultur, Kulturwandel und Identitätsbildung.
Definition des Begriffes Glokalisierung: Dieses Kapitel definiert „Glokalisierung“ als die Verbindung von Globalisierung und Lokalisierung. Es erklärt die jeweilige Bedeutung beider Begriffe und zeigt, wie die Globalisierung, oft mit wirtschaftlichen und neoliberalen Aspekten verbunden, lokale Auswirkungen hat. Die japanische Wortschöpfung „dochakuka“ wird als Inspirationsquelle genannt. Der Fokus liegt darauf, dass globale Prozesse immer auch regionale und lokale Dimensionen haben, und die Glokalisierung somit das lokale Resultat multinationaler Globalisierung darstellt.
Glokalisierung in der Ethnologie: Dieses Kapitel beschreibt die Veränderung des Gegenstandes der Ethnologie durch die Globalisierung. Die Entstehung transnationaler sozialer Räume erfordert von Ethnologen die Auseinandersetzung mit der Einbindung ihrer Untersuchungsgruppen in globale Prozesse. Der Fokus verlagert sich von isolierten Einheiten hin zur Betrachtung von Ethnien im Kontext eines kapitalistischen Weltsystems. Die Forschung beschäftigt sich verstärkt mit der Differenzierung und Vereinigung globaler und lokaler Elemente, wobei das Lokale nicht verschwindet, sondern eine neue Beziehung zum Globalen eingeht.
Prägung des Begriffes Glokalisierung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Roland Robertson und sein Werk. Es wird dargelegt, dass Robertson den Begriff geprägt hat, um die gängige Vorstellung einer Spannung zwischen Globalisierung und Lokalisierung zu überwinden und stattdessen die immer schon bestehende Verbindung von Globalem und Lokalem hervorzuheben. Robertsons akademischer Werdegang und seine vielseitigen Forschungsschwerpunkte werden kurz erwähnt.
Schlüsselwörter
Glokalisierung, Globalisierung, Lokalisierung, Kulturwandel, Identitätsbildung, Roland Robertson, Ethnologie, Transnationalität, Lokale Auswirkungen, Global Player.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Glokalisierung - Eine Analyse
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit dem Begriff "Glokalisierung", seiner Definition, Entstehung und seinem Einfluss auf Kultur und Kulturwandel. Ein besonderer Fokus liegt auf den Thesen von Roland Robertson und der Bedeutung des Konzepts für die Identitätsbildung in Zeiten der Globalisierung.
Wer ist der zentrale Denker im Zusammenhang mit Glokalisierung?
Roland Robertson wird als prägender Denker des Begriffs "Glokalisierung" hervorgehoben. Die Arbeit erläutert seine Thesen und seinen Beitrag zum Verständnis des Zusammenspiels von globalen und lokalen Prozessen.
Wie wird Glokalisierung definiert?
Glokalisierung wird als die Verbindung von Globalisierung und Lokalisierung definiert. Es wird betont, dass globale Prozesse immer auch regionale und lokale Dimensionen haben und die Glokalisierung das lokale Resultat multinationaler Globalisierung darstellt. Der japanische Begriff "dochakuka" wird als Inspirationsquelle erwähnt.
Welche Rolle spielt die Ethnologie im Kontext der Glokalisierung?
Die Arbeit beschreibt, wie die Globalisierung den Gegenstand der Ethnologie verändert hat. Ethnologen müssen sich mit der Einbindung ihrer Untersuchungsgruppen in globale Prozesse auseinandersetzen. Der Fokus verlagert sich von isolierten Einheiten hin zur Betrachtung von Ethnien im Kontext eines kapitalistischen Weltsystems.
Wie beeinflusst die Glokalisierung Kultur und Kulturwandel?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Glokalisierung auf Kultur und Kulturwandel, insbesondere auf die Identitätsbildung. Es wird gezeigt, wie globale Prozesse lokale Kulturen beeinflussen und gleichzeitig von diesen beeinflusst werden. Das Zusammenspiel von lokalen und globalen Faktoren spielt dabei eine zentrale Rolle.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zur Definition von Glokalisierung, zur Rolle der Glokalisierung in der Ethnologie, zur Prägung des Begriffs durch Roland Robertson, sowie eine Schlussbetrachtung, welche die Frage nach Glokalisierung als Zukunftsmodell aufwirft.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Verständnis der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Glokalisierung, Globalisierung, Lokalisierung, Kulturwandel, Identitätsbildung, Roland Robertson, Ethnologie, Transnationalität, Lokale Auswirkungen, Global Player.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Begriff "Glokalisierung" präzise zu definieren, die Thesen von Roland Robertson zu erläutern und den Einfluss des Konzepts auf Kultur, Kulturwandel und Identitätsbildung zu untersuchen. Sie hebt die Bedeutung des Zusammenspiels von lokalen und globalen Faktoren hervor.
Welche Zusammenfassung der einzelnen Kapitel wird gegeben?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die jeweils die wichtigsten Punkte des jeweiligen Kapitels zusammenfassen und den roten Faden der Argumentation verdeutlichen.
Ist Glokalisierung ein Zukunftsmodell?
Die Schlussbetrachtung der Arbeit wirft die Frage auf, ob "Glokalisierung" ein Zukunftsmodell darstellt, ohne jedoch eine definitive Antwort zu liefern.
- Quote paper
- Victoria Weßel (Author), 2013, Glokalisierung. Die Bedeutung des Begriffes und die Auswirkung auf Kultur und Kulturwandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319284