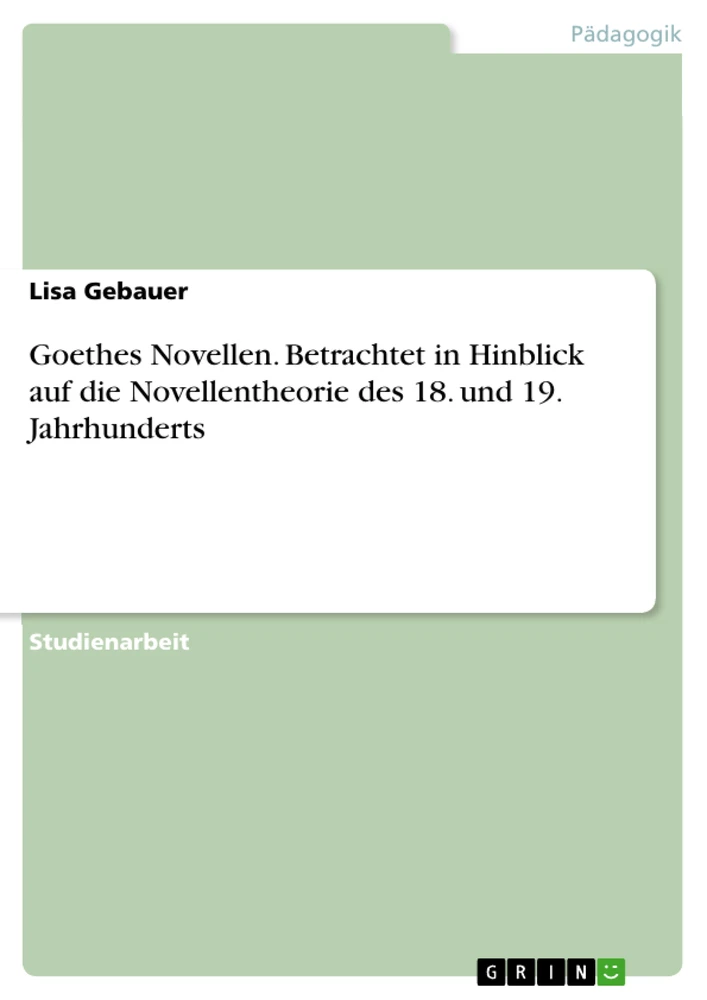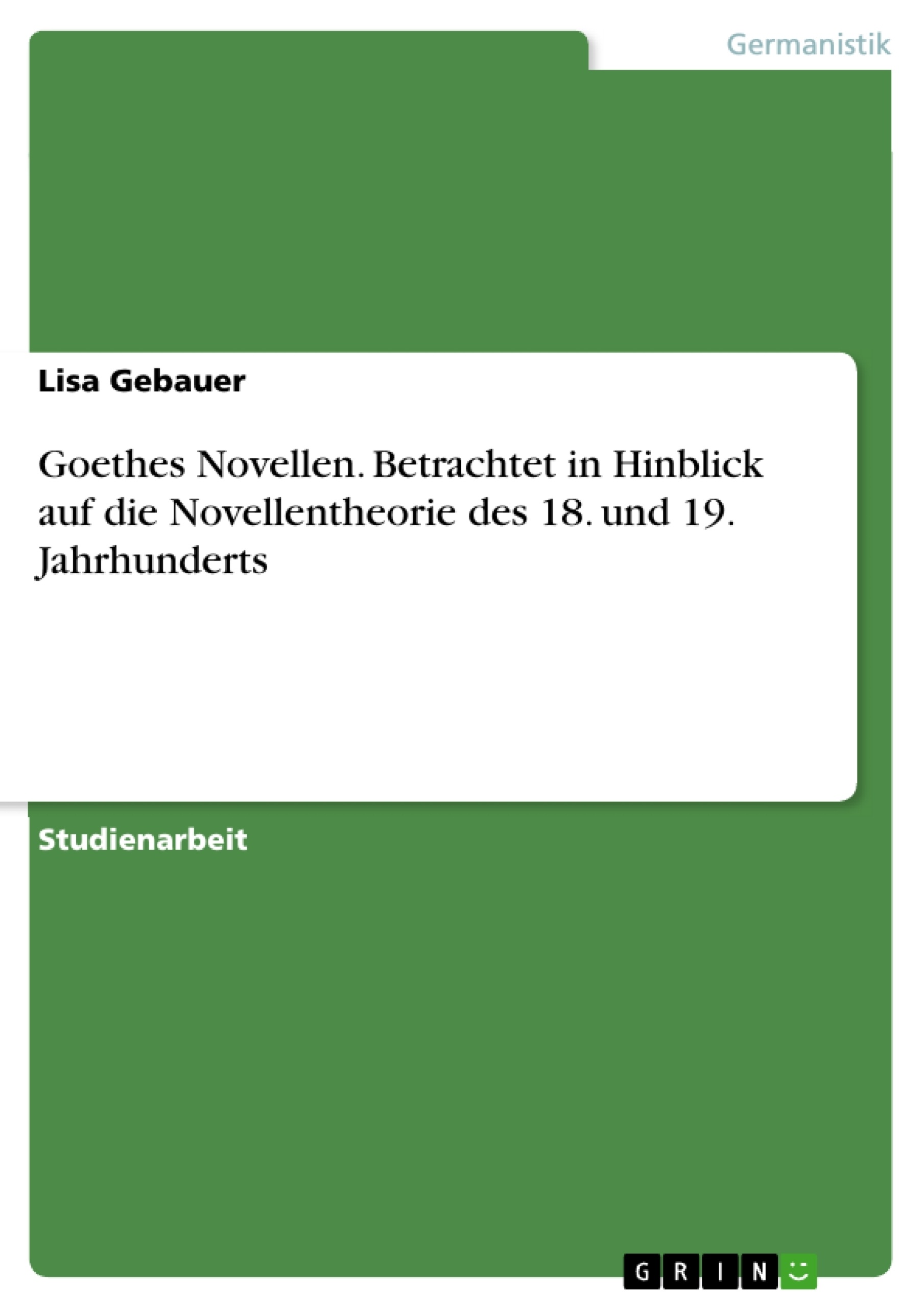Johann Wolfgang von Goethe, der wohl bekannteste deutsche Dichter unserer Zeit, definierte die literarische Gattung Novelle am 29. Jänner 1827. Gleichzeitig hatte er damit den Titel für seine Erzählung in Prosaform gefunden.
Doch ob die deutsche Novelle nun tatsächlich mit Goethe beginnt, ist gar nicht so leicht zu sagen. Um diese Frage zu beantworten, sollte man sich von gattungsgeschichtlichen Aspekten lösen und überlegen, ob man die ästhetisch-moralischen Forderungen von Goethe für die literarische Rezeption als verbindlich ansehen sollte oder nicht. Um diese Entscheidung treffen zu können, muss man also auch andere Meinungen zu den differenzierten Aspekten, die eine Novelle als solche beschreiben, betrachten.
Literaten wie Christoph Martin Wieland, welcher von einer „Simplizität des Plans“ spricht, und August Wilhelm Schlegel, der die Gattung definiert, indem er nach „merkwürdigen Begebenheiten“ sucht, sind nur ein kleines Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Auffassung der Merkmale dieser Gattung sind. Doch auch die Betrachtung einer bekannten und etwas jüngeren Definition, die von Paul Heyse, darf in einer Arbeit wie dieser nicht fehlen.
Welche Kriterien muss ein Text aufweisen, damit man ihn als Novelle bezeichnen kann? Und warum bezeichnen moderne Literaten ältere Werke als Novelle? In der vorliegenden Arbeit möchte ich mich hauptsächlich mit Goethes Novellen beschäftigen und seine eigene, die seiner Zeitgenossen und auch modernere Definitionen anhand ausgewählter Texte näher betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Giovanni Boccaccio
- Deutsche Novellendefinitionen
- Wieland, Schlegel, Schiller, Goethe
- Heyse
- Goethes Novellen
- Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten
- Die Wahlverwandtschaften
- Die Novelle
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung der deutschen Novelle, insbesondere im Kontext von Goethes Novellen. Sie analysiert die Gattung anhand verschiedener Definitionen und beleuchtet die zentralen Merkmale, die eine Novelle ausmachen. Dabei wird die Rezeption des Dekameron von Giovanni Boccaccio durch deutsche Dichter und Denker des 18. und 19. Jahrhunderts untersucht. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der deutschen Novellentheorie zu entwickeln und den Einfluss von Goethes Werk auf die Entwicklung der Gattung aufzuzeigen.
- Die Entstehung und Entwicklung der deutschen Novelle
- Die Rezeption des Dekameron von Giovanni Boccaccio in Deutschland
- Die Definitionen und Merkmale der Novelle
- Goethes Novellen und ihre Bedeutung für die Gattung
- Die literarische Tradition der Novelle im Kontext des 18. und 19. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung präsentiert Goethes Definition der Novelle und stellt die Frage nach dem Ursprung der Gattung in Deutschland. Sie führt den Leser in die Thematik ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit.
- Giovanni Boccaccio: Dieses Kapitel widmet sich dem Dekameron von Giovanni Boccaccio als Vorbild für spätere Novellensammlungen. Es analysiert die Bedeutung des Werkes für die Entwicklung der Novelle und beleuchtet die zentrale Rolle der Falkennovelle im Kontext der Novellentheorie.
- Deutsche Novellendefinitionen: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Definitionen der Novelle, insbesondere die von Wieland, Schlegel, Schiller und Goethe. Es analysiert die formalen und inhaltlichen Merkmale, die diese Autoren für charakteristisch für die Gattung halten.
- Goethes Novellen: Dieses Kapitel widmet sich Goethes Novellen, insbesondere "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten", "Die Wahlverwandtschaften" und "Die Novelle". Es analysiert die literarischen Besonderheiten der Werke und untersucht den Einfluss von Goethes Definition der Novelle auf die Gattung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen und Konzepten der Novellentheorie, darunter die Definition der Novelle, ihre Merkmale und Gattungsmerkmale, die Rezeption von Giovanni Boccaccios Dekameron in Deutschland, die Werke von Goethe und ihre Bedeutung für die Entwicklung der deutschen Novelle sowie der Einfluss von Goethes Definition auf die Gattung. Die Arbeit analysiert und untersucht die literarischen Traditionen und Strömungen des 18. und 19. Jahrhunderts, die die Entstehung und Entwicklung der deutschen Novelle prägten.
- Quote paper
- Lisa Gebauer (Author), 2014, Goethes Novellen. Betrachtet in Hinblick auf die Novellentheorie des 18. und 19. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319143