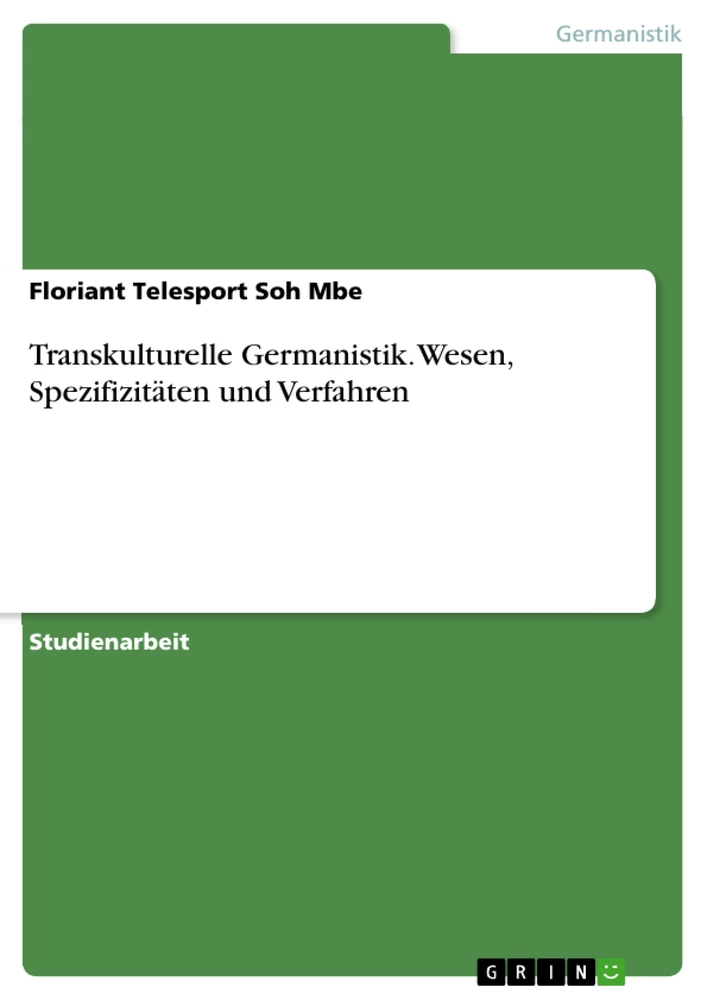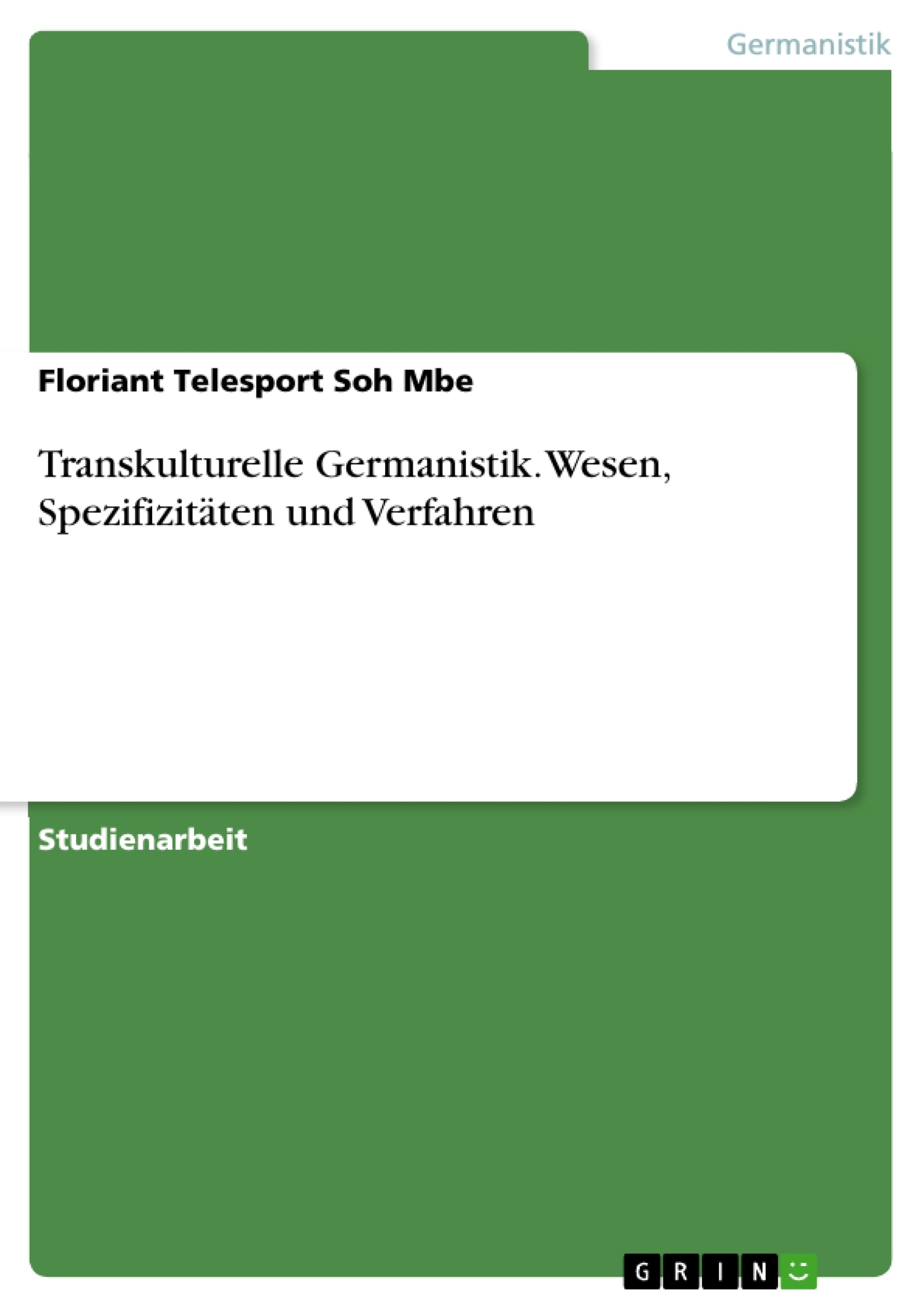Dieser Vortrag bietet hilfreiche Informationen über das an, was "transkulturelle Germanistik'' ist. Er versucht, sie dabei zu definieren und deren Wesen und Spezifizitäten hervorzuheben. Er zeigt auch den Paradigmenwechsel von der Interkulturellen zur Transkulturellen Germanistik. Von der Relativierung von Konzepten wie Kultur, Nation, Identität usw.im Zeitalter der Globalisierung ist es zudem die Rede hier. Von den Verfahren und Problemen der Inlands- und Auslandsgermamistik handelt es sich noch hierbei.
Die Geschichte der Germanistik zeigt, dass sie bis im 19.Jahrhundert eine Nationalphilologie war. Erst in den 1970er und 1980er Jahren erkannt sie einen Paradigmawechsel mit der Interkulturalität, die eine Antwort auf kulturgeschichtliche Beziehungen im Zeitalter der Globalisierung ist. Ab diesem Moment spricht man von ‚interkultureller Germanistik‘, die sich laut A. Wierlacher als eine kulturkontrastive Wissenschaft versteht. Sie ist Manuel Maldonado Aleman nach eine „auslandsbezogene Wissenschaft‘‘,d.h. eine Wissenschaft, die über die Grenzen einer Nationalphilologie ausgeht, um sich mit Texten verschiedener Kulturen zu befassen. So befasst sich die Germanistik mit eigen- und fremdkulturellen Praxen, Prozessen, die in Werken reflektiert werden. Dabei betrachtet sie die Kultur als ein Ganzes, das einem Volk eigen angehört.
Ausgehend von dem perpetuellen Austausch zwischen Völkern mit dem Zustandekommen von Formen wie Hybridität und Migrationsliteratur, in der eine gemischte Kultur reflektiert wird, meint Manuel daraufhin, dass die herkömmliche interkulturelle Germanistik nicht mehr der heutigen Lage gerecht wird. Er fordert eine transkulturelle Fundierung der Germanistik, die ihm zufolge der heutigen Lage anpasse. Was zeichnet die heutige Welt aus? Warum erscheint die herkömmliche interkulturelle Germanistik lückenhaft? Was ist Transkulturalität? Wie sieht eine transkulturelle Fundierung der Germanistik aus? Womit beschäftigt sie sich? Diesen Fragen gehe ich im Folgenden nach.
Der Autor dieser Arbeit ist kein deutscher Muttersprachler. Wir bitten daher um Ihr Verständnis für eventuelle Fehler und Unstimmigkeiten in Ausdruck und Grammatik.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- 1. Begriffe Nation, Kultur, Identität, Gesellschaft im Zeitalter der Globalisierung
- Interkulturelle Germanistik
- 2.1. Bestimmung und methodisches Verfahren
- 2.2. Schwächen oder Lücken der interkulturellen Germanistik in Ära der Globalisierung
- 3. Zur transkulturellen Fundierung der Germanistik
- 3.1. Interkulturalität, Multikulturalität und Transkulturalität: Unterschied
- 3.2. Transkulturalität: Ursprung und Bestimmung
- 3.4. Zur transkulturellen Ausrichtung der Germanistik: Forschungsobjekt und Verfahren
- 3.5. Inlands- und Auslandsgermanistik im Zeichen der transkulturellen Fundierung der Germanistik
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Der Text befasst sich mit der Entwicklung der Germanistik im Kontext der Globalisierung und setzt sich mit den Begriffen Nation, Kultur, Identität und Gesellschaft im Zeitalter der Globalisierung auseinander. Er beleuchtet die Grenzen der interkulturellen Germanistik und plädiert für eine transkulturelle Fundierung, die den komplexen und dynamischen Charakter der heutigen Welt besser widerspiegeln soll.
- Der Wandel der Begriffe Nation, Kultur, Identität und Gesellschaft im Zeitalter der Globalisierung
- Kritik an der interkulturellen Germanistik als „auslandsbezogene Wissenschaft“
- Die transkulturelle Fundierung der Germanistik: Ein neuer Ansatz für die Erforschung kultureller Prozesse
- Hybridität, Mehrsprachigkeit und kulturelle Diversität als prägende Merkmale der Gegenwart
- Die Relevanz einer transkulturellen Perspektive für die Analyse literarischer Werke
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der transkulturellen Fundierung der Germanistik ein und stellt die Problematik der traditionellen interkulturellen Germanistik im Kontext der Globalisierung dar. Sie stellt zentrale Fragen zum Wandel der Begriffe Nation, Kultur, Identität und Gesellschaft und zu den Herausforderungen, die sich aus der zunehmenden Globalisierung und Diversität für die Germanistik ergeben.
- 1. Begriffe Nation, Kultur, Identität, Gesellschaft im Zeitalter der Globalisierung: Dieses Kapitel untersucht die Veränderungen der Konzepte Nation, Kultur, Identität und Gesellschaft im Zuge der Globalisierung. Die technologische Entwicklung und der Prozess der Internationalisierung haben zu einer Auflösung der traditionellen räumlichen und kulturellen Grenzen geführt. Die Kapitel analysiert die Enträumlichung dieser Konzepte und die Herausforderungen, die sich aus der zunehmenden Hybridität und Diversität der Gesellschaften ergeben.
- 2. Interkulturelle Germanistik: Dieses Kapitel befasst sich mit der interkulturellen Germanistik und untersucht ihre Bedeutung für die Analyse von literarischen Texten im Kontext der Globalisierung. Es thematisiert die Grenzen der traditionellen interkulturellen Germanistik, die von einem statischen und homogenen Kulturverständnis geprägt ist. Das Kapitel stellt die Problematik der klaren Abgrenzung von Kulturen und die Komplexität der interkulturellen Kommunikation in den Vordergrund.
- 2.1. Bestimmung und methodisches Verfahren: Dieses Unterkapitel definiert die interkulturelle Germanistik als „auslandsbezogene Wissenschaft“ und erläutert ihre methodischen Verfahren. Es betont die Bedeutung des interkulturellen Dialogs und die Notwendigkeit, literarische Texte in ihren kulturellen Kontexten zu betrachten.
- 2.2. Schwächen oder Lücken der interkulturellen Germanistik in Ära der Globalisierung: Dieser Abschnitt analysiert die Schwächen und Lücken der interkulturellen Germanistik im Kontext der Globalisierung. Die Kritik zielt auf die statische und homogene Sichtweise von Kultur und die Vernachlässigung der multikulturellen und hybriden Realität in der heutigen Welt. Das Kapitel stellt fest, dass die interkulturelle Germanistik die komplexen und dynamischen Prozesse der Globalisierung nicht ausreichend berücksichtigt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe des Textes sind: Globalisierung, Nation, Kultur, Identität, Gesellschaft, Interkulturelle Germanistik, Transkulturelle Fundierung, Hybridität, Multikulturalität, Diversität, Enträumlichung, De-Plazierung, Deterritorialisierung, Mehrebeneidentität, Kulturverständnis, interkultureller Dialog, Kulturbegegnungen, Kulturtransfer, Kulturinterne Brüche, Zwischenwelten.
- Arbeit zitieren
- Floriant Telesport Soh Mbe (Autor:in), 2015, Transkulturelle Germanistik. Wesen, Spezifizitäten und Verfahren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318916