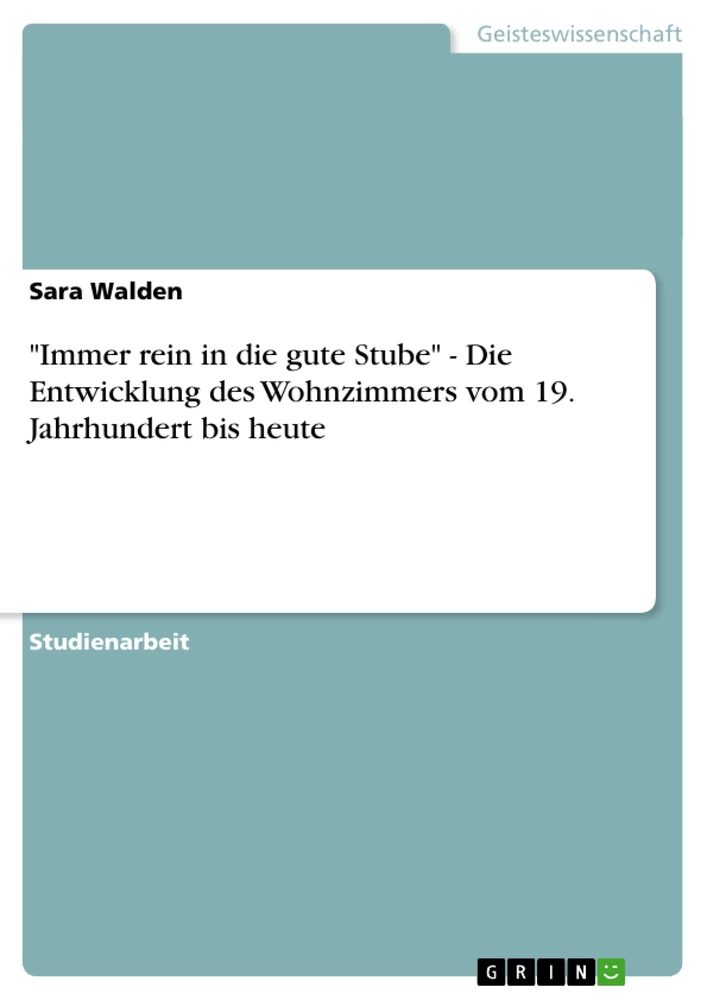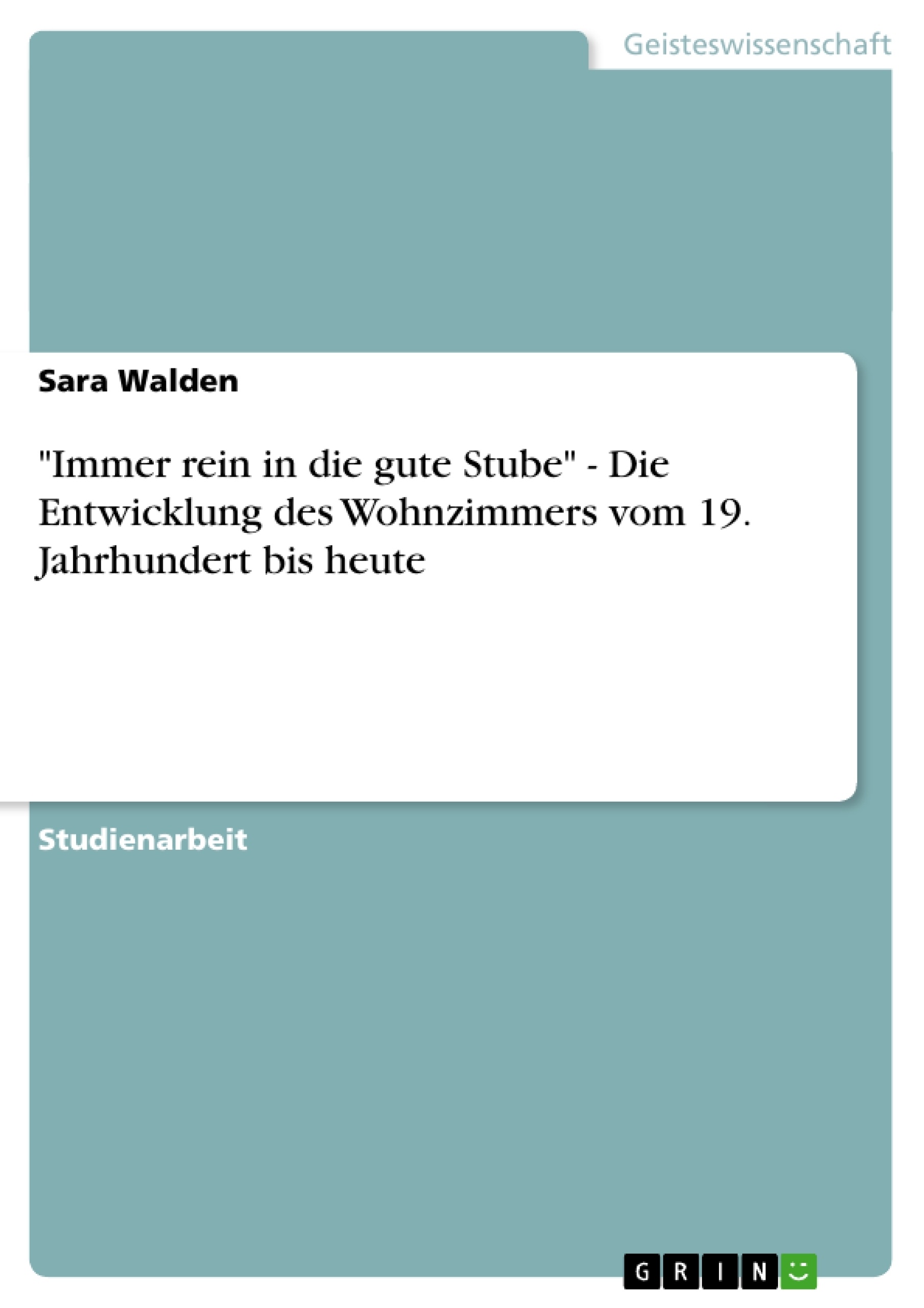Der Mensch verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Arbeits- und Wohnbereich (vgl. Deutscher Werkbund 1979: 5). Unter Wohnung wird „die Summe von Räumen, welche die Führung eines Haushaltes ermöglichen soll“ verstanden, dabei ist das bedeutendste Kennzeichen einer Wohnung die „Abgeschlossenheit“ (Rughöft 1992: 20). So sind Wohnungen immer baulich getrennt und separat zugänglich von anderen Wohnungen (vgl. ebd.). Seit jeher hat sich der Mensch Behausungen geschaffen, um sich vor klimatischen Einflüssen zu schützen (Flade/Roth 1987: 14). Er kann dort ungestört schlafen, essen, Kinder aufziehen usw. Gleichzeitig ermöglicht die Wohnung aber auch eine Abgrenzung. Das heißt, der Mensch kann sich jederzeit zurückziehen und vor zuviel Nähe zu anderen bewahren (vgl. ebd.). Dieses Bedürfnis nach Privatsphäre hat sich erst im Laufe des letzten Jahrhunderts herausgebildet, da man früher mit viel mehr Menschen unter einem Dach gelebt hat und die Bautechniken noch nicht so ausgereift waren. Heutige Kommunikations- und Unterhaltungsmöglichkeiten wie Telefon, Internet, Kino und Fernsehen gab es damals noch nicht und aus diesem Grund besuchten sich die Leute einfach öfter, vor allem auch ohne Vorankündigung und waren gezwungen war, sich gegenseitig selbst zu unterhalten.
Durch die Trennung von Wohn- und Arbeitsplatz wurde es dem Menschen er-möglicht, sich abseits von seinem Beruf einen Ort zur Selbstdarstellung zu schaffen. So kann er sich in seiner Wohnung selbst verwirklichen, wie es im Beruf nicht immer möglich ist (vgl. Deutscher Werkbund 1979: 5). Das Wohnzimmer spielt dabei eine besondere Rolle, da es der Raum ist, in dem man Besuch empfängt und sich somit dort am besten darstellen kann. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung des Wohnzimmers seit seiner Entstehung im 19. Jahrhundert bis heute. Es wird untersucht, ob es sich bei unserem heutigen Wohnzimmer tatsächlich um ein Gemeinschaftszimmer handelt, dass von der ganzen Familie genutzt wird oder ob es sich zur „Guten Stube“ von früher entwickelt hat, die für Kinder verboten ist und nur zu „besonderen Anlässen“ genutzt wird. Dabei werde ich zunächst definieren, was in der Wohnsoziologie unter dem Begriff Wohnzimmer verstanden wird (1.) und auf die Größe (1.1), die Einrichtung (1.2) und die Funktion (1.3) dieses Raumes eingehen...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition des Wohnzimmers
- Größe
- Einrichtung
- Funktion
- Historische Wohnformen
- Bäuerliche Lebensweise
- Lebensweise der Handwerker
- Heimarbeiterhaushalt
- Bürgerlicher Haushalt
- Proletarierhaushalt
- Von der guten Stube zum Wohnzimmer
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Wohnzimmers vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart und untersucht, inwieweit sich die Funktion und Bedeutung dieses Raumes im Laufe der Zeit gewandelt haben. Insbesondere wird der Frage nachgegangen, ob das heutige Wohnzimmer tatsächlich ein Raum der Gemeinschaft ist, der von der gesamten Familie genutzt wird, oder ob es sich zur „Guten Stube“ von früher entwickelt hat.
- Definition des Wohnzimmers: Größe, Einrichtung und Funktion
- Historische Wohnformen: Bäuerliche Lebensweise, Handwerkerhaushalt, Bürgerlicher Haushalt und Proletarierhaushalt
- Vergleich zwischen der „Guten Stube“ und dem heutigen Wohnzimmer
- Einfluss der Entwicklung des Wohnzimmers auf seine Bewohner
- Zukünftige Entwicklungstrends im Bereich des Wohnens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Wohnens für den Menschen dar und leitet die Forschungsfrage nach der Entwicklung des Wohnzimmers ein. Sie skizziert zudem die Vorgehensweise der Arbeit.
Das erste Kapitel definiert den Begriff des Wohnzimmers anhand von Kriterien wie Größe, Einrichtung und Funktion. Es beleuchtet die unterschiedlichen Nutzungen des Wohnzimmers im Familienkontext und stellt die Bedeutung des Raumes für die Selbstdarstellung vor Gästen heraus.
Im zweiten Kapitel werden verschiedene historische Wohnformen vorgestellt, die den Hintergrund für die Entwicklung des heutigen Wohnzimmers bilden. Dazu gehören die bäuerliche Lebensweise, die Lebensweise der Handwerker, der Heimarbeiterhaushalt, der bürgerliche Haushalt und der Proletarierhaushalt.
Das dritte Kapitel untersucht den Wandel vom traditionellen „Guten Stube“ zum heutigen Wohnzimmer. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Wohnformen herausgestellt.
Schlüsselwörter
Wohnzimmer, Wohnkultur, Wohnraum, Wohnformen, gute Stube, Gemeinschaft, Familienleben, Selbstdarstellung, Geschichte des Wohnens, Wohnungsbau, Sozialgeschichte, Historische Entwicklung, Wohnforschung.
- Quote paper
- Sara Walden (Author), 2004, "Immer rein in die gute Stube" - Die Entwicklung des Wohnzimmers vom 19. Jahrhundert bis heute, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31880