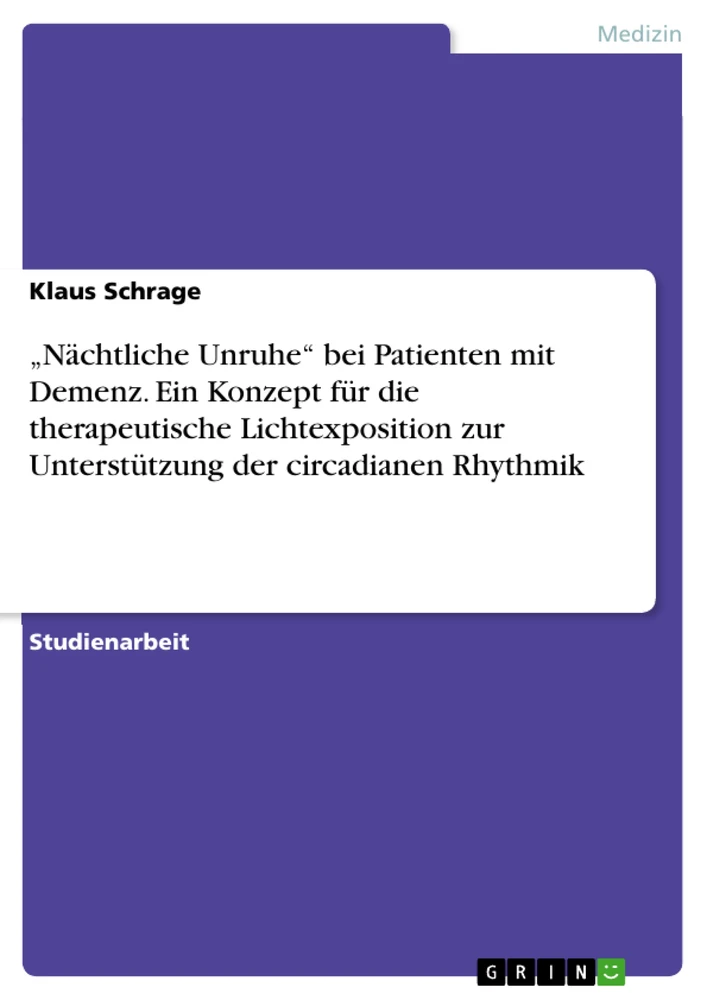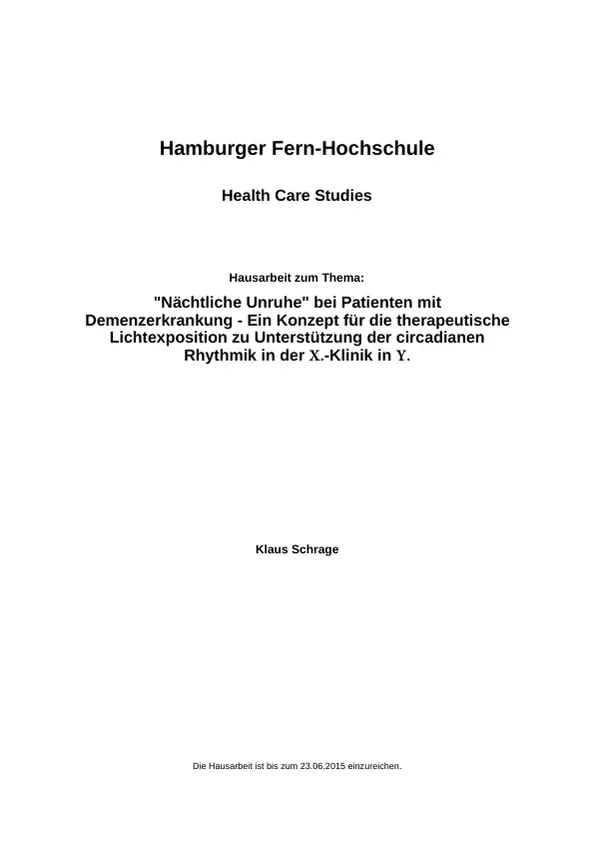Im Zentrum der geplanten Projektarbeit steht die Frage, ob und in welcher Form besondere Lichtexpositionen geeignet sind, der „nächtlichen Unruhe“ von Patienten vorzubeugen, die an Demenz erkrankt sind. Es geht also um die Frage, wie Lichtexpositionen, welche bereits für andere Indikationen erfolgreich in einer Studie in Wien angewendet wurden, die circadiane Rhythmik von Demenz-Erkrankten positiv beeinflussen können und wie diese im Pflegealltag praktisch eingesetzt werden könnten.
Zum Krankheitsbild der Demenzerkrankung gehören Schlafstörungen, die nicht selten Anlass für Angehörige sind, demenzkranke Angehörige in eine Pflegeeinrichtung zu geben. „Nächtliche Unruhe“ von Patienten mit Demenzerkrankung ist als pflegerisch relevantes Problem zu werten. Fast 40 % aller Patienten im mittleren Stadium der Erkrankung leiden unter Schlafstörungen, welche die Symptome der Erkrankung verstärken können. Mit zunehmender Dämmerung werden diese Patienten unruhig, gehen aber häufig auch zu früh ins Bett, finden keinen tiefen Schlaf, schrecken nachts auf, irren desorientiert durch die Flure, manchmal heftig erregt, oder sind schon vor der allgemeinen Aufstehzeit hellwach.
Für das Pflegepersonal entstehen neben den nachts durchzuführenden Routineaufgaben zusätzliche Aufgabenfelder: Die umherirrenden Menschen müssen begleitet und oftmals beruhigt werden. Aufgrund des reduzierten Personalschlüssels zur Nachtzeit kann dies jedoch kaum ausreichend gewährleistet werden. In der Fachliteratur wird daher bereits seit Längerem gemahnt, dass mehr individuelle Zuwendung und ein erhöhter Zeitaufwand im Krankenhaus erforderlich seien, um die Qualität der Betreuung dieser Patienten zu sichern.
Inhaltsverzeichnis
- „Nächtliche Unruhe“ - ein pflegerisch relevantes Problem
- Lösungsansätze
- Medikamentöse Intervention
- Tagesstrukturierende und aktivierende Maßnahmen
- Das Forschungsprojekt St. Katharina in Wien 2011
- Lichtexposition
- Theoretische Grundlagen der Lichttherapie in Abgrenzung zur Lichtexposition für die Unterstützung der circadianen Rhythmik bei Demenz
- Therapeutische Lichtexposition und Pflege
- Adaption an räumliche, technische und personelle Gegebenheiten
- Entwicklung eines Konzepts für die Lichtexposition zur Unterstützung der circadianen Rhythmik
- Technische Umsetzung
- Positionierung und Eigenschaften der Beleuchtungskörper
- Lichtszenarien
- Pflegerische Umsetzung
- Organisatorische Umsetzung
- Anschaffungskosten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Problem der nächtlichen Unruhe bei Demenzpatienten in der X.-Klinik und entwickelt ein Konzept zur Verbesserung der Situation durch therapeutische Lichtexposition. Ziel ist die positive Beeinflussung der circadianen Rhythmik und damit die Reduktion von Schlafstörungen und damit verbundenen Risiken.
- Nächtliche Unruhe als pflegerisch relevantes Problem bei Demenzpatienten
- Bewertung verschiedener Lösungsansätze (medikamentös, tagesstrukturierend)
- Theoretische Grundlagen der Lichttherapie und Lichtexposition
- Entwicklung eines konkreten Konzepts für die Lichtexposition in der X.-Klinik
- Praktische und organisatorische Umsetzung des Konzepts
Zusammenfassung der Kapitel
„Nächtliche Unruhe“ - ein pflegerisch relevantes Problem: Dieses Kapitel beschreibt nächtliche Unruhe bei Demenzpatienten als ein bedeutendes Problem im Pflegealltag. Es verdeutlicht die Herausforderungen für Pflegepersonal und Angehörige, die durch die Desorientierung und Gangunsicherheit der Patienten entstehen. Der erhöhte Zeitaufwand und die Notwendigkeit individueller Zuwendung werden hervorgehoben, wobei die häufigen Schlafstörungen im mittleren Demenzstadium (fast 40%) und die damit verbundenen Risiken (z.B. Stürze) im Mittelpunkt stehen. Die Beobachtung der nächtlichen Unruhe in der X.-Klinik dient als Ausgangspunkt für die weitere Untersuchung.
Lösungsansätze: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Ansätze zur Behandlung von Schlafstörungen bei Demenzpatienten. Es wird kritisch auf die medikamentöse Intervention eingegangen, wobei die Risiken und Nebenwirkungen von Hypnotika und die Notwendigkeit einer vorsichtigen Anwendung von Neuroleptika und Antidepressiva betont werden. Tagesstrukturierende und aktivierende Maßnahmen werden als Alternative vorgestellt, deren positive Wirkung auf die Schlafdauer bereits in Studien belegt wurde. Das Forschungsprojekt St. Katharina in Wien, welches den positiven Einfluss von Lichtexposition auf Kommunikation und soziale Aktivitäten bei Demenzpatienten zeigte, wird als Grundlage für die weitere Untersuchung herangezogen. Die Frage nach optimalen Expositionszeiten und Lichtintensitäten bleibt dabei offen.
Lichtexposition: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Lichttherapie und der Lichtexposition zur Unterstützung der circadianen Rhythmik bei Demenzpatienten dar. Es differenziert zwischen Lichttherapie und Lichtexposition und beschreibt die Bedeutung der Lichtexposition für die Pflege von Demenzkranken. Die Adaption an räumliche, technische und personelle Gegebenheiten wird als wichtiger Aspekt für die erfolgreiche Implementierung hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Nächtliche Unruhe, Demenzerkrankung, Schlafstörungen, circadiane Rhythmik, Lichtexposition, Lichttherapie, Pflege, X.-Klinik, Interventionen, Tagesstrukturierung, Aktivierung, Medikamentöse Therapie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu „Nächtliche Unruhe bei Demenzpatienten in der X.-Klinik“
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Problem der nächtlichen Unruhe bei Demenzpatienten in der X.-Klinik und entwickelt ein Konzept zur Verbesserung der Situation durch therapeutische Lichtexposition. Ziel ist die positive Beeinflussung der circadianen Rhythmik und damit die Reduktion von Schlafstörungen und damit verbundenen Risiken.
Welche Probleme werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit nächtlicher Unruhe als einem bedeutenden pflegerischen Problem bei Demenzpatienten. Es werden die Herausforderungen für Pflegepersonal und Angehörige, die durch die Desorientierung und Gangunsicherheit der Patienten entstehen, beleuchtet. Im Mittelpunkt stehen die häufigen Schlafstörungen im mittleren Demenzstadium und die damit verbundenen Risiken wie Stürze.
Welche Lösungsansätze werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Lösungsansätze, darunter medikamentöse Interventionen (mit kritischer Auseinandersetzung mit Risiken und Nebenwirkungen von Hypnotika, Neuroleptika und Antidepressiva) und tagesstrukturierende sowie aktivierende Maßnahmen. Das Forschungsprojekt St. Katharina in Wien, welches den positiven Einfluss von Lichtexposition auf Kommunikation und soziale Aktivitäten bei Demenzpatienten zeigte, wird als Grundlage für die weitere Untersuchung herangezogen.
Welche Rolle spielt die Lichtexposition?
Die Arbeit legt die theoretischen Grundlagen der Lichttherapie und der Lichtexposition zur Unterstützung der circadianen Rhythmik bei Demenzpatienten dar. Es wird zwischen Lichttherapie und Lichtexposition differenziert und die Bedeutung der Lichtexposition für die Pflege von Demenzkranken beschrieben. Die Adaption an räumliche, technische und personelle Gegebenheiten wird als wichtiger Aspekt für die erfolgreiche Implementierung hervorgehoben. Das entwickelte Konzept beinhaltet die technische Umsetzung (Positionierung und Eigenschaften der Beleuchtungskörper, Lichtszenarien), die pflegerische Umsetzung, die organisatorische Umsetzung und die Betrachtung der Anschaffungskosten.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel („Nächtliche Unruhe“, „Lösungsansätze“, „Lichtexposition“), sowie Schlüsselwörter. Die Kapitel beschreiben das Problem der nächtlichen Unruhe, verschiedene Lösungsansätze, die theoretischen Grundlagen der Lichtexposition und die Entwicklung eines konkreten Konzepts für die X.-Klinik, inklusive praktischer und organisatorischer Umsetzung.
Welche konkreten Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert ein konkretes Konzept für die therapeutische Lichtexposition zur Verbesserung der circadianen Rhythmik bei Demenzpatienten in der X.-Klinik. Dieses Konzept beinhaltet detaillierte Angaben zur technischen, pflegerischen und organisatorischen Umsetzung sowie zu den geschätzten Anschaffungskosten. Die Arbeit basiert auf theoretischen Grundlagen und berücksichtigt die Ergebnisse relevanter Forschungsarbeiten, wie z.B. des Forschungsprojekts St. Katharina in Wien.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Nächtliche Unruhe, Demenzerkrankung, Schlafstörungen, circadiane Rhythmik, Lichtexposition, Lichttherapie, Pflege, X.-Klinik, Interventionen, Tagesstrukturierung, Aktivierung, Medikamentöse Therapie.
- Quote paper
- Klaus Schrage (Author), 2015, „Nächtliche Unruhe“ bei Patienten mit Demenz. Ein Konzept für die therapeutische Lichtexposition zur Unterstützung der circadianen Rhythmik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318589