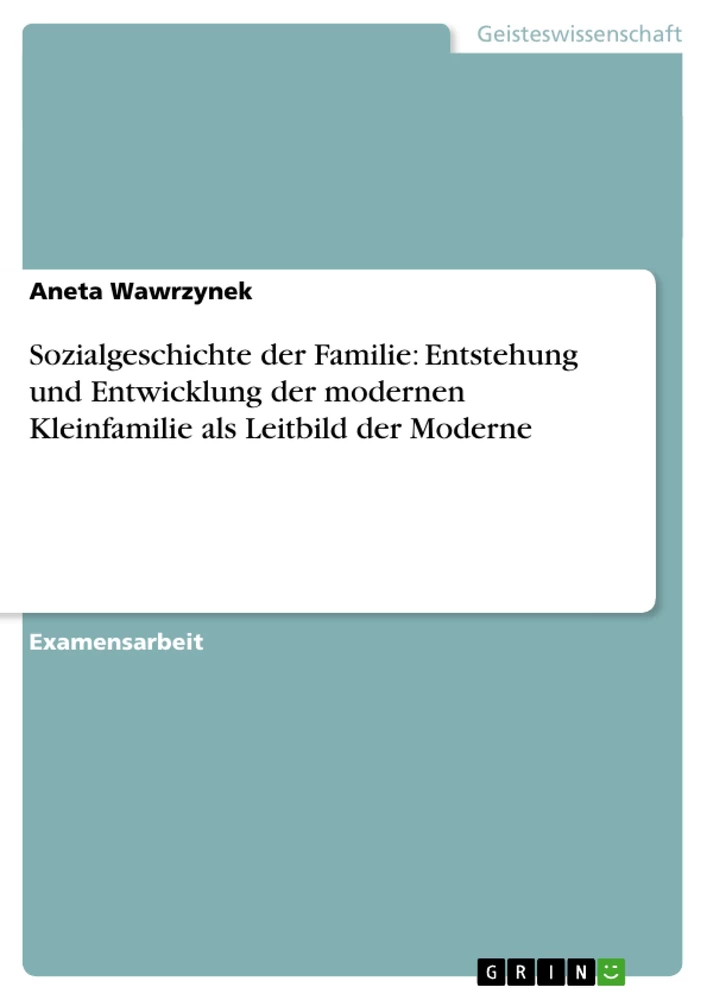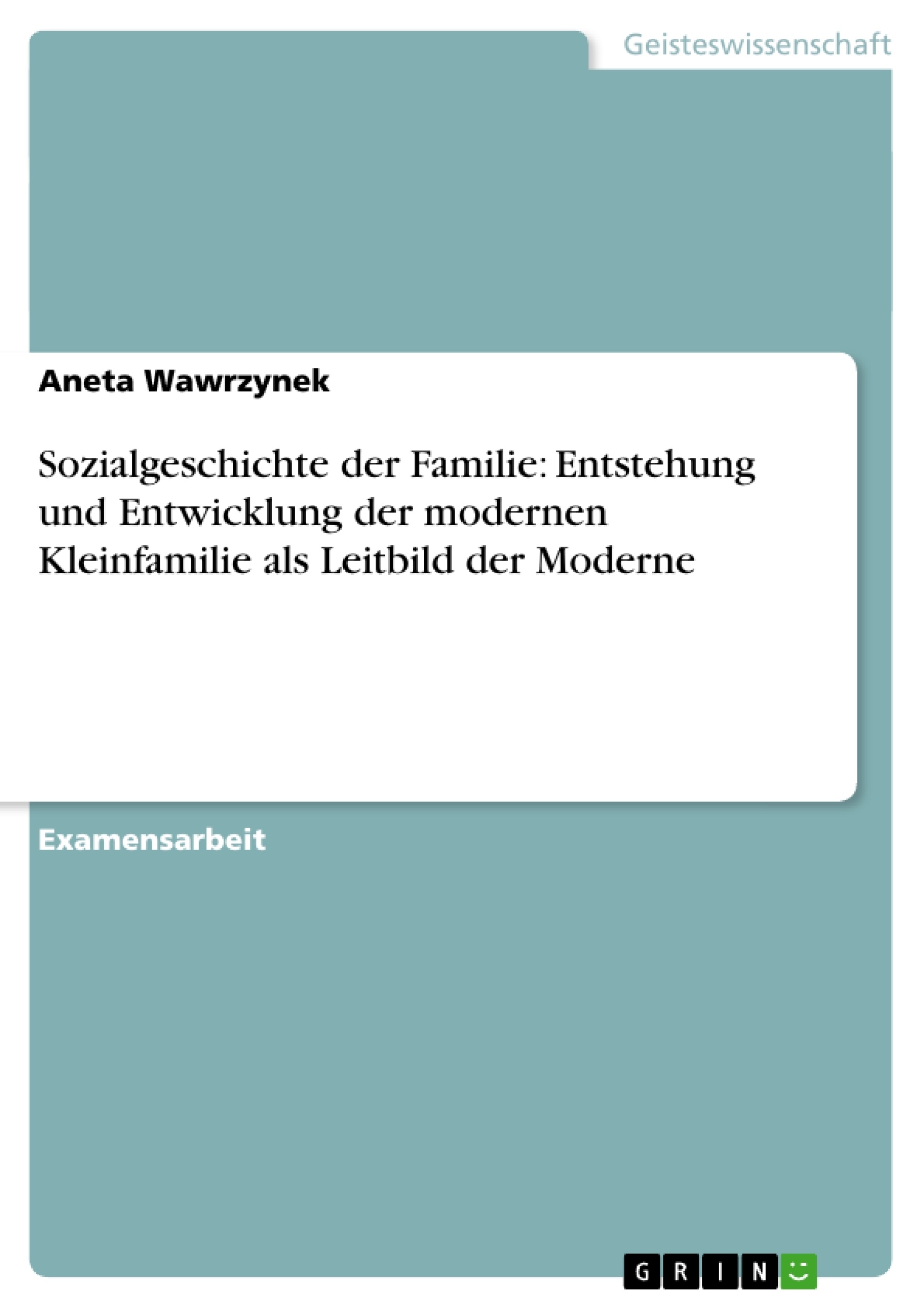Der Wandel der privaten Lebensformen und die Entwicklung von Ehe und Familie haben in den letzten Jahren ein bedeutendes Echo im öffentlichen Leben gefunden. Das späte Heiratsalter, die hohen Scheidungszahlen, der Rückgang der Geburtenzahlen, die Zunahme der Einpersonenhaushalte und der kinderlosen Ehen haben dazu geführt, dass die Funktion von Ehe und Familie zunehmend in den Medien in Zweifel gezogen wird. Sind wir auf dem Weg zur Single-Gesellschaft oder „[a]uf dem Weg zur Greisenrepublik“? Werden wir ein Land der Lebensabschnittspartner und Einzelkinder oder stirbt gar die Normalfamilie aus? Die Zukunftschancen der Familie werden heute in sehr düsteren Farben geschildert. Man spricht von der Familie in der Krise und sagt einen Zerfall derselben vorher.
Soziologisch lassen sich zwei grundsätzliche Pole unterscheiden: Zum einen wird die Entwicklung der familialen Strukturen als bedauernswerter Funktionsverlust, zum anderen als Ausbildung der eigensten Funktion der Familie beschrieben. Zwischen diesen Polen wird differenzierend von Funktionsentlastung, Funktionsverlagerung und evolutionärem Funktionswandel der Familie gesprochen. Hier wird ein Richtungsstreit sichtbar, in dem erbittert gerungen wird. Soll man am traditionellen Bild der Familie festhalten – an jener geschlossenen Einheit von Vater-Mutter-Kind, standesamtlich legitimiert und lebenslang aneinander gebunden? Sollen daran gemessen die anderen Formen als anormal, defizitär und funktionslos gelten?
Oft ist in Politik, Wissenschaft und Alltag nicht mehr klar, wer zur Familie gehört. Es stellt sich die Frage, welche Beziehungsformen normal, welche abweichend und welche der staatlichen Förderung würdig sind. Diese strukturellen Veränderungen haben tief greifende Konsequenzen für alle sozialen Sicherungssysteme, weil die Familie in ihren verschiedenen Ausprägungen das „Grundmodell für gelebten Gemeinsinn“ bildet, der Staat und die Gesellschaft gleichsam ihr Fundament in der Familie sehen. Gerade in der Politik wäre ein sachlicher Diskurs über den familialen Wandel als Basis für verantwortliches Handeln nötig.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- 1. Der Begriff „Familie“
- 1.1 Etymologische Herleitung des Begriffs „Familie“
- 1.2 Soziologische Definition von Familie nach Nave-Herz
- 1.3 Die Familie in der vorindustriellen traditionellen Gesellschaft.
- 1.3.1 Das „ganze Haus“.
- 1.3.2 Soziale Beziehungen im „Ganzen Haus“
- 1.3.3 Arbeitsteilung im „Ganzen Haus“
- 2. Die Vielfalt von Familienformen in der vorindustriellen Zeit
- 2.1 Vorindustrielle Familienformen
- 2.2 Der Mythos der Großfamilie
- 3. Die Auswirkungen der Industrialisierung.
- 3.1 Die Entstehung des modernen bürgerlichen Familienmodells
- 3.2 Das Ideal der romantischen Liebe
- 3.3 Intimisierung und Emotionalisierung der Familie.
- 3.4 Die Entstehung von Kindheit.
- 3.5 Funktionale GeschlechtsrollenSpezialisierung
- 3.6 Die Arbeiterfamilien.
- 3.7 Die Universalisierung des bürgerlichen Familienmodells
- 4. Funktionsverlust, Funktionsentlastung oder Funktionswandel der Familie?
- 5. Familie im zeitgenössischen Wandel von der Mitte des 20. Jahrhunderts bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts.
- 5.1 Partnerschaftliche Beziehungen Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre.
- 5.2 Wandel der partnerschaftlichen Beziehungen seit Mitte der 60er Jahre.
- 5.2.1 Emanzipation der Frau ....
- 5.2.2 Erwerbstätigkeit von Frauen.
- 5.3 Rückgang der Eheschließungen ab den 60er Jahren
- 5.4 Allgemeiner Geburtenrückgang
- 5.5 Zunahme nichtehelicher Geburten.
- 5.6 Zunahme der Ehescheidungen
- 5.7 Alternativen zu traditionellen Ehe- und Familienformen.
- 5.7.1. Einzelpersonenhaushalte.
- 5.7.2 Nichteheliche Lebensgemeinschaften (NELs).
- 25.7.3 Wohngemeinschaften (WGs)...
- 5.7.4 Gleichgeschlechtliche Partnerschaften.
- 5.7.5 Sexuell nichtexklusive Partnerschaften
- 5.8 Ehe- und Familienformen..
- 5.8.1 Zwei-Karrieren-Ehen..
- 5.8.2 Commuter-Ehe.
- 5.8.3 Transkulturelle Familie.
- 5.8.4 Kinderlose Ehen
- 5.8.5 Alleinerziehende (Ein-Eltern-Familie)
- 5.8.6 Stieffamilien..
- 5.8.7 Adoptionsfamilie..
- 5.8.8 Inseminationsfamilien...
- 5.8.9 Hausmännerehe.
- 5.9 Deinstitutionalisierung des bürgerlichen Familienmusters.
- 6. Theoretische Erklärungsansätze für den sozialen Wandel privater Lebensformen
- 6.1 Individualisierungsthese von U. Beck
- 6.2 Theorie der sozialen Differenzierung.
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die Entwicklung der Familie von der vorindustriellen bis zur postmodernen Gesellschaft zu beschreiben und theoretische Erklärungsansätze für den sozialen Wandel der privaten Lebensformen aufzuzeigen.
- Die Entstehung und Entwicklung der modernen Kleinfamilie als Leitbild der Moderne
- Die Veränderungen von Familienformen im Laufe der Geschichte
- Der Einfluss der Industrialisierung auf die Familie
- Die Auswirkungen des Familienwandels auf die Gesellschaft
- Theoretische Ansätze zur Erklärung des Familienwandels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition des Begriffs „Familie“ und einer Betrachtung der Familienformen in der vorindustriellen Gesellschaft. Anschließend wird der Einfluss der Industrialisierung auf die Entstehung des modernen bürgerlichen Familienmodells beleuchtet. Es werden die Veränderungen in den Bereichen der Geschlechterrollen, der Erwerbstätigkeit von Frauen, der Kindererziehung und der Familie als Institution dargestellt.
Im weiteren Verlauf der Arbeit wird der Familienwandel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts analysiert. Themen wie die Zunahme von Scheidungen, die Verbreitung nichtehelicher Lebensgemeinschaften und die Entstehung neuer Familienformen werden diskutiert. Die Arbeit endet mit einer Präsentation verschiedener theoretischer Ansätze zur Erklärung des Familienwandels.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Sozialgeschichte der Familie, der Entstehung und Entwicklung der modernen Kleinfamilie, dem Einfluss der Industrialisierung, der Individualisierung, der Veränderung von Geschlechterrollen, den Auswirkungen des Familienwandels auf die Gesellschaft und verschiedenen theoretischen Erklärungsansätzen.
- Quote paper
- Aneta Wawrzynek (Author), 2004, Sozialgeschichte der Familie: Entstehung und Entwicklung der modernen Kleinfamilie als Leitbild der Moderne, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31831