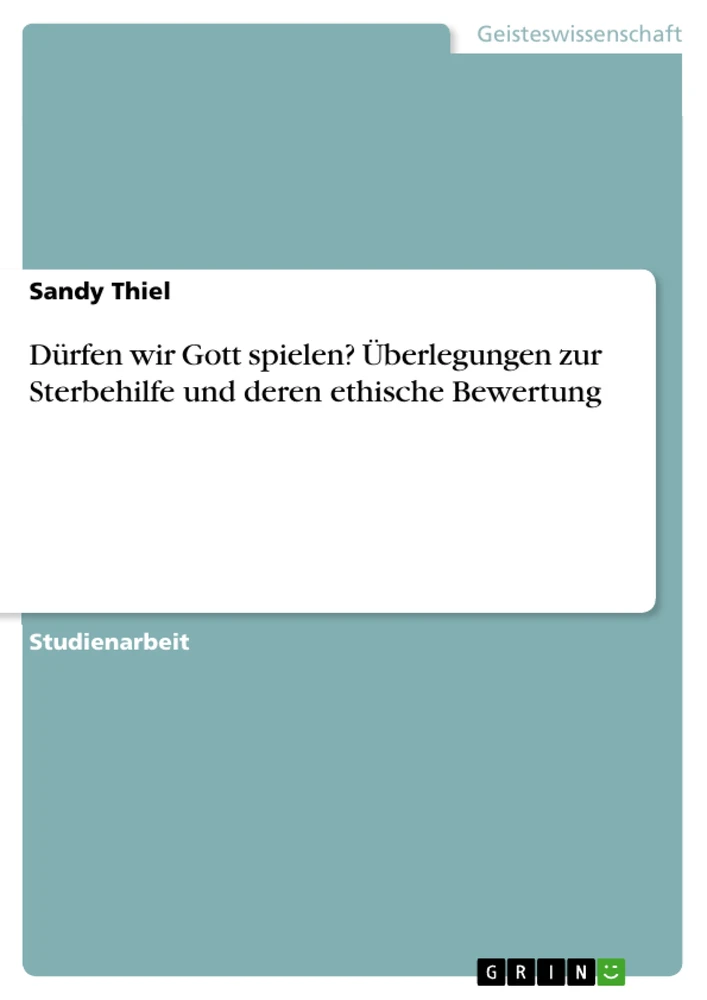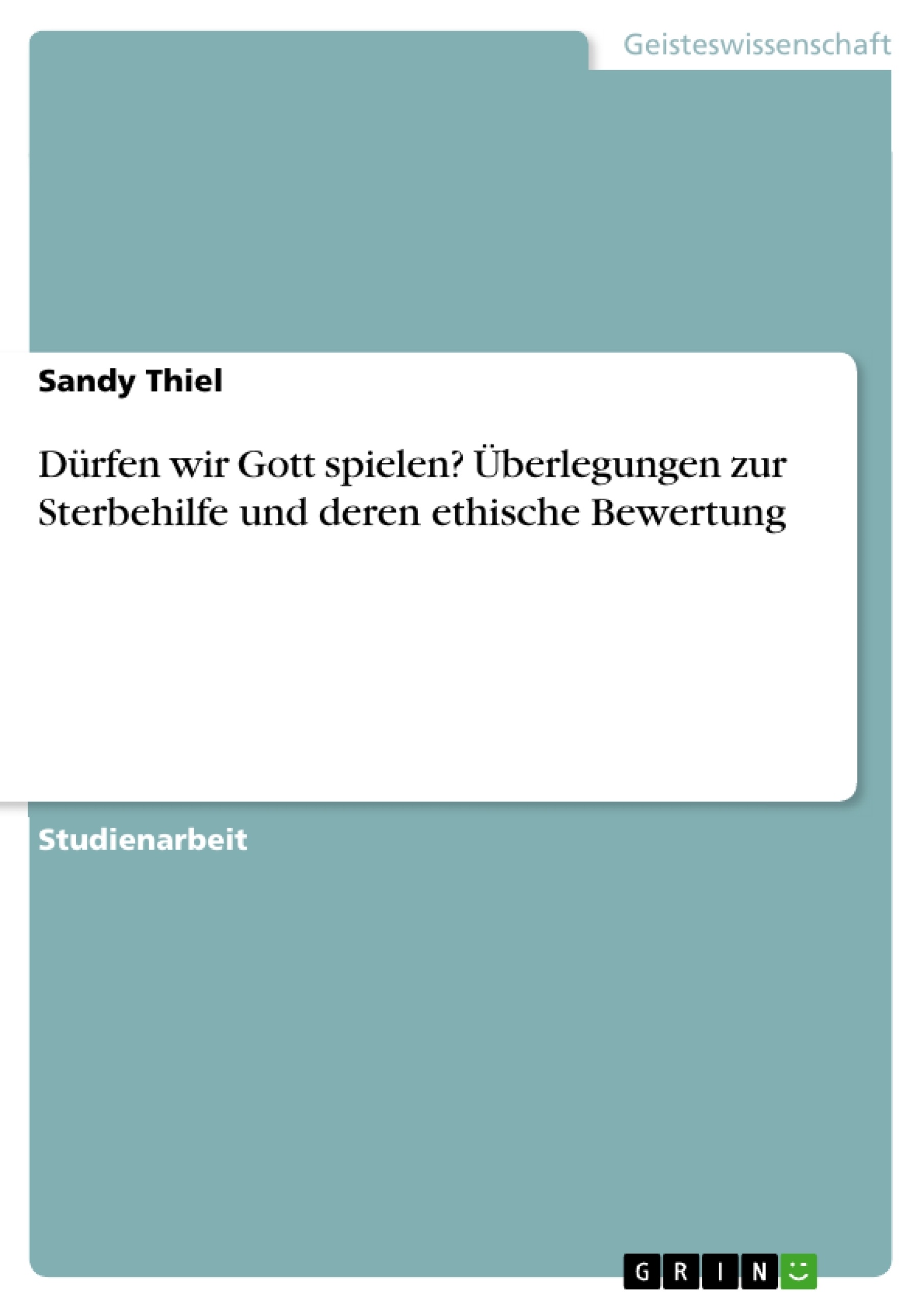Die vorliegende Studienarbeit beschäftigt sich primär aus ethischer Sicht mit der Problematik der Sterbehilfe. Sie beginnt mit einer Begriffsklärung und den verschiedenen Arten der Sterbehilfe. Im zweiten Kapitel wird zuerst kurz eine Darstellung aus medizinischer Sicht erfolgen, um dann die religiöse und ethische Sicht genau zu beleuchten. Biblische Textstellen sollen dabei zeigen, wie die christlich-religiöse Sichtweise aussieht. Des weiteren werden einige deontologische und konsequentialistische Argumentationsmuster angeführt, um im Anschluss eine ethische Diskussion führen zu können. Auch eine Alternative zur Sterbehilfe wird aufgezeigt, nämlich die Palliativmedizin.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. So jedenfalls steht es im ersten Artikel des deutschen Grundgesetzes. Aber kann der Mensch auch in der letzten Lebensphase, nämlich im Sterben, seine Würde bewahren? Zum Leben gehört das Sterben schließlich dazu, woraus sich schlussfolgern lässt, dass deshalb auch die Sterbephase menschenwürdig ablaufen sollte. Jedoch ist es in Deutschland keine Seltenheit, dass es bei den Betroffenen, die dem Tode geweiht sind, eher mit einer qualvollen Sterbeverzögerung endet statt mit einem schnellen und schmerzlosen Tod.
Schon seit Jahren gibt es heftige Debatten und kontroverse Diskussionen rund um dieses Thema, sowohl im medizinischen und strafrechtlichen als auch im ethischen Terrain. Auch wenn es unterschiedliche Antworten geben mag, stellen sich folgende Fragen stets gleich: Hat irgendjemand auf dieser Welt außer Gott die Befugnis, über Leben und Tod zu entscheiden? Können sich Menschen dieses Recht anmaßen, was ihnen nicht naturgegeben ist und deshalb gar nicht erst zusteht? Dürfen wir einfach so Gott spielen und über den Tod Anderer entscheiden? Gibt es überhaupt Alternativen? Generell antworte ich auf all diese Fragen mit einem klaren Ja. Dies wird im Laufe dieser Studienarbeit versucht zu begründen. Die Frage, die sich mir außerdem stellt ist die, warum Gott, wenn es ihn denn als höchste Instanz gibt, zulässt, dass Menschen ein qualvolles Sterben ertragen müssen. Wieso greift er nicht ein und erlöst sie von ihren Schmerzen, anstatt sie weiterleben zu lassen? Wenn er diesen menschenunwürdigen und unerträglichen Schmerz der „Fast-schon-Gestorbenen“ duldet, müssen es ihm dann seine Schöpfungswesen gleich tun? Auch auf diese Frage wird im Hauptteil eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was Sterbehilfe bedeutet
- Begriffsklärung
- Die Arten der Sterbehilfe
- Über die medizinischen und die ethischen Sichtweisen
- Die medizinische Sicht als Spannungsfeld zwischen Lebenserhaltung und Leidlinderung
- Die ethische und religiöse Sichtweise – Dürfen wir Menschen Gott spielen?
- Biblische Aussagen und ihre moralischen Konsequenzen für die Sterbehilfe
- Ausgewählte deontologische und konsequentialistische Argumentationsmuster
- Pro und Kontra- Diskussion
- Eine Alternative zur Sterbehilfe: Die Palliativmedizin
- Über die Prinzipien und die Bedeutung der palliativen Medizin
- Grundsätze der Bundesärztekammer zur Sterbebegleitung
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich primär aus ethischer Sicht mit der Problematik der Sterbehilfe. Sie will die verschiedenen Formen der Sterbehilfe beleuchten und die medizinischen sowie ethischen Aspekte und Argumentationsmuster im Detail analysieren. Die Arbeit geht insbesondere auf die Frage ein, ob Menschen Gott spielen dürfen, indem sie über Leben und Tod entscheiden.
- Begriffserklärung und verschiedene Arten der Sterbehilfe
- Medizinische, ethische und religiöse Perspektiven auf Sterbehilfe
- Deontologische und konsequentialistische Argumentationsmuster
- Pro und Kontra-Diskussion zur Sterbehilfe
- Palliativmedizin als Alternative zur Sterbehilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Sterbehilfe ein und beleuchtet die Frage der Würde des Menschen im Sterben. Sie stellt die kontroversen Debatten rund um die Sterbehilfe dar und stellt zentrale Fragen zur Entscheidungsgewalt über Leben und Tod.
Das zweite Kapitel definiert den Begriff der Sterbehilfe und beschreibt die verschiedenen Arten der Sterbehilfe. Es werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und die gesellschaftlichen Debatten um die Legalisierung von Sterbehilfe skizziert.
Kapitel drei befasst sich mit den medizinischen und ethischen Sichtweisen auf die Sterbehilfe. Es wird die Spannungsrelation zwischen Lebenserhaltung und Leidlinderung aus medizinischer Sicht beleuchtet. Der Abschnitt diskutiert die ethische und religiöse Perspektive und analysiert biblische Aussagen und ihre moralischen Konsequenzen für die Sterbehilfe. Darüber hinaus werden deontologische und konsequentialistische Argumentationsmuster vorgestellt, um eine fundierte ethische Diskussion zu ermöglichen.
Kapitel vier stellt die Palliativmedizin als Alternative zur Sterbehilfe vor und erläutert die Prinzipien und die Bedeutung der Palliativmedizin. Es werden die Grundsätze der Bundesärztekammer zur Sterbebegleitung beleuchtet und die Möglichkeiten und Grenzen der palliativen Versorgung diskutiert.
Schlüsselwörter
Sterbehilfe, Euthanasie, assistierter Suizid, Palliativmedizin, Lebenserhaltung, Leidlinderung, Ethik, Religion, Deontologie, Konsequentialismus, Würde des Menschen, Gott spielen, moralische Rechtfertigung, Standesethik, Recht, Debatte, Diskussion, Gesellschaft, Medizin, Rechtssystem, Gesetzgebung.
- Quote paper
- Sandy Thiel (Author), 2010, Dürfen wir Gott spielen? Überlegungen zur Sterbehilfe und deren ethische Bewertung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318229