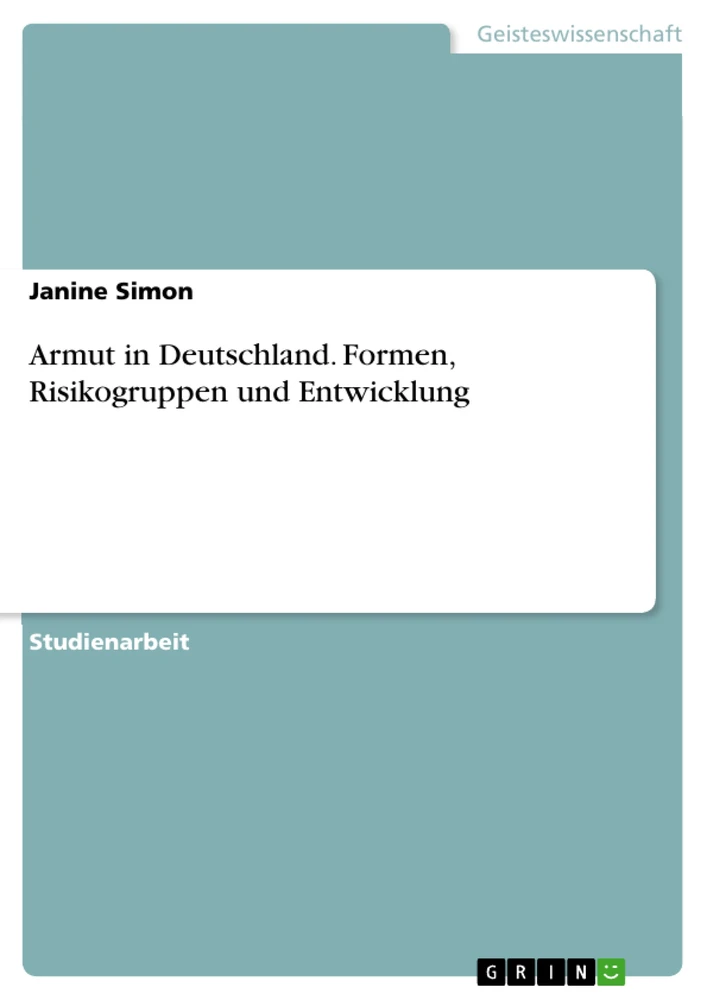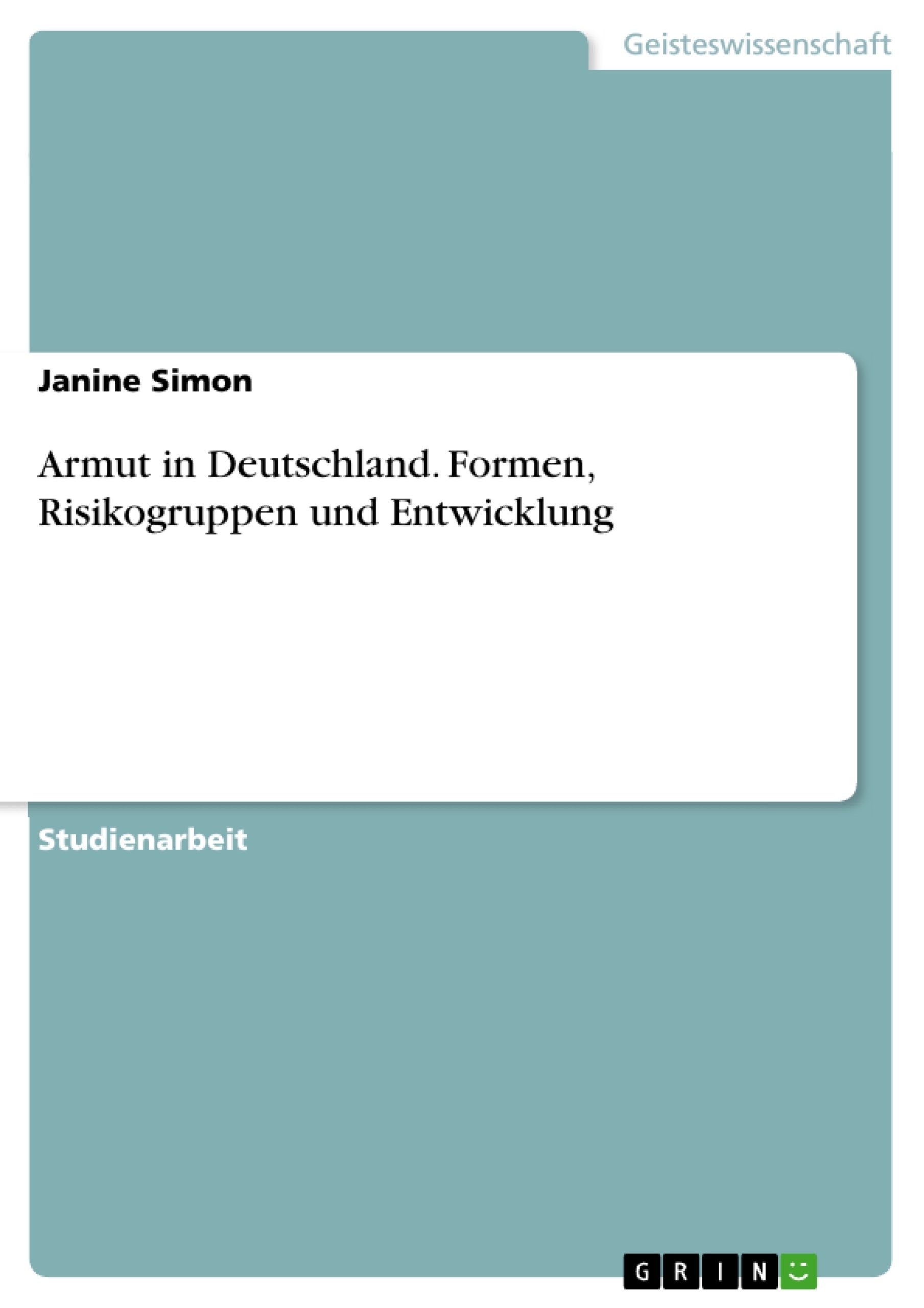Die vorliegende Arbeit versucht dem Problem der Armut in Deutschland auf den Grund zu gehen. Zunächst sollen Armut und die unterschiedlichen Formen von Armut definiert werden, um dann näher auf die betroffenen Risikogruppen eingehen zu können. Mit Hilfe dessen soll versucht werden die Entwicklung von Armut in Deutschland zu beschreiben.
Es soll auf die Komplexität des Problems durch die ökonomische Betrachtungsweise hingewiesen werden. Während man als Mitglied der Gesellschaft oft dazu neigt, das Problem eher aus empathischer Sicht zu betrachten, schärft die ökonomische Betrachtungsweise den „objektiven“ Blick auf die Thematik. Die Bemessung des Lebensstandards aus dieser Perspektive zeigt auf, wie verzerrend Statistiken und deren Ergebnisse sein können bzw. wie unverständlich sie uns erscheinen, wenn wir Mitgefühl entwickeln. Jemand, der nach diesen „trockenen“ Berechnungen als nicht arm definiert wird, ist in der Realität vielleicht doch nicht wohlhabend genug, um Grundbedürfnisse von Kindern und Familie zu befriedigen.
Der Rückblick auf die Erkenntnisse der Politischen Philosophie soll zeigen, dass es schon sehr früh die Erkenntnis gab, dass in unserer Gesellschaft wirtschaftliche „Ungleichheit“ vorliegt und man nach Auswegen aus dieser Problematik suchte. Auch wenn die diversen Ansätze in der Praxis kaum Anwendung gefunden haben, regen sie doch zum Nachdenken an, denn wäre beispielsweise eine Einkommensumverteilung nicht die Lösung des Problems? Wären wir bereit auf eigenes Kapital zu verzichten, um die Wohlfahrt aller Mitglieder der Gesellschaft zu maximieren? Wohl kaum. Die Ansätze der politischen Philosophie scheinen nicht mehr zeitgerecht zu sein, tragen meiner Meinung nach aber trotzdem einen gewinnbringenden Teil dazu bei, dass man sich kritisch mit der Thematik Armut, aber auch mit sich selbst auseinandersetzt.
Für eine finale Lösung des Problems der Armut in Deutschland, aber auch im Allgemeinen, braucht es verschiedene Ansätze und Veränderungen in nahezu allen gesellschaftlich relevanten Themengebieten. Mit dieser Arbeit soll es zumindest gelingen die Dringlichkeit des Problems bewusst zu machen und eine weitere Auseinandersetzung anzuregen, um die Armut zu verringern und nicht weiter wachsen zu lassen. Aus diesem Grund beschäftigt sich die vorliegende Arbeit auch mit potentiellen Unterstützungsmaßnahmen, bevor sie mit einer Schlussbetrachtung abschließt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Armutsbegriff und Formen von Armut
- 2.1 Absolute und Relative Armut
- 2.2 Neue Armut
- 3. Entwicklung von Armut in Deutschland
- 4. Armutsrisikogruppen
- 4.1 Alleinerziehende
- 4.2 Kinder und Jugendliche
- 4.3 Alte Menschen
- 4.4 Obdach- bzw. Wohnungslose
- 5. Exkurs: ökonomische Betrachtungsweise des Problems „Armut“
- 5.1 Bemessung des Lebensstandards
- 5.2 Politische Philosophie
- 6. Unterstützungsmaßnahmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Armut in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt. Ziel ist es, die verschiedenen Formen der Armut zu definieren, betroffene Risikogruppen zu identifizieren und die Entwicklung der Armut in Deutschland zu beschreiben. Die Arbeit beleuchtet zudem die ökonomische Perspektive auf Armut und diskutiert potentielle Unterstützungsmaßnahmen.
- Definition und verschiedene Formen von Armut
- Entwicklung der Armut in Deutschland
- Armutsrisikogruppen in Deutschland
- Ökonomische Betrachtungsweise von Armut
- Mögliche Unterstützungsmaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass Armut in Deutschland, trotz des hohen Wohlstands, ein relevantes sozialpolitisches Problem darstellt, das lange Zeit verdrängt wurde. Der Begriff der „Neuen Armut“ wird eingeführt und die Notwendigkeit einer umfassenden Auseinandersetzung mit dem Thema betont. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die zentralen Fragestellungen, die sie zu beantworten versucht. Der Gegensatz zwischen dem medial verbreiteten Bild von Armut in Entwicklungsländern und der Realität in Deutschland wird hervorgehoben.
2. Der Armutsbegriff und Formen von Armut: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Armut und ihren verschiedenen Ausprägungen. Es unterscheidet zwischen absoluter und relativer Armut und beleuchtet den wissenschaftlichen Diskurs um die Begriffsbestimmung. Die Definition der Europäischen Union wird vorgestellt und der historische Kontext der Armutsforschung wird kurz angerissen. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung verschiedener Armutsbegriffe und der Schwierigkeit, Armut objektiv zu messen.
3. Entwicklung von Armut in Deutschland: Dieses Kapitel (welches im vorliegenden Auszug nicht vollständig vorhanden ist) würde die historische Entwicklung der Armut in Deutschland beleuchten und möglicherweise auf gesellschaftliche und politische Veränderungen eingehen, welche die Armutsentwicklung beeinflusst haben. Es würde wahrscheinlich die Entwicklung der Armut nach der Wiedervereinigung detailliert beschreiben und die Zunahme der sozialen Ungleichheit thematisieren.
4. Armutsrisikogruppen: Dieses Kapitel (welches im vorliegenden Auszug nur teilweise vorhanden ist) würde die verschiedenen Risikogruppen für Armut in Deutschland detailliert untersuchen. Es würde die spezifischen Herausforderungen und Problemlagen von Alleinerziehenden, Kindern und Jugendlichen, älteren Menschen und Obdachlosen beleuchten und möglicherweise auf statistische Daten zurückgreifen. Die Kapitel würden die jeweiligen Risikofaktoren und die daraus resultierenden sozialen Probleme detailliert erläutern.
5. Exkurs: ökonomische Betrachtungsweise des Problems „Armut“: Dieser Exkurs analysiert die ökonomische Perspektive auf das Problem der Armut. Es wird die Bemessung des Lebensstandards anhand ökonomischer Kennzahlen erörtert und die Grenzen dieser Methode aufgezeigt. Die Arbeit würde die Ergebnisse der Politischen Philosophie heranziehen und die Frage der Einkommensumverteilung kritisch diskutieren. Der Widerspruch zwischen objektiven ökonomischen Daten und der subjektiven Erfahrung von Armut wird herausgestellt.
6. Unterstützungsmaßnahmen: Dieses Kapitel (welches im vorliegenden Auszug fehlt) würde verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut in Deutschland vorstellen und analysieren. Es würde sich wahrscheinlich mit Sozialhilfeleistungen, Arbeitsmarktpolitik und anderen relevanten politischen Maßnahmen auseinandersetzen und deren Effektivität bewerten.
Schlüsselwörter
Armut, Deutschland, Soziale Ungleichheit, Armutsrisikogruppen, Absolute Armut, Relative Armut, Neue Armut, Existenzminimum, Wohlstand, Sozialpolitik, Ökonomische Betrachtungsweise, Unterstützungsmaßnahmen, Soziale Polarisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Armut in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Armut in Deutschland, trotz des hohen Wohlstands des Landes. Sie definiert verschiedene Formen von Armut, identifiziert betroffene Risikogruppen, beschreibt die Entwicklung der Armut in Deutschland und beleuchtet die ökonomische Perspektive auf Armut sowie mögliche Unterstützungsmaßnahmen.
Welche Arten von Armut werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen absoluter und relativer Armut und führt den Begriff der „Neuen Armut“ ein. Es wird der wissenschaftliche Diskurs um die Begriffsbestimmung beleuchtet und die Definition der Europäischen Union vorgestellt. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Armutsbegriffen und der Schwierigkeit, Armut objektiv zu messen.
Welche Risikogruppen werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit untersucht detailliert verschiedene Risikogruppen für Armut in Deutschland, darunter Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche, ältere Menschen und Obdachlose. Es werden die spezifischen Herausforderungen und Problemlagen dieser Gruppen beleuchtet und möglicherweise statistische Daten herangezogen.
Wie wird die ökonomische Perspektive auf Armut behandelt?
Ein Exkurs analysiert die ökonomische Betrachtungsweise von Armut. Die Bemessung des Lebensstandards anhand ökonomischer Kennzahlen wird erörtert, die Grenzen dieser Methode aufgezeigt und die Ergebnisse der Politischen Philosophie herangezogen. Der Widerspruch zwischen objektiven ökonomischen Daten und der subjektiven Erfahrung von Armut wird hervorgehoben.
Welche Unterstützungsmaßnahmen werden diskutiert?
Die Arbeit stellt verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut in Deutschland vor und analysiert diese. Es werden wahrscheinlich Sozialhilfeleistungen, Arbeitsmarktpolitik und andere relevante politische Maßnahmen behandelt und deren Effektivität bewertet (dieser Abschnitt ist im vorliegenden Auszug jedoch nicht vollständig enthalten).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Kapitel zu Armutsbegriff und -formen, Entwicklung von Armut in Deutschland, Armutsrisikogruppen, einen Exkurs zur ökonomischen Betrachtungsweise und ein Kapitel zu Unterstützungsmaßnahmen. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Armut, Deutschland, Soziale Ungleichheit, Armutsrisikogruppen, Absolute Armut, Relative Armut, Neue Armut, Existenzminimum, Wohlstand, Sozialpolitik, Ökonomische Betrachtungsweise, Unterstützungsmaßnahmen, Soziale Polarisierung.
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist es, das Phänomen der Armut in Deutschland zu untersuchen und ein umfassendes Verständnis der verschiedenen Formen, Risikogruppen und der ökonomischen sowie politischen Aspekte zu vermitteln.
Welche These wird in der Einleitung aufgestellt?
Die Einleitung stellt die These auf, dass Armut in Deutschland trotz des hohen Wohlstands ein relevantes sozialpolitisches Problem darstellt, das lange Zeit verdrängt wurde. Der Begriff der „Neuen Armut“ wird eingeführt und die Notwendigkeit einer umfassenden Auseinandersetzung mit dem Thema betont.
- Arbeit zitieren
- Janine Simon (Autor:in), 2014, Armut in Deutschland. Formen, Risikogruppen und Entwicklung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318031