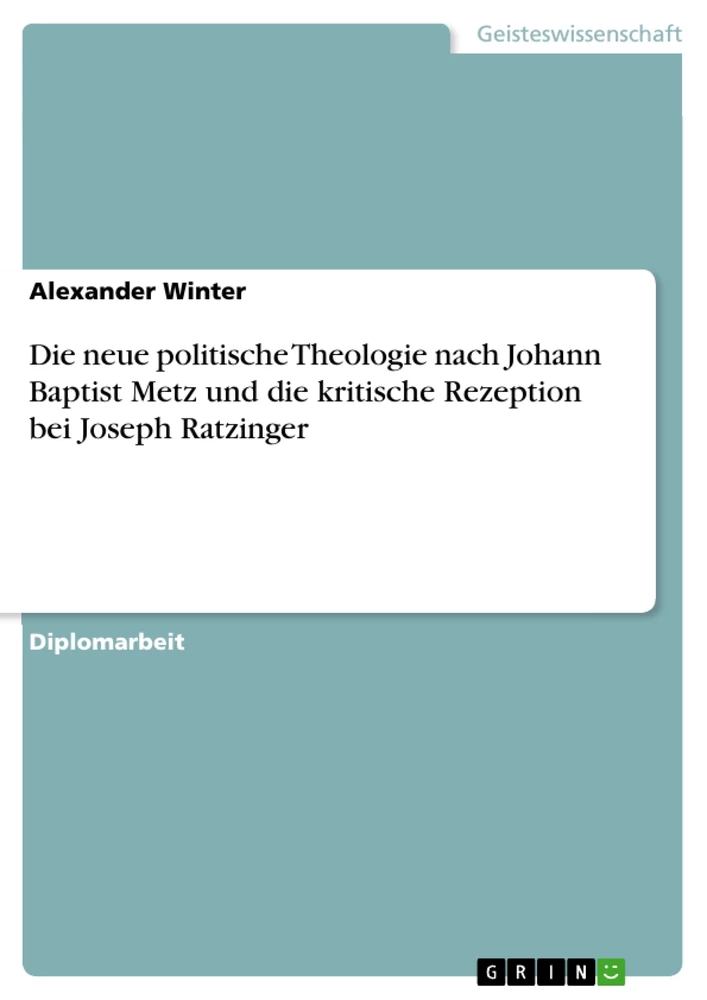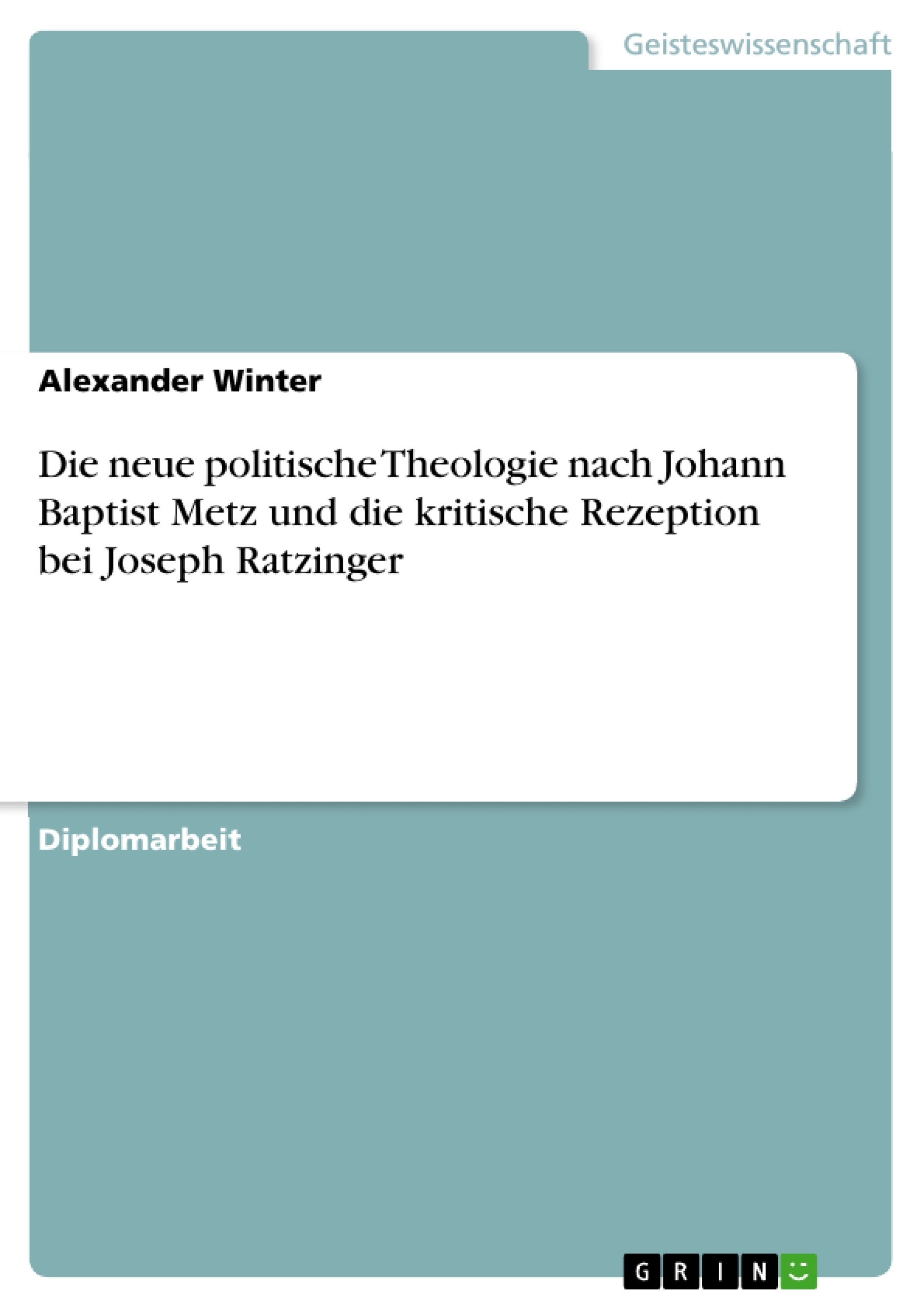Wäre es so einfach, gäbe es die Konflikte um die Verhältnisbestimmung von Staat und Kirche nicht, von denen schon die Zeugnisse aus dem Urchristentum sprechen. Inwiefern ist Erlösung Privatsache, inwiefern tangiert sie mein Umfeld? Was ist Erlösung eigentlich? Welche Rolle dürfen die Bindungen an Staat und Gesellschaft für einen Menschen spielen? Inwieweit wird das christliche Leben von weltlichen Institutionen, Gesetzen, Ländergrenzen, ethnischen Zugehörigkeiten und so weiter getragen, beeinflusst und bedrängt? Der Streit um das Götzenopferfleisch in der Korinther Gemeinde, der im Paulus-Brief belegt ist, ist nur einer unter vielen um den Bereich Glaube und politische Umwelt, die eine ganze Bandbreite an Fragen aufwerfen. Nicht zuletzt ist dabei zu untersuchen, ob es sich hierbei um einen echten oder lediglich theoretischen Dualismus von Glaube und Welt handelt.
Die Diskussion um die rechte Hermeneutik der biblischen Reich-Gottes-Botschaft hält bis heute an. Sie beginnt beim staatlichen Laizismus und endet bei theologischen Strömungen, die von absoluter politischer Enthaltsamkeit bis zur christlichen Politik reichen. In der Nachkriegszeit fallen besonders die verschiedenen Richtungen der politischen Theologien auf, die das Christ-Sein an der Anteilnahme an den Geschicken der Welt messen. Der eschatologische Erlösungsglaube wird dort stark mit dem weltlichen Handeln verknüpft. Mancherorts wird aus Jesus sogar wieder ein realpolitischer Verheißungsträger gemacht. Die Frage, wie der Christ sich in der Welt zu verhalten hat, wird umso drängender, wiewohl seine wirtschaftliche Existenz durch Ungerechtigkeitsregime bedrängt wird (Lateinamerika – Befreiungstheologie) oder seine Daseinsberechtigung inmitten einer zunehmend unchristlichen Gesellschaft angezweifelt wird und Selbstzweifel am eigenen Glaubensleben aufkommen lassen.
Letzteres ist das Thema des Münsteraner Fundamentaltheologen Johann Baptist Metz, der 1968 sein Konzept einer neuen politischen Theologie vorstellt. Seine Vorstellung von einem entprivatisierten Christentum, verknüpft mit Kritik an der bürgerlichen Religion, wird ein einflussreicher Bestandteil der theologischen Landschaft nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Zweiten Vatikanum. Die Entfaltung seiner Thesen führt Metz hin zu einer Forderung nach einer anamnetischen Vernunft des Glaubens, deren Orientierungspunkt das Leiden der Anderen sein soll. Die neue politische Theologie ist jedoch nicht unumstritten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- A. Politische Verantwortung in der Verkündigung Jesu
- B. Die neue politische Theologie nach Johann Baptist Metz und die kritische Rezeption bei Joseph Ratzinger
- I. Die neue politische Theologie bei Johann Baptist Metz
- 1. Die neue politische Theologie bei Johann Baptist Metz
- 2. Die neue politische Theologie – eine nachidealistische Theologie
- 3. Die Fehlentwicklungen der Kirche
- 4. Auf dem Weg zu einer neuen politischen Theologie
- 5. Neubestimmung des kirchlichen Selbstverständnisses
- II. Joseph Ratzingers kritische Auseinandersetzung mit der neuen politischen Theologie von Johann Baptist Metz
- 1. Ratzingers Kritik an einer verzeitlichten Eschatologie
- 2. Ratzingers Vorbehalte gegenüber der neuen politischen Theologie von Johann Baptist Metz
- 3. Der Vorschlag einer Politischen Ethik
- III. Die Begegnung von Ratzinger und Metz bei der Tagung von Ahaus 1998
- 1. Die Vermittlung von Zeit und Geschichte und das Autonomiestreben des Menschen
- 2. Der Stellenwert des Kreuzes in der Theologie bei Ratzinger und Metz
- 3. Leidensthematik und Gotteskrise
- 4. Der Ort der Theologie: Das „Elefantengedächtnis“ der Kirche
- c. Politische Theologie im Zeitalter der Globalisierung: Ein Ausblick
- I. Die neue politische Theologie bei Johann Baptist Metz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die neue politische Theologie Johann Baptist Metz' und deren kritische Rezeption durch Joseph Ratzinger. Ziel ist es, die zentralen Argumente beider Theologen zu vergleichen und die jeweiligen Perspektiven auf das Verhältnis von Glauben, Politik und Gesellschaft zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit der eschatologischen Dimension des Glaubens und deren Auswirkungen auf die politische Verantwortung des Christen.
- Politische Verantwortung des Christen im Kontext der Verkündigung Jesu
- Metz' neue politische Theologie: Konzept und Kritikpunkte
- Ratzingers kritische Auseinandersetzung mit Metz' Theologie
- Das Verhältnis von Eschatologie und Politik
- Die Rolle der Kirche in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
A. Politische Verantwortung in der Verkündigung Jesu: Dieser Abschnitt analysiert Jesu Antwort auf die Frage nach der Steuerzahlung an den römischen Kaiser. Er beleuchtet den vermeintlichen Loyalitätskonflikt zwischen Kaiser und Gott und zeigt, wie Jesus diesen Konflikt auflöst, indem er die Notwendigkeit der Steuerzahlung betont, gleichzeitig aber die Überlegenheit des Glaubensgehorsams gegenüber weltlichen Autoritäten hervorhebt. Die Analyse geht auf die messianischen Erwartungen der Juden ein und zeigt, dass Jesus nicht den Erwartungen eines politischen Retters entsprach. Der Abschnitt schließt mit der Feststellung, dass die Frage nach dem richtigen Verhältnis von Glauben und politischer Verantwortung bis heute relevant ist und zu unterschiedlichen theologischen Strömungen geführt hat, von absoluter politischer Enthaltsamkeit bis hin zu christlicher Politik.
B. Die neue politische Theologie nach Johann Baptist Metz und die kritische Rezeption bei Joseph Ratzinger: Dieser Abschnitt bietet eine umfassende Übersicht über die Arbeit. Er präsentiert die neue politische Theologie von Johann Baptist Metz, ihre zentralen Aspekte wie die Entprivatisierung des Christentums und die Kritik an der bürgerlichen Religion. Weiterhin werden die wichtigsten Punkte der kritischen Auseinandersetzung Joseph Ratzingers mit Metz' Theologie behandelt, inklusive seiner Vorbehalte gegenüber einer verzeitlichten Eschatologie und der politischen Vereinnahmung der christlichen Hoffnung. Der Abschnitt führt die beiden Theologen schließlich in ihrer Begegnung auf der Tagung von Ahaus 1998 zusammen.
Schlüsselwörter
Neue politische Theologie, Johann Baptist Metz, Joseph Ratzinger, Eschatologie, Politik, Kirche, Gesellschaft, Verantwortung, Christentum, bürgerliche Religion, Anamnetische Vernunft, Befreiungstheologie, Zeit und Geschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Neue Politische Theologie nach Metz und ihre Rezeption bei Ratzinger"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die „Neue Politische Theologie“ von Johann Baptist Metz und deren kritische Rezeption durch Joseph Ratzinger. Sie vergleicht die zentralen Argumente beider Theologen und beleuchtet ihre jeweiligen Perspektiven auf das Verhältnis von Glauben, Politik und Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf die eschatologische Dimension des Glaubens und dessen Auswirkungen auf die politische Verantwortung des Christen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Die politische Verantwortung des Christen im Kontext der Verkündigung Jesu; Metz' neue politische Theologie, einschließlich ihrer Konzepte und Kritikpunkte; Ratzingers kritische Auseinandersetzung mit Metz' Theologie; das Verhältnis von Eschatologie und Politik; und die Rolle der Kirche in der Gesellschaft. Ein besonderer Fokus liegt auf der Begegnung von Ratzinger und Metz auf der Tagung in Ahaus 1998.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile: Teil A analysiert die politische Verantwortung in der Verkündigung Jesu. Teil B bietet eine umfassende Darstellung der neuen politischen Theologie nach Metz, Ratzingers Kritik daran und die Begegnung der beiden Theologen in Ahaus 1998. Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte sowie eine Liste der Schlüsselwörter.
Was sind die zentralen Argumente von Johann Baptist Metz?
Metz' neue politische Theologie zielt auf eine „Entprivatisierung“ des Christentums und eine Kritik an der „bürgerlichen Religion“. Zentrale Aspekte sind die Auseinandersetzung mit der eschatologischen Dimension des Glaubens und deren Implikationen für das politische Handeln. Die Arbeit beleuchtet die Konzepte und Kritikpunkte dieser Theologie.
Wie kritisiert Joseph Ratzinger Metz' Theologie?
Ratzinger kritisiert vor allem Metz' verzeitlichte Eschatologie und die Gefahr einer politischen Vereinnahmung der christlichen Hoffnung. Die Arbeit beschreibt detailliert die Punkte, in denen Ratzinger mit Metz' Theologie nicht übereinstimmt und seinen Vorschlag einer politischen Ethik.
Welche Rolle spielt die Eschatologie in der Arbeit?
Die eschatologische Dimension des Glaubens, also die Hoffnung auf das Kommende, ist ein zentraler Aspekt der Arbeit. Sie untersucht, wie diese Hoffnung die politische Verantwortung des Christen beeinflusst und wie Metz und Ratzinger diese Thematik unterschiedlich behandeln.
Was ist das Ergebnis der Begegnung zwischen Metz und Ratzinger in Ahaus 1998?
Die Arbeit beschreibt die Begegnung von Metz und Ratzinger in Ahaus 1998 und analysiert ihre unterschiedlichen Positionen zu zentralen theologischen Fragen wie der Vermittlung von Zeit und Geschichte, dem Stellenwert des Kreuzes und der Rolle der Kirche. Die spezifischen Ergebnisse dieser Begegnung werden detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Neue politische Theologie, Johann Baptist Metz, Joseph Ratzinger, Eschatologie, Politik, Kirche, Gesellschaft, Verantwortung, Christentum, bürgerliche Religion, anamnetische Vernunft, Befreiungstheologie, Zeit und Geschichte.
- Quote paper
- Alexander Winter (Author), 2015, Die neue politische Theologie nach Johann Baptist Metz und die kritische Rezeption bei Joseph Ratzinger, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317777