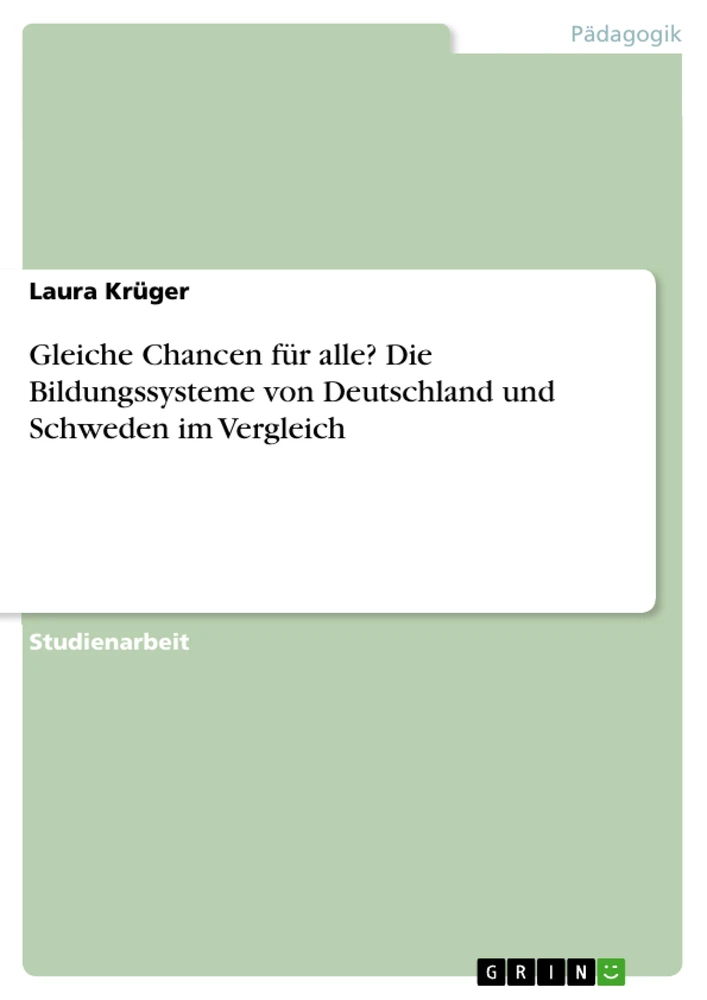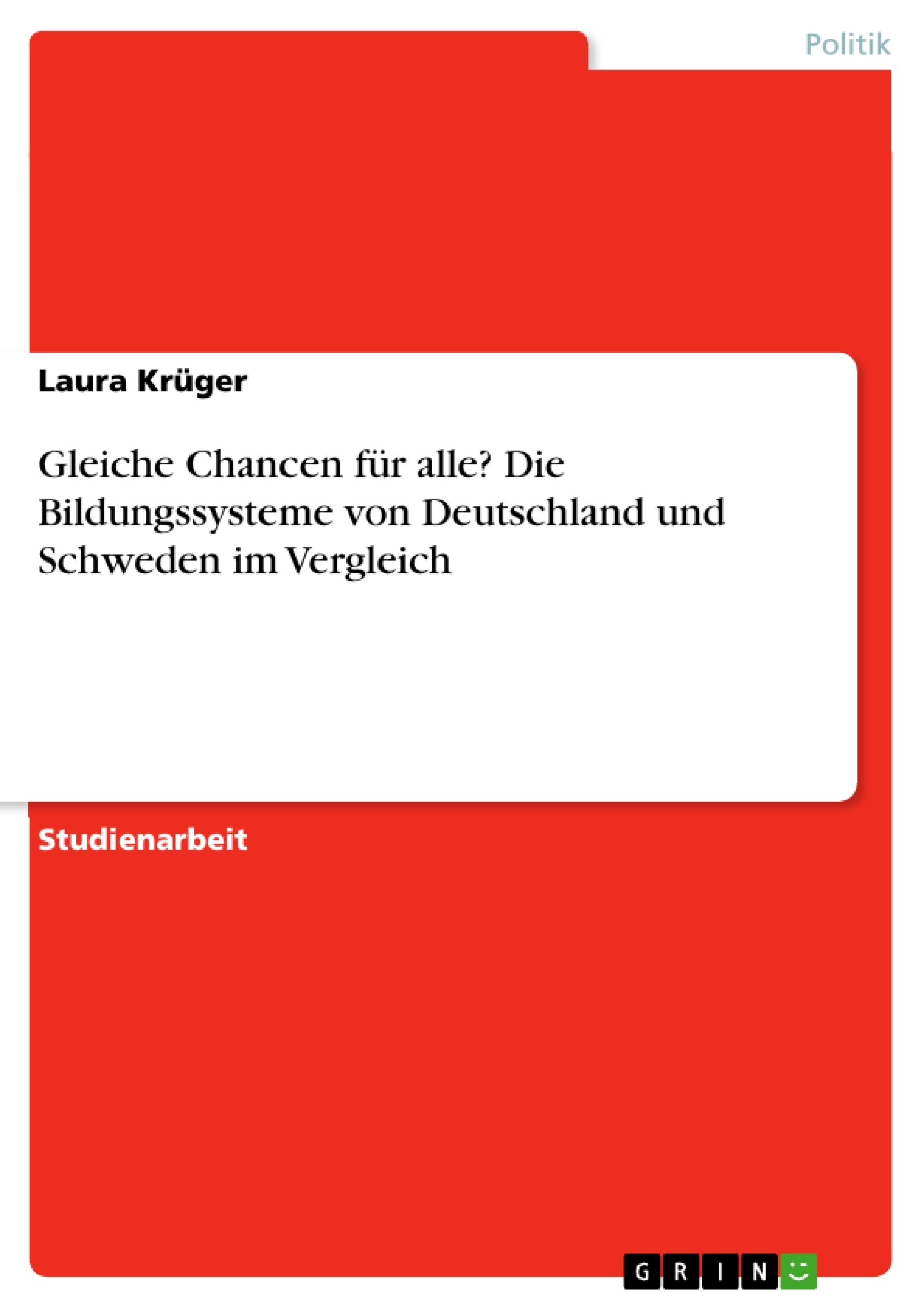Diese Arbeit befasst sich mit den Bildungssystemen in Schweden und Deutschland. Ziel ist es herauszufinden, wie es Schweden gelingt, eine hohe Chancengleichheit zu schaffen und ob beziehungsweise was auch Deutschland von dieser Politik lernen könnte.
Bereits John F. Kennedy stellte während seiner Amtszeit in einer seiner Reden fest, wie wichtig die Bildung für einen jungen Menschen ist. Es ist bis heute unbestritten, dass Bildung zu einer der wichtigsten Aufgaben eines jeden Landes zählt. Bildung ist ein unumgängliches Gut, welches entscheidend ist für den Lebensweg eines Individuums.
Bildungspolitik ist keine reine politische Angelegenheit mehr, denn die sozialen und gesellschaftlichen Aspekte stehen in einem direkten Zusammenhang mit ihr. In Deutschland hat man bis heute mit dem schlechten Abschneiden bei der PISA-Studie (Programme for International Student Assessment) im Jahr 2000 zu kämpfen. Die Kritik der Bildungsforscher, Lehrer und auch Eltern ist umfassend. Es ist die Rede von einem längst „überholten System“ und „mangelnder Chancengleichheit“, insbesondere für Schüler mit Migrationshintergrund.
Betrachtet man die Bildungssysteme anderer Länder, fallen insbesondere die skandinavischen Länder positiv auf. Schweden beispielsweise gilt seit Jahrzehnten als eine Art „Vorbild“, da es die Einwanderer deutlich besser integrieren konnte, als es Deutschland bis heute kann. Exemplarisch dafür ist unter anderem die Lesekompetenz, die deutlich ausgeprägter ist. Hinzu kommt, dass die Leistungsspanne der Schüler keine so enorme Diskrepanz besitzt, wie es in Deutschland der Fall ist.
Im Folgenden werden einerseits die PISA-Ergebnisse betrachtet, ein kurzer Vergleich der Bildungspolitik beider Länder durchgeführt sowie die gegenwärtigen Besonderheiten der Bildungspolitik erläutert. Abschließend wird die Chancengleichheit betrachtet und bewertet und ein Ausblick in die Zukunft geworfen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bildungssysteme in Schweden und Deutschland – Ein Vergleich
- Chancengleichheit im skandinavischen Bildungswesen?
- Chancengleichheit in Schweden?
- Chancengleichheit in Deutschland?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Bildungspolitik in Schweden und Deutschland, insbesondere im Hinblick auf die Frage der Chancengleichheit. Es wird untersucht, wie Schweden eine hohe Chancengleichheit im Bildungsbereich erreicht hat und welche Lehren Deutschland daraus ziehen könnte.
- Vergleich der Bildungspolitik in Schweden und Deutschland
- Chancengleichheit in Schweden und Deutschland im Kontext der PISA-Studie
- Analyse der vorschulischen Bildung in beiden Ländern
- Bewertung der Rolle der Ganztagsschule für Chancengleichheit
- Bedeutung von Bildungsinvestitionen für Chancengleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema Bildung und Chancengleichheit ein und stellt die Relevanz der Thematik anhand von aktuellen Herausforderungen in Deutschland dar. Des Weiteren wird die Rolle der PISA-Studie hervorgehoben und Schweden als mögliches Vorbild im Bereich der Bildungspolitik vorgestellt.
- Das zweite Kapitel vergleicht die Bildungssysteme in Schweden und Deutschland, wobei die Unterschiede in der vorschulischen Bildung sowie im Verhältnis zur Sozialpolitik besonders beleuchtet werden. Es werden die Entwicklungen und Herausforderungen in beiden Ländern im Kontext der jeweiligen Bildungspolitik diskutiert.
- Das dritte Kapitel befasst sich mit der Frage der Chancengleichheit im skandinavischen Bildungswesen und diskutiert verschiedene Konzepte und Ansätze, die in Schweden zu einer hohen Chancengleichheit führen. Es werden die spezifischen Aspekte der schwedischen Bildungspolitik herausgestellt, die in Deutschland als Vorbild dienen könnten.
Schlüsselwörter
Bildungspolitik, Chancengleichheit, Schweden, Deutschland, PISA-Studie, vorschulische Bildung, Ganztagsschule, Sozialpolitik, Einheitsstruktur, föderales System, Investitionen in Bildung, Lebenslanges Lernen.
- Quote paper
- Laura Krüger (Author), 2013, Gleiche Chancen für alle? Die Bildungssysteme von Deutschland und Schweden im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317765