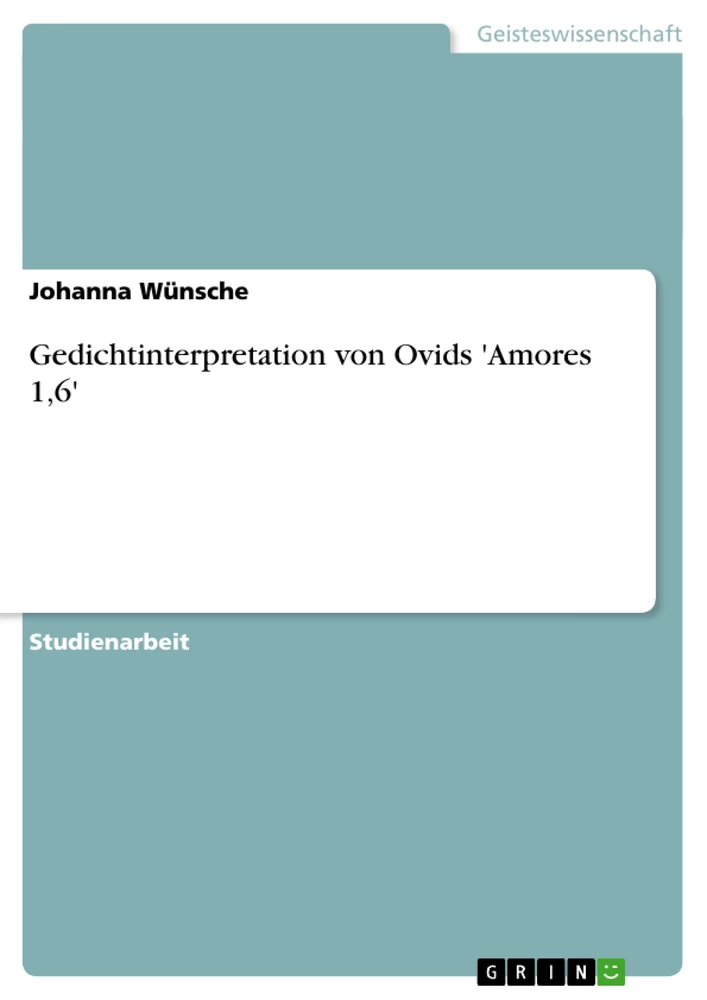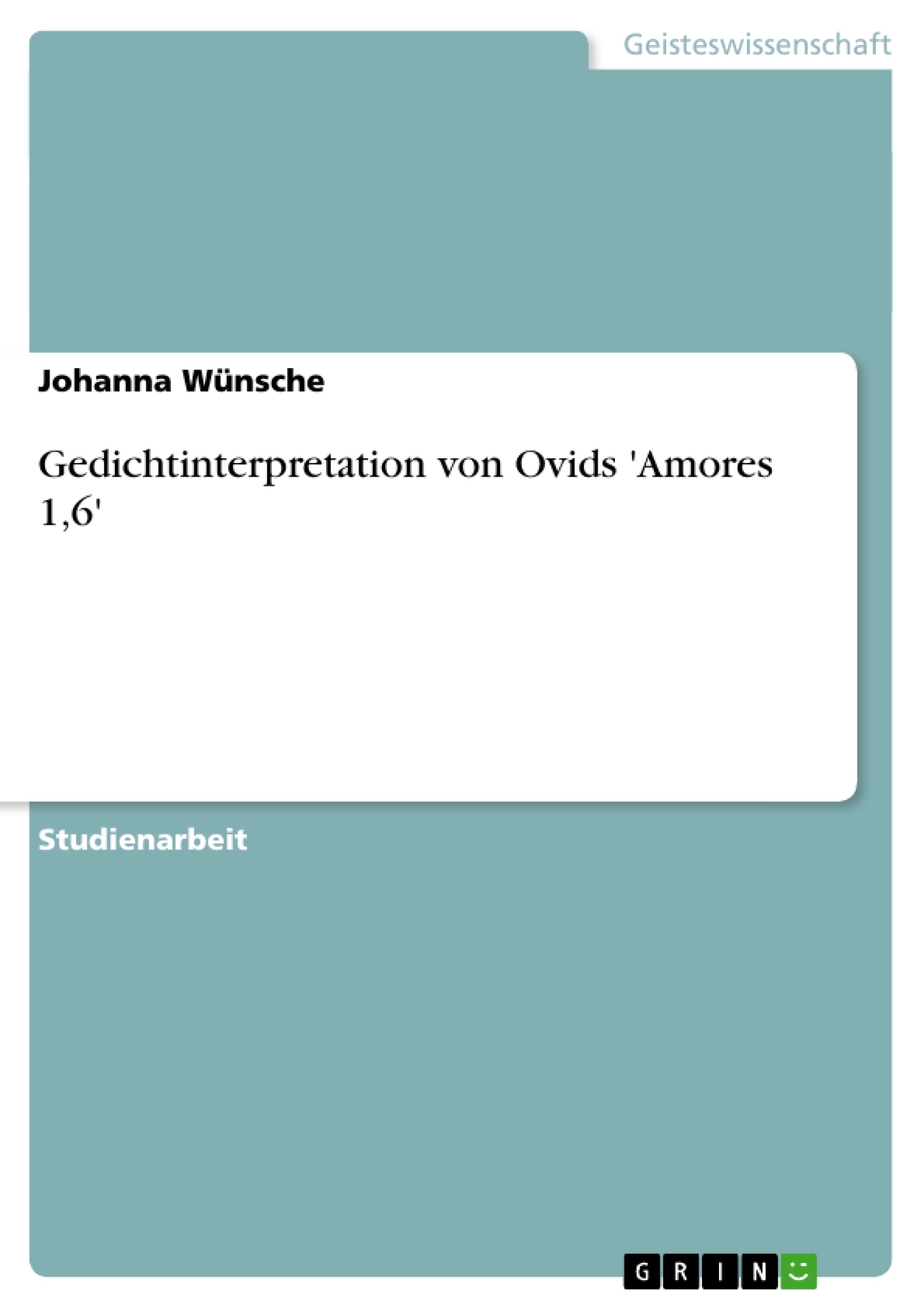[...] Diese allgemeinen Charakteristika lassen sich auch
bei Ovid finden. Während in der vorovidischen Dichtung das Pathos der Liebe und
des willkürlich- unerbittlichen Liebesgottes auf ernsthafte Weise behandelt wurde ,
fasst Ovid Liebe als ein nicht so ernst zu nehmendes Spiel auf, das durch die Regeln
und Topoi der Vorgänger schon festgelegt ist2. Brooks Otis sieht Ovids Liebeselegie
sogar als eine „reductio ad absurdum“ der Gattung wie sie für Properz und Tibull
charakteristisch war, die sich durch „Umschweife und irreführende Ernsthaftigkeit“3
auszeichnet. Ovid entwickelt das Thema in Anlehnung an Tibull und Properz, die
zum tragischen Genus tendierten, zwar spielerisch und komisch, aber mit dennoch
täuschend echter Ernsthaftigkeit.
Die Amores bestehen, so wie sie uns in der zweiten Ausgabe überliefert sind, aus
drei Büchern. Von den fünfzehn Gedichten des ersten Buches sind die Elegien zwei
bis sieben und neun bis vierzehn thematisch parallel angeordnet; sie werden umrahmt
von den Programmgedichten eins, acht und fünfzehn4. Der Grund für das Verfassen
einer Elegie (am. 1.1) ist der Liebesgott Amor, der ein Versmaß stahl und den
Dichter mit einem Liebespfeil traf, so dass dieser von seinem Vorhaben ein Epos zu
schreiben abkam und sich in Corinna verliebte. So wie sich die Erfüllung in der
Liebe (1.5) und die Absage (1.12) gegenüberstehen, so entsprechen sich auch die
Elegie 1.6, die hier genauer analysiert werden soll, mit der nächtlichen Klage vor der
Tür der Geliebten und die Elegie 1.13 mit dem Abschied am Morgen.
Im folgenden möchte ich zeigen wie Ovid das bekannte Motiv des Paraklausithyron
auf äußerst witzige, amüsante Weise entwickelt, indem er den exclusus amator
lächerlich macht, und doch oberflächlich die Ernsthaftigkeit eines Properz oder
Tibull bewahrt. Dabei zeichnen vor allem die Verwendung eines Refrains und die
starken Kontraste innerhalb des Gedichtes das nach Erich Reitzenstein „neue
Kunstwollen“ des Dichters aus.
2 Reitzenstein, Erich: Das neue Kunstwollen in den Amores Ovids. in: Michael von Albrecht, Ernst
Zinn (Hg.) : Ovid. 1. Auflage. Darmstadt 1968 (Wege der Forschung 92). S. 210ff.
3 Otis, Brooks: Ovids Liebesdichtungen und die augusteische Zeit. in: Michael von Albrecht, Ernst
Zinn (Hg.) : Ovid. 1. Auflage. Darmstadt 1968 (Wege der Forschung 92). S.237.
4 P. Ovidius Naso: Amores. Liebesgedichte. Lateinisch und Deutsch von Michael von Albrecht.
Stuttgart 1997.S. 232.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Analyse- Die ovidische Liebeselegie
- Verse 1-31
- Die Verse 32-48
- Der Refrain
- Amor, Waffen und Wein- Verse 33 bis 39
- Die Enttäuschung und der Schlaf des ianitor – Verse 40 bis 46
- Das schwere Los des Liebenden: amica et sors - Verse 45 bis 48
- Zusammenfassung: Das Spiel mit der Liebe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Analyse ist es, die ovidische Liebeselegie, insbesondere die Elegie 1.6 aus Ovids Amores, anhand ihrer Sprache und formalen Elemente zu untersuchen. Im Fokus steht die Analyse des Motivs des Paraklausithyron sowie die Darstellung von Ovids eigenem „neuen Kunstwollen“ im Umgang mit der traditionellen Liebeselegie.
- Die ovidische Liebeselegie als „reductio ad absurdum“ der klassischen Elegie
- Das Paraklausithyron als komisches Motiv
- Die Bedeutung des Refrains in der Elegie 1.6
- Ovids Verwendung von Sprache und Form als Mittel zur Gestaltung von Bedeutung
- Das Verhältnis von Ernsthaftigkeit und Spiel in Ovids Liebesgedichten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung erläutert die ovidische Liebeselegie im Kontext der römischen Liebesdichtung und stellt Ovids besondere Position innerhalb der Gattung heraus. Sie beleuchtet die charakteristischen Elemente der Liebeselegie, wie den elegischen Distichon und das servitium amoris, und verweist auf die Unterschiede zwischen Ovids Werk und den traditionellen Elegien von Properz und Tibull.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Versen 1-31 der Elegie 1.6. Es werden die Situation des exclusus amator, seine vergeblichen Bemühungen um Einlass bei der Geliebten und die komische Darstellung des Sklaven als Türhüter analysiert. Die Rolle des elegischen Ichs im Kontext des Paraklausithyron wird beleuchtet, und Ovids humorvolle Auseinandersetzung mit dem traditionellen Motiv wird hervorgehoben.
Das dritte Kapitel widmet sich den Versen 32-48 und analysiert das Auftreten des Refrains. Es wird gezeigt, wie Ovid durch die Verwendung eines Refrains, die Parallelität von Metrik und Klang sowie die Wiederholung des Verses eine magische Wirkung erzeugt. Die Interpretation des Refrains im Kontext des Paraklausithyron und die Bedeutung der Tür als postis in re amatoria werden erläutert.
Schlüsselwörter
Ovid, Liebeselegie, Paraklausithyron, exclusus amator, Refrain, Metrik, Klang, Amor, servitium amoris, Properz, Tibull, komisches Motiv, „neues Kunstwollen“, magische Wirkung, postis in re amatoria.
- Quote paper
- Johanna Wünsche (Author), 2002, Gedichtinterpretation von Ovids 'Amores 1,6', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31767