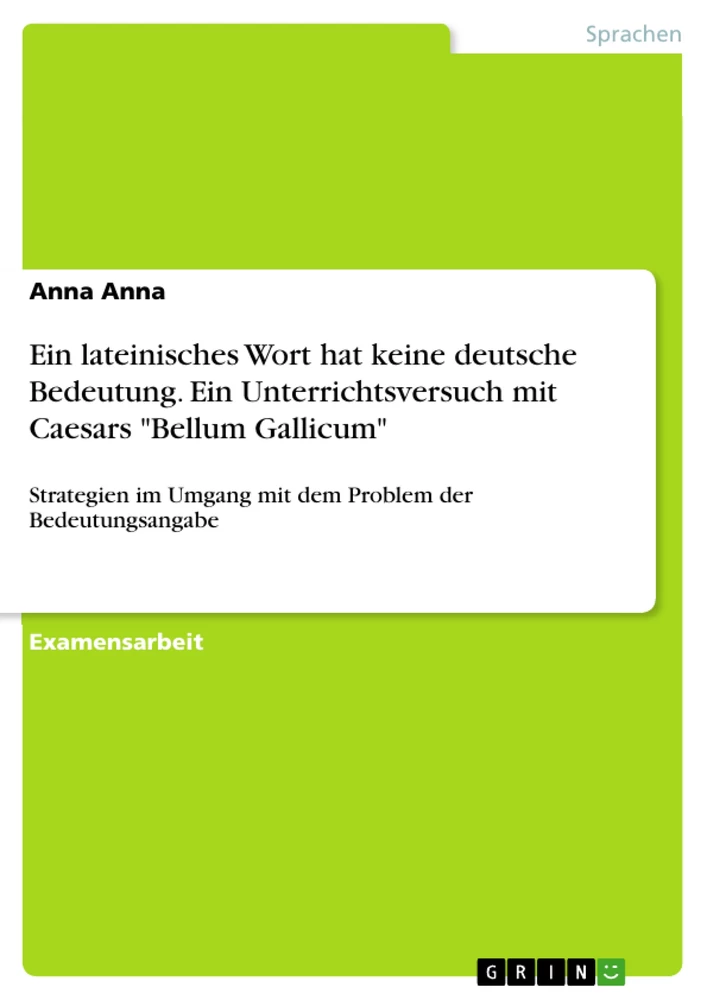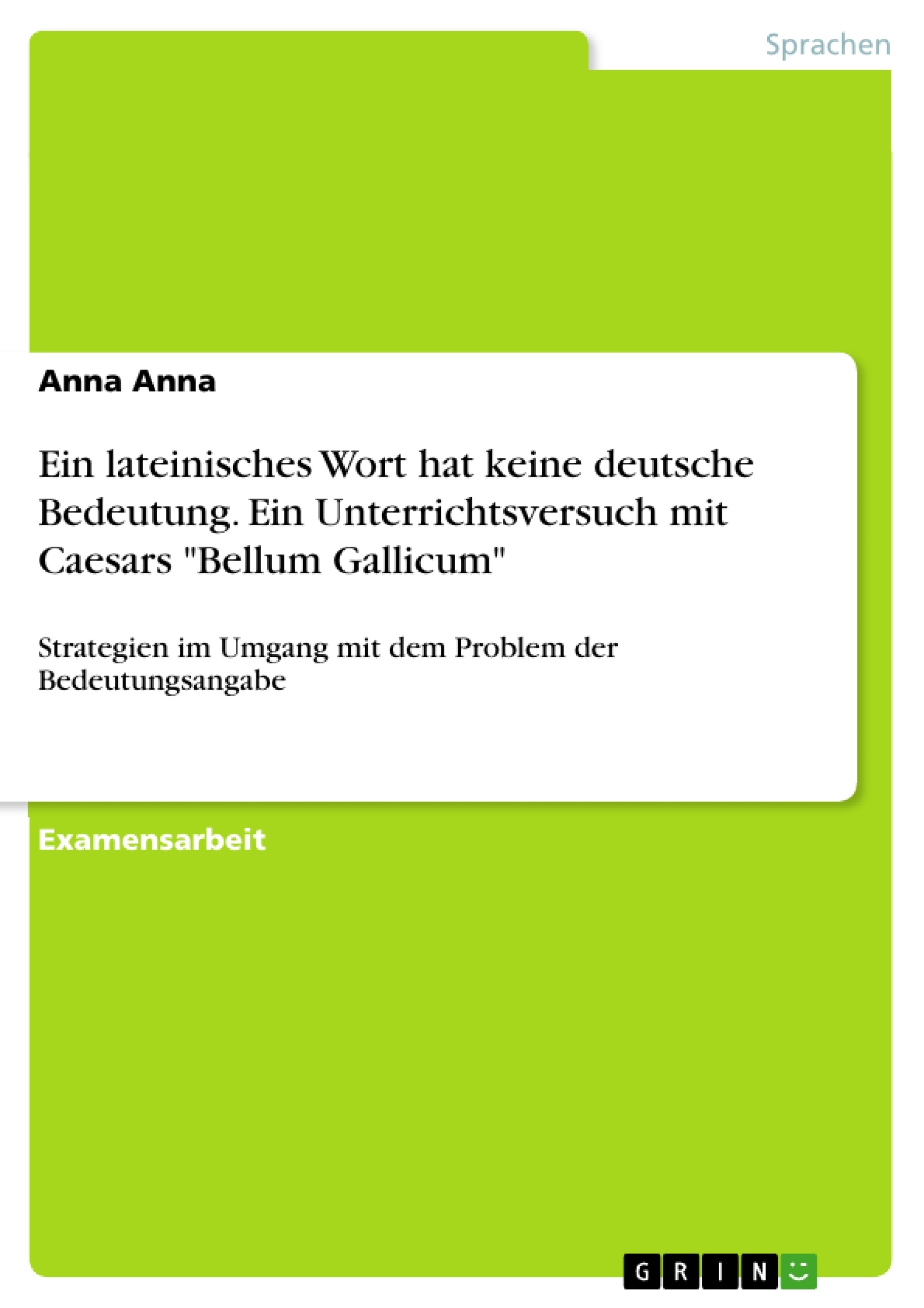„Ein lateinisches Wort hat keine Bedeutung.“ Mit dieser knappen Formulierung hat Steinthal in einem häufig zitierten Aufsatz, der in der AU im Jahre 1971 erschienen ist, die Problematik von Wortgleichungen aufgezeigt. Damit meint er nicht nur Wörter, die
(wie z.B. tibia, aquaeductus, familia) in ihren deutschen Bezeichnungen bei den Schülerinnen und Schülern eine gänzlich andere Vorstellung hervorrufen als das, was die Römer darunter verstanden haben. Für Steinthal gilt grundsätzlich, dass die
„Bedeutungsangabe mit einem deutschen Wort ein bloßes Surrogat ist.“ „Präzise ist nur die konkrete Meinung im Kontext und der Sprechsituation.“ Demzufolge wird die Bedeutung des lateinischen Wortes lediglich mit einer deutschen Bedeutung
paraphrasiert. Dennoch wird sich nicht vermeiden lassen, für lateinische Wörter Bedeutungsangaben im Sinne eines vorläufigen Äquivalents zu machen. Wenn man folglich nicht auf Vokabellernen mit Hilfe muttersprachlicher Bedeutungsangaben
gänzlich verzichten kann, ergibt sich für die Wortschatzarbeit im Lateinunterricht dringender Handlungsbedarf.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Einbettung des Themas in die Forschungsdiskussion
- Darstellung der Unterrichtspraxis
- Lernausgangslage
- Konzeption der Unterrichtseinheit
- Ausgewählte Aspekte aus der Unterrichtspraxis
- Evaluation
- Methode und eingesetztes Verfahren
- Eigene Unterrichtsbeobachtungen
- Ergebnisse aus den Fragebögen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Schwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern beim Übersetzen lateinischer Texte aufgrund der Mehrdeutigkeit lateinischer Wörter und der damit verbundenen Problematik der Bedeutungsangabe im Deutschen. Der Fokus liegt auf einem Unterrichtsversuch, der Strategien zur Bewältigung dieser Herausforderungen im Kontext der Lektüre von Caesars „Bellum Gallicum“ erprobt.
- Schwierigkeiten bei der Bedeutungszuweisung lateinischer Wörter im Kontext.
- Der Einfluss von Kontext und Kollokationen auf die Bedeutung von Wörtern.
- Entwicklung und Erprobung von Strategien zur Verbesserung des Übersetzungsprozesses.
- Evaluation des Unterrichtsversuchs mittels Beobachtung und Fragebögen.
- Beitrag zur Didaktik des Lateinunterrichts, insbesondere der Wortschatzarbeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Problemstellung: Diese Einleitung beschreibt die zentrale Problematik der Arbeit: die Schwierigkeiten von Schülern beim Übersetzen lateinischer Texte aufgrund der Mehrdeutigkeit lateinischer Wörter und der Problematik, passende deutsche Äquivalente zu finden. Der Autor veranschaulicht dies anhand von Beispielen aus seiner Unterrichtspraxis und zitiert Steinthal, der die Unmöglichkeit einer direkten Wort-für-Wort-Übersetzung betont. Die Arbeit beschreibt einen Unterrichtsversuch, der Methoden zur Verbesserung des Umgangs mit dieser Problematik erproben soll.
Einbettung des Themas in die Forschungsdiskussion: Dieses Kapitel bettet die Problematik der Wortbedeutung im Lateinunterricht in den Kontext der didaktischen Forschung ein. Es wird die Bedeutung des Wortschatzerwerbs für das Textverständnis hervorgehoben und auf die Notwendigkeit eingegangen, dass Schüler nicht nur Vokabeln lernen, sondern auch den Kontext und die vielfältigen Bedeutungen eines Wortes berücksichtigen müssen. Der Autor diskutiert verschiedene Ansätze aus der Fachliteratur und verortet seine eigene Arbeit in diesem Forschungsfeld.
Darstellung der Unterrichtspraxis: Dieses Kapitel beschreibt den durchgeführten Unterrichtsversuch. Es werden die Lerngruppe, die didaktischen Ziele und die konkreten methodischen Vorgehensweisen detailliert dargestellt. Der Autor erläutert die Konzeption seiner Unterrichtseinheit, die darauf abzielt, das Bewusstsein der Schüler für die Bedeutungsunterschiede und die Rolle des Kontextes zu schärfen. Es werden ausgewählte Aspekte der Unterrichtspraxis beleuchtet, welche die praktische Umsetzung der Konzepte verdeutlichen.
Evaluation: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Evaluation des Unterrichtsversuchs. Es werden die eingesetzten Methoden (Beobachtung und Fragebögen) detailliert beschrieben und die Ergebnisse ausgewertet. Der Autor analysiert seine eigenen Beobachtungen im Unterricht und die Rückmeldungen der Schüler aus den Fragebögen, um die Wirksamkeit der eingesetzten Strategien zu beurteilen.
Schlüsselwörter
Lateinunterricht, Wortschatzarbeit, Bedeutungsangabe, Kontext, Kollokation, Übersetzungskompetenz, Unterrichtsversuch, „Bellum Gallicum“, Caesar, Mehrdeutigkeit, Bedeutungsunterschiede, Didaktik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Schwierigkeiten beim Übersetzen lateinischer Texte
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Schwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern beim Übersetzen lateinischer Texte aufgrund der Mehrdeutigkeit lateinischer Wörter und der damit verbundenen Problematik der Bedeutungsangabe im Deutschen. Der Fokus liegt auf einem Unterrichtsversuch, der Strategien zur Bewältigung dieser Herausforderungen im Kontext der Lektüre von Caesars „Bellum Gallicum“ erprobt.
Welche Aspekte werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Schwierigkeiten bei der Bedeutungszuweisung lateinischer Wörter im Kontext, den Einfluss von Kontext und Kollokationen auf die Bedeutung, die Entwicklung und Erprobung von Strategien zur Verbesserung des Übersetzungsprozesses, die Evaluation des Unterrichtsversuchs mittels Beobachtung und Fragebögen und den Beitrag zur Didaktik des Lateinunterrichts, insbesondere der Wortschatzarbeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in die Kapitel „Problemstellung“, „Einbettung des Themas in die Forschungsdiskussion“, „Darstellung der Unterrichtspraxis“ (mit Unterpunkten Lernausgangslage, Konzeption der Unterrichtseinheit und Ausgewählte Aspekte aus der Unterrichtspraxis), „Evaluation“ (mit Unterpunkten Methode und eingesetztes Verfahren, Eigene Unterrichtsbeobachtungen und Ergebnisse aus den Fragebögen) und „Fazit und Ausblick“ gegliedert.
Welche Methoden wurden zur Evaluation eingesetzt?
Zur Evaluation des Unterrichtsversuchs wurden Beobachtungen im Unterricht und Fragebögen eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Methoden werden analysiert und ausgewertet, um die Wirksamkeit der Strategien zu beurteilen.
Welche konkreten Schwierigkeiten beim Übersetzen werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Mehrdeutigkeit lateinischer Wörter und die daraus resultierende Problematik, passende deutsche Äquivalente zu finden. Es wird die Bedeutung des Kontextverständnisses und der Kollokationen für die korrekte Übersetzung betont.
Welche Rolle spielt der Kontext beim Übersetzen?
Der Kontext spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit hebt die Notwendigkeit hervor, dass Schüler nicht nur einzelne Vokabeln lernen, sondern auch den Kontext und die vielfältigen Bedeutungen eines Wortes im Zusammenhang berücksichtigen müssen.
Welche Literatur wird herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Ansätze aus der Fachliteratur zur Didaktik des Lateinunterrichts und verortet den eigenen Forschungsansatz in diesem Kontext. Steinthal wird beispielsweise zitiert, der die Unmöglichkeit einer direkten Wort-für-Wort-Übersetzung betont.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lateinunterricht, Wortschatzarbeit, Bedeutungsangabe, Kontext, Kollokation, Übersetzungskompetenz, Unterrichtsversuch, „Bellum Gallicum“, Caesar, Mehrdeutigkeit, Bedeutungsunterschiede, Didaktik.
Welches Werk von Caesar steht im Mittelpunkt des Unterrichtsversuchs?
Der Unterrichtsversuch konzentriert sich auf die Lektüre von Caesars „Bellum Gallicum“.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Strategien zur Verbesserung des Übersetzungsprozesses lateinischer Texte zu entwickeln und zu erproben sowie einen Beitrag zur Didaktik des Lateinunterrichts, insbesondere zur Wortschatzarbeit, zu leisten.
- Quote paper
- Anna Anna (Author), 2015, Ein lateinisches Wort hat keine deutsche Bedeutung. Ein Unterrichtsversuch mit Caesars "Bellum Gallicum", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317504