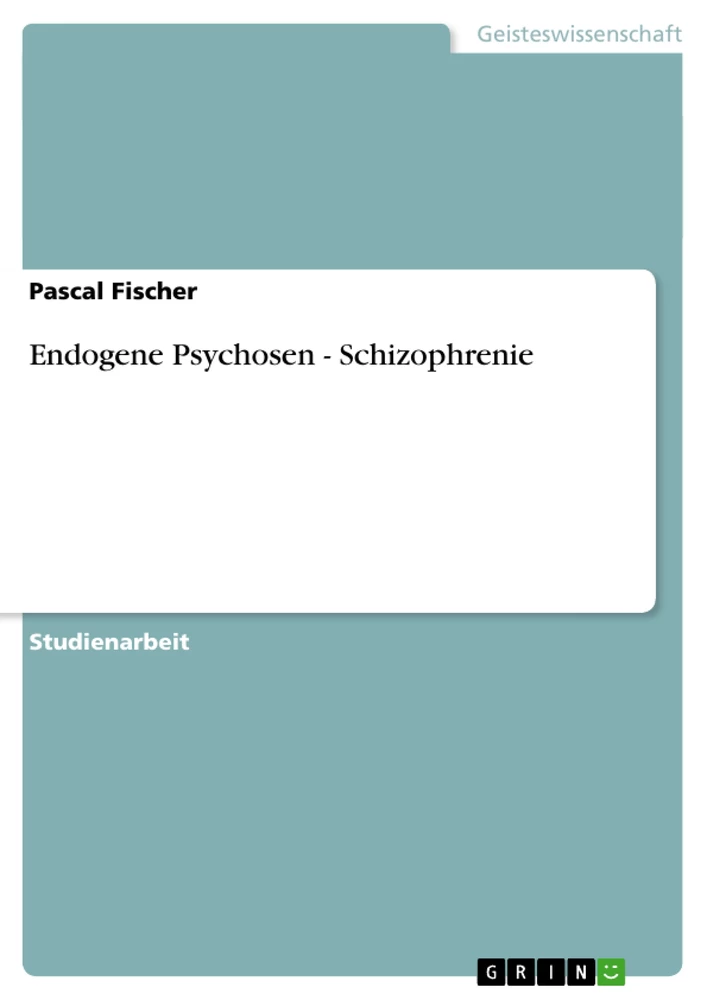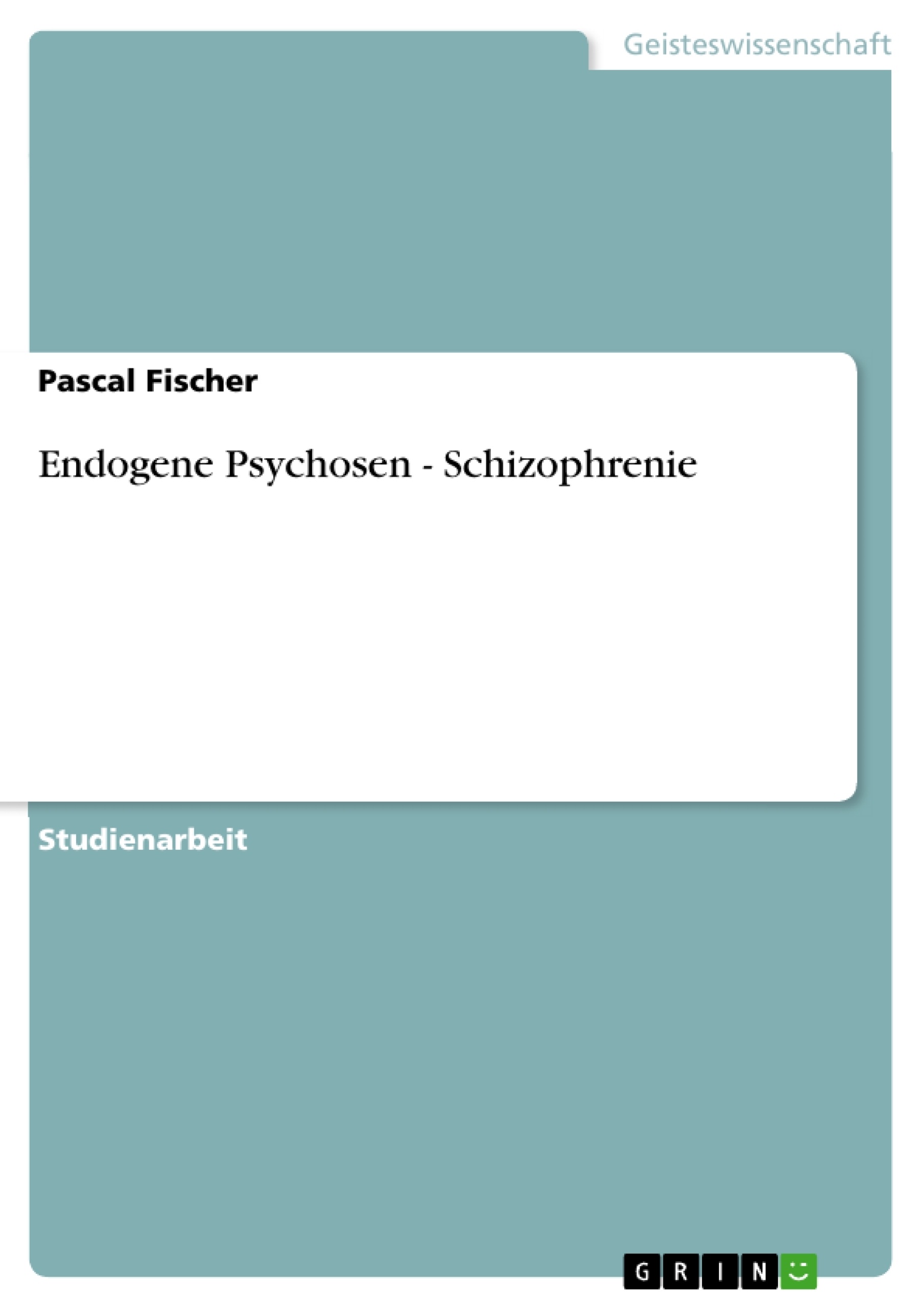Erfreulicherweise ist die Schizophrenie keine typische Erkrankung des Kindesalters, sondern
beginnt meist erst nach Abschluss der Schullaufbahn. Jedoch beginnt eine Schizophrenie
selten ohne Frühwarnzeichen – die sogenannten Prodromalerscheinungen. Diese genau
belegen zu können (Auftreten, Dauer, Umstände etc.), ist eine wichtige Aufgabe für
Pädagogen und Eltern um eine sichere und zuverlässige Diagnose zu erhalten, jedoch vor
allem die frühzeitige Intervention und Prävention zum Erfolg zu führen.
Entgegen der weitläufigen Annahme ist Schizophrenie nämlich durchaus mit Erfolg
behandelbar!
Diese Handreichung bietet Lehrkräften, BeratungslehrerInnen und an der Thematik
Interessierten eine detaillierte Information über das Störungsbild der Schizophrenie und die
Interventionsmöglichkeiten. Daneben beschäftigt sie sich mit der Frage, wie schizophrene
Störungen oder ihre Prodromalerscheinungen Schule und Unterricht beeinflussen und welche
pädagogischen Konsequenzen sich daraus lesen lassen.
Die Handreichung soll eine Unterstützung sein für einen professionellen Umgang mit dem
Thema Schizophrenie in Schule und Beratung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beschreibung des Krankheitsbildes
- Historischer Rückblick
- Epidemiologie
- Ätiologie der Schizophrenie
- Biologische Faktoren
- Psychosoziale Faktoren
- Vulnerabilitätsmodell
- Symptome
- Allgemeine Symptomatik
- Spezifische Symptomatik
- Symptome im Kleinkind- und Grundschulalter
- Symptome in der späten Kindheit und Präadoleszenz
- Symptome im Jugendalter
- Diagnose
- Lebensalltag mit der Krankheit
- Verlauf
- Stigmatisierung
- Berichte von Betroffenen
- Therapie der Schizophrenie
- Somatotherapie
- Psychotherapie
- Flankierende Maßnahmen
- Prognose
- Schulalltag mit der Krankheit
- Kognitive Ebene
- Motorische Ebene
- Sozial-Emotionale Ebene
- Konsequenzen und Tipps für Pädagogen
- Ansetzend an den Lehrkräften
- Lehrmethode und pädagogisches Vorgehen
- Lernumwelt „Schule“
- Außerschulische Ansatzpunkte
- Zusammenfassung
- Unterrichtsmaterialien
- Adressen
- Internetseiten
- Verbände und Selbsthilfegruppen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Handreichung zielt darauf ab, Lehrkräften und Interessierten detaillierte Informationen über Schizophrenie und Interventionsmöglichkeiten zu bieten. Sie untersucht den Einfluss schizophrener Störungen und Prodromalerscheinungen auf Schule und Unterricht und leitet daraus pädagogische Konsequenzen ab. Das Ziel ist eine professionelle Unterstützung im Umgang mit dem Thema Schizophrenie im schulischen Kontext.
- Beschreibung des Krankheitsbildes Schizophrenie, inklusive historischer Entwicklung und epidemiologischer Aspekte.
- Analyse der Ätiologie, mit Fokus auf biologische und psychosoziale Faktoren sowie das Vulnerabilitätsmodell.
- Untersuchung der Auswirkungen von Schizophrenie auf den Lebensalltag und den Schulalltag der Betroffenen.
- Darstellung verschiedener Therapieansätze und deren Prognose.
- Ableitung von Konsequenzen und Handlungsempfehlungen für Pädagogen im Umgang mit schizophrenem Verhalten.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung betont die Seltenheit von Schizophrenie im Kindesalter, hebt aber die Bedeutung von Frühwarnzeichen (Prodromalerscheinungen) hervor. Sie unterstreicht die Wichtigkeit frühzeitiger Intervention und Prävention und betont die gute Behandelbarkeit der Erkrankung. Die Handreichung soll Lehrkräfte und Beratende bei einem professionellen Umgang mit Schizophrenie unterstützen.
Beschreibung des Krankheitsbildes: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das Krankheitsbild der Schizophrenie. Es beginnt mit einem historischen Rückblick, der die Entwicklung des Verständnisses der Erkrankung von „Irrsein“ bis zur modernen Diagnose beleuchtet. Die historischen Missverständnisse und die schlechte Behandlung in den Irrenanstalten werden thematisiert. Anschließend wird die Entwicklung der Diagnose von Morel und Kraepelin erläutert. Der Fokus liegt dabei auf der Abgrenzung von anderen Psychosen und der Beschreibung der charakteristischen Symptome.1
Schlüsselwörter
Schizophrenie, Prodromalerscheinungen, Ätiologie, Symptome, Diagnose, Therapie, Pädagogik, Schule, Intervention, Prävention, Stigmatisierung.
Häufig gestellte Fragen zu: Handreichung Schizophrenie im Schulalltag
Was ist der Inhalt dieser Handreichung?
Diese Handreichung bietet Lehrkräften und Interessierten umfassende Informationen über Schizophrenie und deren Auswirkungen auf den Schulalltag. Sie beinhaltet eine Beschreibung des Krankheitsbildes, die Ätiologie, Symptome, Diagnose, Therapieansätze, sowie konkrete Handlungsempfehlungen für Pädagogen. Zusätzlich werden Berichte von Betroffenen, Unterrichtsmaterialien und relevante Adressen aufgeführt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Handreichung?
Die Handreichung zielt darauf ab, Lehrkräfte professionell im Umgang mit Schizophrenie im schulischen Kontext zu unterstützen. Sie soll detaillierte Informationen liefern, den Einfluss schizophrener Störungen auf Schule und Unterricht analysieren und daraus pädagogische Konsequenzen ableiten. Das Ziel ist eine frühzeitige Intervention und Prävention.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Handreichung behandelt folgende Schwerpunkte: Beschreibung der Schizophrenie (inklusive historischer Entwicklung und Epidemiologie), Analyse der Ätiologie (biologische und psychosoziale Faktoren, Vulnerabilitätsmodell), Auswirkungen auf den Lebens- und Schulalltag, verschiedene Therapieansätze und deren Prognose, sowie Handlungsempfehlungen für Pädagogen.
Wie ist die Handreichung strukturiert?
Die Handreichung ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von einer detaillierten Beschreibung des Krankheitsbildes Schizophrenie. Weitere Kapitel befassen sich mit dem Lebensalltag und Schulalltag von Betroffenen, Therapieansätzen, Konsequenzen und Tipps für Pädagogen, Unterrichtsmaterialien und Adressen zu relevanten Institutionen.
Welche Aspekte der Schizophrenie werden im Detail beschrieben?
Die Handreichung beschreibt detailliert die Symptome der Schizophrenie im Kindes- und Jugendalter, die Ätiologie (einschliesslich biologischer und psychosozialer Faktoren und des Vulnerabilitätsmodells), die Diagnose, verschiedene Therapieansätze (Somatotherapie, Psychotherapie, flankierende Maßnahmen), den Verlauf der Erkrankung und die Prognose.
Welche konkreten Handlungsempfehlungen gibt es für Pädagogen?
Die Handreichung gibt konkrete Handlungsempfehlungen für Pädagogen, die sich mit den kognitiven, motorischen und sozial-emotionalen Auswirkungen der Schizophrenie auf den Schulalltag befassen. Sie bietet Ansatzpunkte für Lehrkräfte, Methoden und pädagogisches Vorgehen sowie Tipps zur Gestaltung der Lernumwelt und außerschulische Unterstützungsmöglichkeiten.
Wo finde ich zusätzliche Informationen und Unterstützung?
Die Handreichung enthält eine Liste mit Internetseiten und Adressen von Verbänden und Selbsthilfegruppen, die weitere Informationen und Unterstützung im Umgang mit Schizophrenie anbieten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Schizophrenie, Prodromalerscheinungen, Ätiologie, Symptome, Diagnose, Therapie, Pädagogik, Schule, Intervention, Prävention, Stigmatisierung.
- Arbeit zitieren
- Pascal Fischer (Autor:in), 2004, Endogene Psychosen - Schizophrenie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31745