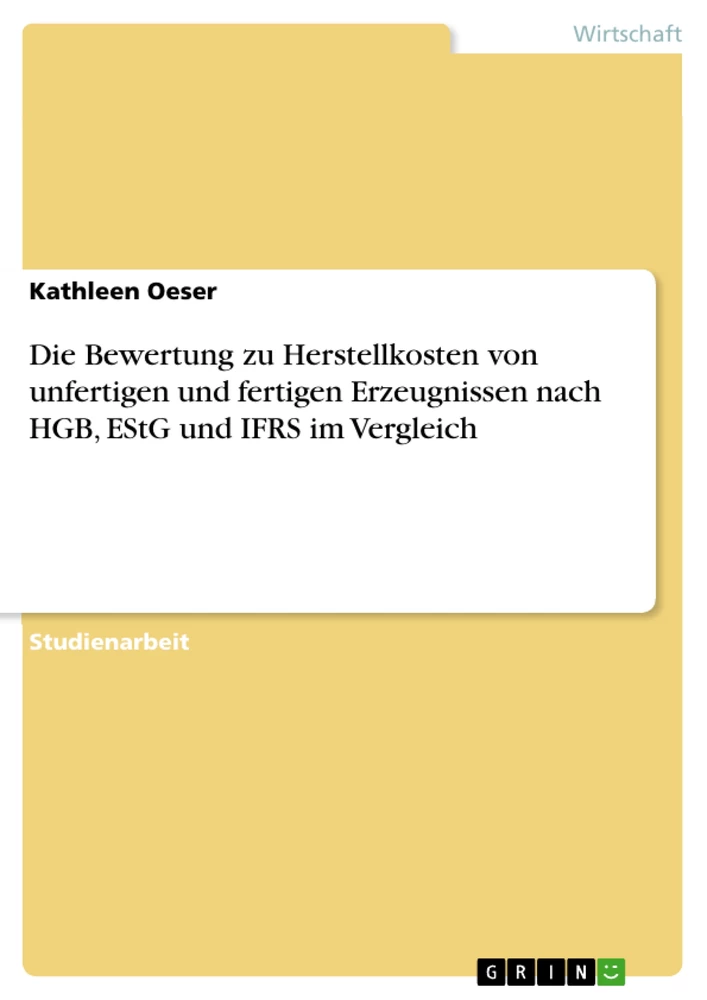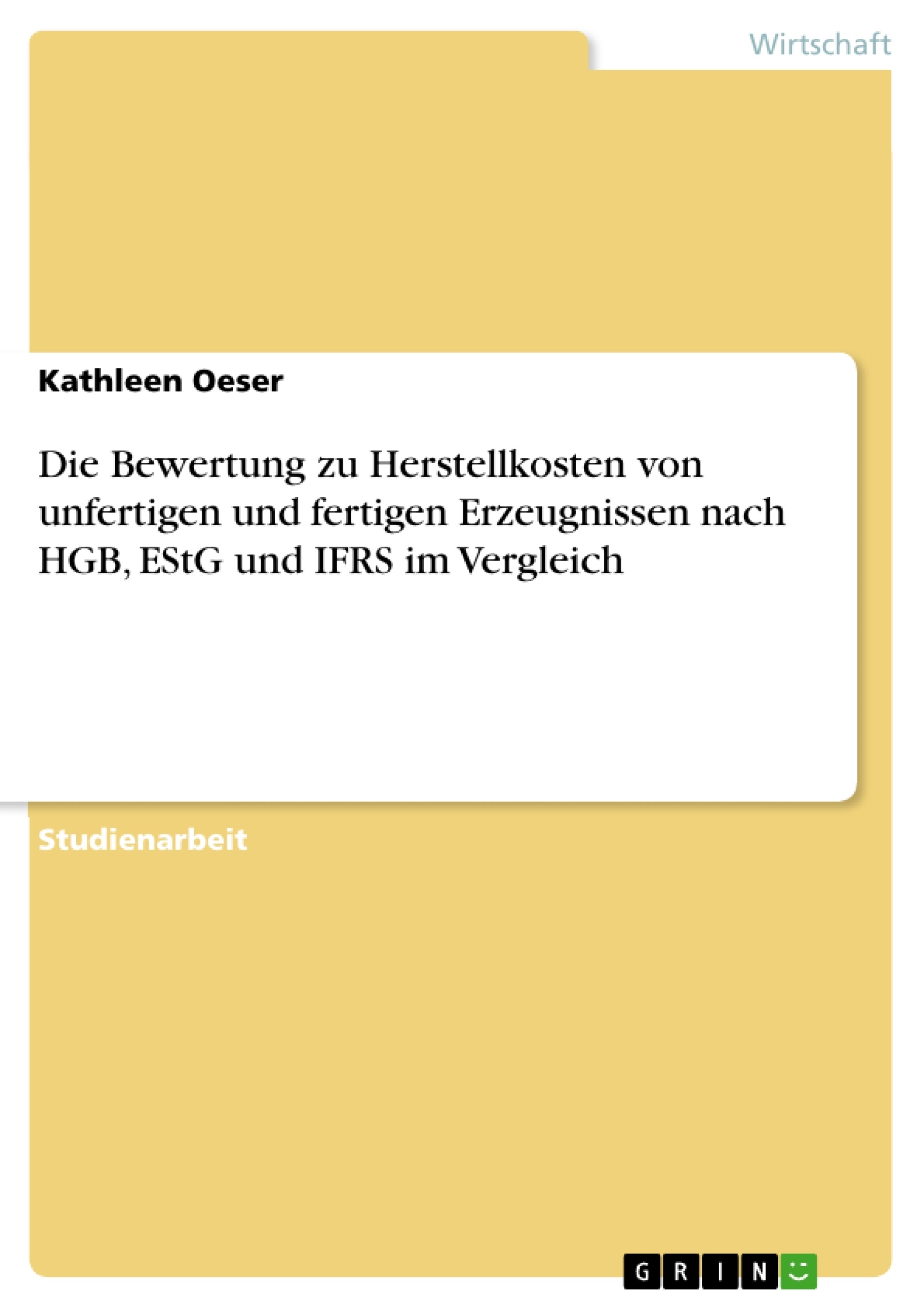Ziel der Arbeit ist es, zunächst die theoretischen Grundlagen innerhalb der nationalen und internationalen Bilanzrechte und deren Zielsetzung zu erläutern. Es werden Begriffe innerhalb der Bilanzierung und Bewertung von Vorräten unter Berücksichtigung nach HGB, EStG und IFRS erklärt. Anschließend widmet sich dann der Praxisteil der Durchführung am Beispiel einer international agierenden Möbelfabrik, die unfertige (UFE) und fertige Erzeugnisse (FE) zu Herstellungskosten (HK) bewerten muss. Es werden die einzelnen Stationen eines Bewertungsverfahren nach HGB, EStG im Vergleich zu IFRS dargestellt werden. Die Ergebnisse zeigen die Unterschiede in den einzelnen Bilanzrechten.
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert. Nach der Einleitung werden im zweiten Kapitel zunächst die bilanzpolitischen und steuerlichen Unterschiede näher gebracht. Innerhalb der Begriffserklärungen im theoretischen Teil werden jeweils auf die Unterschiede nach HGB und IFRS eingegangen. Das dritte Kapitel stellt den Praxisteil dar, in dem zunächst die Möbelfabrik M-AG kurz vorgestellt wird. Anschließend wird ein theoretisches Bewertungsverfahren der UFE/FE Erzeugnisse zu HK vorgenommen. Im letzten Kapitel wird nach einer kurzen Zusammenfassung, die Arbeit mit einer kritischen Würdigung abschließen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Ziele der Arbeit und Vorgehensweise
- 2 KONZEPTIONELLE GRUNDLAGEN
- 2.1 BilMOG und die Grundlagen von HGB und IFRS im Vergleich
- 2.1.1 Rechtssystem
- 2.1.2 Ziele und Prinzipien
- 2.1.3 Steuerliche Unterschiede
- 2.2 Bilanzierung des Vorratsvermögens nach HGB und IFRS
- 2.2.1 Bilanzansatz und Ausweis der Vorräte
- 2.2.2 Bilanzausweis und Bilanzansatz von UFE/FE
- 2.3 Bilanzbewertung des Vorratsvermögens nach HGB und IFRS
- 2.3.1 Zugangsbewertung
- 2.3.2 Folgebewertung
- 3 SITUATIONSANALYSE - PRAXISBEISPIEL
- 3.1 Vorstellung eines Fallbeispiels aus der Bilanzpolitik
- 3.2 Ausweis und Ansatz nach IFRS
- 3.3 Bewertung nach IFRS
- 3.3.1 Zugangsbewertung nach Herstellungskosten
- 3.3.2 Folgebewertung durch den Niederstwerttest
- 4 BEWERTUNG
- 4.1 Zusammenfassung
- 4.2 Kritik und Grenzen der angewandten Methode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Vergleich der Bilanzierung und Bewertung von Vorratsvermögen nach Handelsgesetzbuch (HGB) und International Financial Reporting Standards (IFRS). Ziel ist es, die konzeptionellen Unterschiede beider Rechnungslegungsstandards aufzuzeigen und anhand eines Praxisbeispiels zu verdeutlichen. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG).
- Vergleich der Bilanzierung von Vorratsvermögen nach HGB und IFRS
- Unterschiede in der Bewertung von Vorräten nach HGB und IFRS
- Analyse der Auswirkungen des BilMoG auf die Bilanzierung
- Anwendung der Standards anhand eines Praxisbeispiels
- Kritik und Grenzen der angewandten Methoden
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, beschreibt die Problemstellung und die Ziele der Arbeit. Es skizziert den methodischen Ansatz, der zur Beantwortung der Forschungsfrage verfolgt wird. Die Problemstellung wird prägnant formuliert und der Kontext der Arbeit wird klar dargestellt.
2 Konzeptionelle Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für den Vergleich der Bilanzierung und Bewertung von Vorratsvermögen nach HGB und IFRS. Es analysiert die Unterschiede im Rechtssystem, den Zielen und Prinzipien sowie den steuerlichen Aspekten beider Standards. Die Darstellung umfasst eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Definitionen und Regelungen für den Ansatz und Ausweis von Vorräten, sowohl für fertige als auch für unfertige Erzeugnisse. Es werden die jeweiligen Bewertungsmethoden eingehend beschrieben und verglichen, um die konzeptionellen Unterschiede beider Systeme deutlich hervorzuheben.
3 Situationsanalyse - Praxisbeispiel: In diesem Kapitel wird ein konkretes Praxisbeispiel aus der Bilanzpolitik vorgestellt, um die theoretischen Ausführungen zu illustrieren. Die Bilanzierung und Bewertung des ausgewählten Fallbeispiels werden sowohl nach HGB als auch nach IFRS durchgeführt und verglichen. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der in Kapitel 2 dargestellten Standards. Der Vergleich verdeutlicht die unterschiedlichen Ergebnisse und Konsequenzen der Anwendung beider Standards.
Schlüsselwörter
Bilanzierung, Bewertung, Vorratsvermögen, HGB, IFRS, BilMoG, Herstellungskosten, Niederstwerttest, Rechnungslegung, Praxisbeispiel, Vergleich, Unterschiede
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Vergleich der Bilanzierung und Bewertung von Vorratsvermögen nach HGB und IFRS
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Bilanzierung und Bewertung von Vorratsvermögen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Sie untersucht die konzeptionellen Unterschiede beider Standards und verdeutlicht diese anhand eines Praxisbeispiels. Die Auswirkungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) werden ebenfalls analysiert.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst einen Vergleich der Bilanzierung von Vorratsvermögen nach HGB und IFRS, die Unterschiede in der Bewertung von Vorräten nach beiden Standards, die Analyse der Auswirkungen des BilMoG, die Anwendung der Standards anhand eines Praxisbeispiels und abschließend eine kritische Auseinandersetzung mit den angewandten Methoden und deren Grenzen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) stellt die Problemstellung und die Ziele der Arbeit vor. Kapitel 2 (Konzeptionelle Grundlagen) legt die theoretischen Grundlagen für den Vergleich dar, inklusive einer detaillierten Analyse der Unterschiede im Rechtssystem, den Zielen, Prinzipien und steuerlichen Aspekten von HGB und IFRS. Kapitel 3 (Situationsanalyse - Praxisbeispiel) illustriert die theoretischen Ausführungen anhand eines konkreten Praxisbeispiels und vergleicht die Bilanzierung und Bewertung nach HGB und IFRS. Kapitel 4 (Bewertung) fasst die Ergebnisse zusammen und kritisiert die angewandten Methoden.
Welche konkreten Aspekte der Bilanzierung und Bewertung werden verglichen?
Der Vergleich umfasst den Bilanzansatz und -ausweis von Vorräten (inklusive fertiger und unfertiger Erzeugnisse), die Zugangs- und Folgebewertung nach HGB und IFRS, sowie die Auswirkungen unterschiedlicher Bewertungsmethoden (z.B. Niederstwerttest).
Welches Praxisbeispiel wird verwendet?
Die Arbeit präsentiert ein konkretes Praxisbeispiel aus der Bilanzpolitik, um die theoretischen Ausführungen zu illustrieren und die Anwendung der Standards nach HGB und IFRS im praktischen Kontext zu verdeutlichen. Der genaue Inhalt des Beispiels wird im Kapitel 3 detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Bilanzierung, Bewertung, Vorratsvermögen, HGB, IFRS, BilMoG, Herstellungskosten, Niederstwerttest, Rechnungslegung, Praxisbeispiel, Vergleich, Unterschiede.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel der Arbeit ist es, die konzeptionellen Unterschiede zwischen der Bilanzierung und Bewertung von Vorratsvermögen nach HGB und IFRS aufzuzeigen und anhand eines Praxisbeispiels zu verdeutlichen. Ein weiteres Ziel ist die Analyse der Auswirkungen des BilMoG auf die Bilanzierung von Vorräten.
- Quote paper
- Kathleen Oeser (Author), 2015, Die Bewertung zu Herstellkosten von unfertigen und fertigen Erzeugnissen nach HGB, EStG und IFRS im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317246