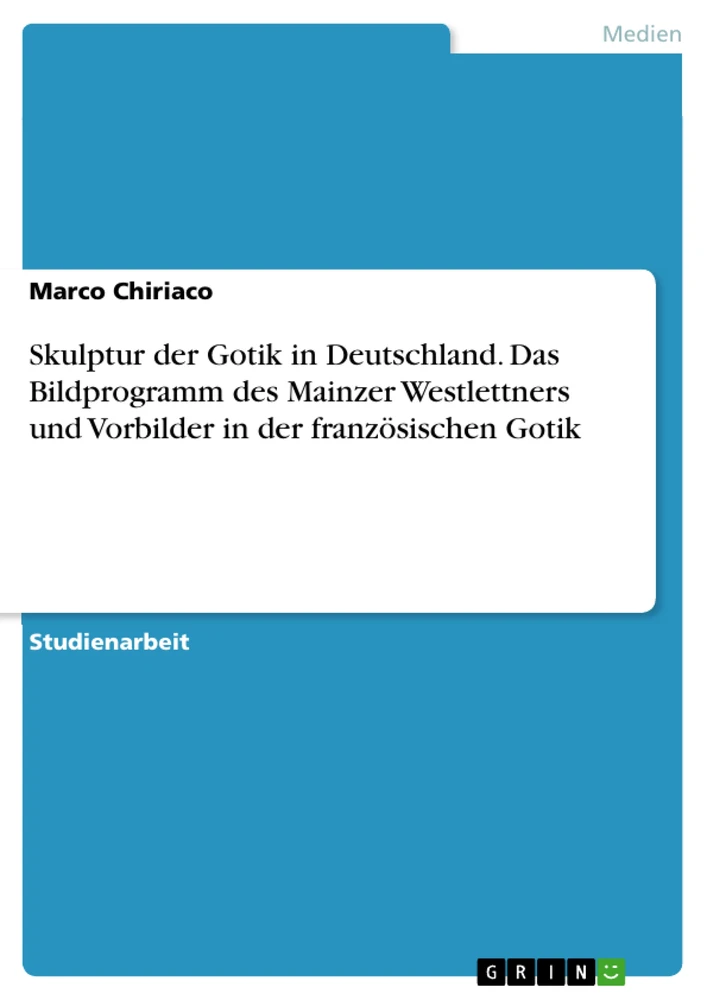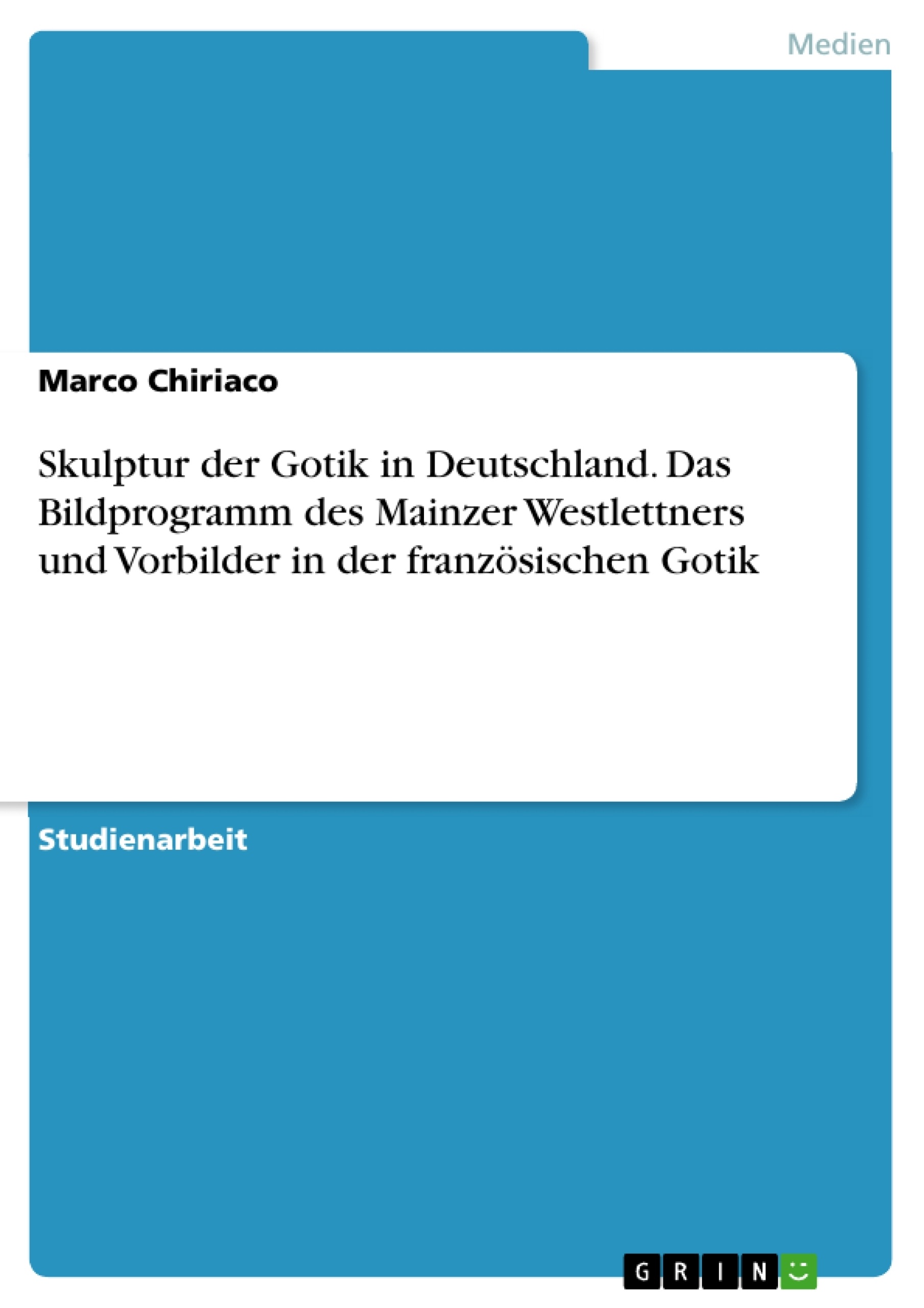Die in den letzten Jahrzehnten durchgeführten Untersuchungen zur Herkunft des Naumburger Meisters als auch Arbeiten aus seiner Hand bzw. seiner Werkstadt gipfelten in der 2011 durchgeführten Landesausstellung sowie deren begleitende Kolloquien, Tagungen und andere Veranstaltungen in Sachsen-Anhalt. Im Mittelpunkt stand dabei der Naumburger Dom, speziell der Westchor mit seinem Lettner als auch die Stifterfiguren, welche dem Naumburger Meister zugeschrieben werden. Der Naumburger Meister ist bis heute anonym geblieben; Zuweisungen von Werken gelingen in der Regel lediglich über ikonographische Vergleiche.
Von nicht minderer Bedeutung zeigt sich dabei der nur noch in Fragmenten überlieferte Westlettner des Mainzer Doms. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts geweiht sowie in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts niedergelegt, sind uns doch einige Reliefs erhalten geblieben, die von einer bis dato nicht gekannten Fülle von Innovationen strotzen. Ein neuer künstlerischer Genius, beginnend in Frankreich im Zuge des neuen Zeitalters der Kathedralen fegt über Zentraleuropa hinweg und verändert das Bauwesen als auch den Bauschmuck in revolutionärer Geschwindigkeit.
Doch was ist wirklich neu in Mainz und wo finden sich Vorbilder in der französischen Gotik? Dieser Frage soll in diesem Aufsatz nachgegangen werden - in geringem Umfang und im Rahmen der Möglichkeiten bleibend, aber in Grundzügen aufzeigend.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- II. Baugeschichte
- a. Der Mainzer Dom St. Martin bis 1239
- b. Der Mainzer Westlettner - Definition, Funktion, Beschreibung
- III. Das Skulpturenprogramm des Mainzer Westlettners
- IV. Vorbilder und Vergleiche in der französischen Gotik
- V. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz untersucht den Mainzer Westlettner, ein in Fragmenten erhaltenes Beispiel gotischer Skulpturkunst aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die Zielsetzung besteht darin, die künstlerischen Innovationen des Westlettners zu beleuchten und dessen Vorbilder in der französischen Gotik zu identifizieren. Der Aufsatz konzentriert sich auf die Einordnung des Werkes in den europäischen Kontext der Gotik und die Analyse seines Bildprogramms.
- Künstlerische Innovationen des Mainzer Westlettners
- Baugeschichte des Mainzer Domes und seine Bedeutung für den Westlettner
- Funktion und Beschreibung des Mainzer Westlettners
- Vergleich mit französischen gotischen Vorbildern
- Einfluss französischer Gotik auf die Entwicklung der deutschen Gotik
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und betont die Bedeutung des Mainzer Westlettners als Beispiel für innovative gotische Skulptur. Der Naumburger Meister und seine Werke werden als Vergleichspunkt erwähnt, um den einzigartigen Charakter des Mainzer Westlettners hervorzuheben. Die zentrale Forschungsfrage nach den Innovationen des Westlettners und seinen französischen Vorbildern wird formuliert.
II. Baugeschichte a. Der Mainzer Dom St. Martin bis 1239: Dieses Kapitel skizziert die Baugeschichte des Mainzer Domes bis zur Fertigstellung des Westbaus 1239. Es beleuchtet die verschiedenen Bauphasen, beginnend mit dem Willigis-Bardo-Bau im 10. und 11. Jahrhundert, inklusive Brände und Umbauten. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Domes bis zum Bau des Westchors im 13. Jahrhundert, der die Grundlage für den Westlettner bildete. Der Übergang von romanischer zu gotischer Architektur wird kurz angesprochen.
II. Baugeschichte b. Der Mainzer Westlettner - Definition, Funktion, Beschreibung: Dieser Abschnitt definiert den Begriff „Lettner“ und beschreibt dessen Funktion als architektonische und liturgische Trennwand zwischen Chor und Langhaus. Der Mainzer Westlettner wird als eigenständige Binnenarchitektur innerhalb des Domes charakterisiert. Seine Funktion als erhöhte Lesebühne und als räumliches Gestaltungselement wird erklärt. Die unbekannte genaue Fertigstellungsdatum wird erwähnt, und es wird angenommen das der Lettner zum Zeitpunkt der Domweihe 1239 fertiggestellt war.
Schlüsselwörter
Mainzer Westlettner, Gotische Skulptur, Französische Gotik, Deutscher Dom, Baugeschichte, Bildprogramm, ikonographischer Vergleich, Naumburger Meister, Innovationen, 13. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen zum Mainzer Westlettner
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Mainzer Westlettner, ein fragmentarisch erhaltenes Beispiel gotischer Skulpturkunst aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf der Analyse seiner künstlerischen Innovationen und der Identifizierung französischer Vorbilder.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Baugeschichte des Mainzer Domes bis 1239, die Definition, Funktion und Beschreibung des Westlettners, das Skulpturenprogramm des Westlettners, Vergleiche mit französischen gotischen Vorbildern und die Einordnung des Werkes in den europäischen Kontext der Gotik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einführung, Baugeschichte (mit Unterkapiteln zum Mainzer Dom bis 1239 und zum Westlettner selbst), Das Skulpturenprogramm des Mainzer Westlettners, Vorbilder und Vergleiche in der französischen Gotik und Schlusswort.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung besteht darin, die künstlerischen Innovationen des Mainzer Westlettners zu beleuchten und seine Vorbilder in der französischen Gotik zu identifizieren. Die Arbeit zielt auf eine Einordnung des Werkes in den europäischen Kontext der Gotik und eine detaillierte Analyse seines Bildprogramms ab.
Welche Rolle spielt die französische Gotik?
Die französische Gotik spielt eine zentrale Rolle, da die Arbeit die Vorbilder des Mainzer Westlettners in der französischen Gotik identifizieren und den Einfluss der französischen Gotik auf die Entwicklung der deutschen Gotik untersuchen will.
Wie wird der Mainzer Westlettner beschrieben?
Der Mainzer Westlettner wird als eigenständige Binnenarchitektur innerhalb des Domes beschrieben, die sowohl eine architektonische als auch liturgische Trennwand zwischen Chor und Langhaus bildete. Seine Funktion als erhöhte Lesebühne und räumliches Gestaltungselement wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Mainzer Westlettner, Gotische Skulptur, Französische Gotik, Deutscher Dom, Baugeschichte, Bildprogramm, ikonographischer Vergleich, Naumburger Meister, Innovationen, 13. Jahrhundert.
Wie wird der Naumburger Meister in die Arbeit eingebunden?
Der Naumburger Meister und seine Werke werden als Vergleichspunkt erwähnt, um den einzigartigen Charakter des Mainzer Westlettners hervorzuheben und dessen Innovationen besser zu verstehen.
Wann wurde der Mainzer Dom fertiggestellt (relevant für den Westlettner)?
Der Westbau des Mainzer Domes, welcher die Grundlage für den Westlettner bildete, wurde 1239 fertiggestellt. Das genaue Fertigstellungsdatum des Westlettners ist unbekannt, aber es wird angenommen, dass er zum Zeitpunkt der Domweihe 1239 fertiggestellt war.
- Quote paper
- Marco Chiriaco (Author), 2014, Skulptur der Gotik in Deutschland. Das Bildprogramm des Mainzer Westlettners und Vorbilder in der französischen Gotik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317149