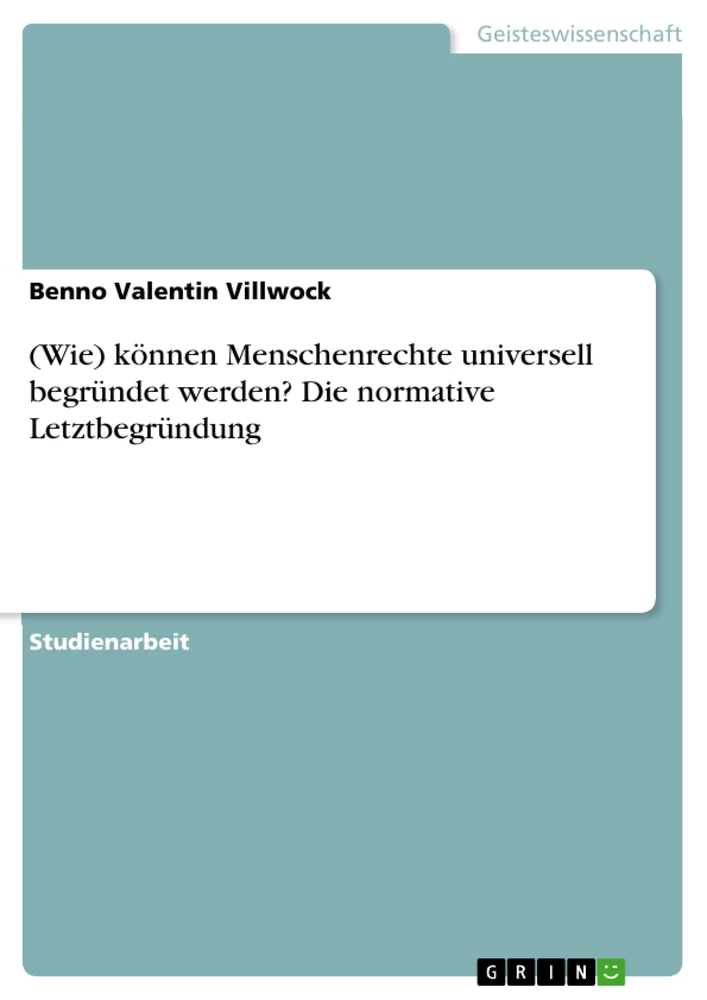In der folgenden Arbeit wird der Frage nach dem normativen Geltungsgrund der Menschenrechte nachgegangen. Wodurch können Menschenrechte normativ letztbegründet werden? Inwieweit lassen sich aus dieser normativen Letztbegründung tatsächlich Menschenrechte nach heutigem Verständnis ableiten? Welche Kritik kann an der Wahrheitsfähigkeit der Begründungsansätze, sowie an deren Potenzial, Menschenrechte nach unserem heutigen Verständnis zu begründen, angeführt werden?
Im Einklang mit einschlägiger Literatur soll sich bei der Beantwortung der Ausgangsfragen auf eine religiöse, eine deontologische sowie eine konsequenzialistische Herleitung konzentriert werden. Das Spektrum umfasst somit eine theologische Begründung sowie die wesentlichen Zweige der, sich von metaphysisch Vorannahmen weitgehend zu emanzipieren versuchenden, kognitivistischen Ethik.
Menschenrechte sind heute eine der großen globalen Integrationsformeln, auf Basis derer normative Legitimität für Meinungen und politische Vorhaben reklamiert werden kann. Der Wortbedeutung nach bezeichnen diese eine Gruppe von Rechten mit dem Anspruch, jedem Menschen, allein auf Grundlage der Zugehörigkeit zur menschlichen Spezies, zuzustehen.
Mit den Menschenrechten wird heute ein universeller Wahrheitsanspruch verbunden, das heißt, dass diese unabhängig von der subjektiven Lebenswelt und dem hiermit verbundenen kulturellen Sozialisationsrahmen des Adressaten normative Geltung beanspruchen.
Es kann nun die Frage aufgeworfen werden, worin diese besonderen Rechte des Menschen begründet sind. So wurde kritisiert, dass allein die Zugehörigkeit zu einer bestimmen biologischen Gattung kein ausreichender Grund für die Zuschreibung partikularer Rechten ist. Eine rein rechtspositivistische Begründung scheint ebenfalls zunächst ungenügend. Trotz der Relevanz einer solch empirischen Perspektive scheint es lohnend, theoretisch nach einer normativen Letztbegründung der Menschenrechte zu fragen – auch, da derartige Ideen einen bedeutenden Einfluss im Prozess der sukzessiven Sakralisierung der Person hatten und für die diskursive Durchsetzung dieser Idee bis heute aktuell sind.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- I Einleitung
- II. Der normative Geltungsgrund der Menschenrechte
- 1. Eine theologische Begründung der großen Offenbarungsreligionen
- a) Der Ursprung der Menschenwürde in der Anteilnahme Gottes
- b) Menschenrechte durch eine motivierte Exegese
- c) Kritik am theologischen Begründungsansatz
- 2. Eine deontologische Begründung nach Kant
- a) Durch Vernunft zur Würde
- b) Durch metaphysische Vorannahmen zu Menschenrechten
- c) Kritik am deontologischen Ansatz nach Kant
- 3. Eine konsequenzialistische Begründung nach Singer
- a) Die Optimierung des Interessenaggregats als objektiv richtiges Handeln
- b) Utilitaristische Menschenrechte?
- c) Kritik an der utilitaristischen Begründung von Menschenrechten
- III Schlussbetrachtung: Vergleich und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, den normativen Geltungsgrund von Menschenrechten zu untersuchen. Es werden drei verschiedene Herangehensweisen analysiert: eine theologische Begründung, eine deontologische Begründung nach Kant und eine konsequenzialistische Begründung nach Singer. Die Arbeit möchte aufzeigen, inwieweit aus den jeweiligen Letztbegründungen sich tatsächlich allgemein nachvollziehbar Menschenrechte ableiten lassen und ob die aus diesen Begründungen abgeleiteten Menschenrechte dem heutigen Menschenrechtverständnis entsprechen.
- Die Bedeutung der Menschenrechte als globale Integrationsformel.
- Die Suche nach einer normativen Letztbegründung für Menschenrechte.
- Die Analyse theologischer, deontologischer und konsequenzialistischer Begründungsansätze.
- Die Kritikfähigkeit der verschiedenen Begründungsansätze.
- Die Übereinstimmung der abgeleiteten Menschenrechte mit dem heutigen Menschenrechtverständnis.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Relevanz von Menschenrechten in der heutigen Welt dar und führt die Frage nach dem normativen Geltungsgrund ein. Sie beschreibt den Anspruch, dass Menschenrechte universell gültig sein sollen, und hinterfragt die Basis dieser Gültigkeit. Die Einleitung formuliert drei zentrale Fragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen.
Das zweite Kapitel untersucht die theologische Begründung von Menschenrechten. Es analysiert die Rolle von Gott als Schöpfer und die daraus resultierende Würde des Menschen in den abrahamitischen Religionen. Die Kapitel behandelt verschiedene Argumente, die auf der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, der besonderen Beziehung Gottes zum Menschen oder auf bestimmten Wesenseigenschaften des Menschen basieren. Es stellt auch Kritikpunkte am theologischen Begründungsansatz vor.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den normativen Grundlagen von Menschenrechten. Die zentralen Themen sind die theologische, deontologische und konsequenzialistische Begründung von Menschenrechten. Die Arbeit analysiert die Rolle der Menschenwürde, der Vernunft, des Utilitarismus und der verschiedenen Moralprinzipien bei der Begründung von Menschenrechten. Zusätzliche Schlüsselbegriffe sind: Gott, Offenbarung, Immanuel Kant, Peter Singer, Menschenwürde, Naturrecht, Metaphysik, Utilitarismus, Interessenaggregat, Kritik, Wahrheitsfähigkeit, Intersubjektivität.
Häufig gestellte Fragen
Können Menschenrechte universell begründet werden?
Die Arbeit untersucht diese Frage anhand theologischer, deontologischer und konsequenzialistischer Ansätze und analysiert deren normative Letztbegründung.
Was ist die theologische Begründung für Menschenrechte?
Sie leitet die Menschenwürde aus der Gottebenbildlichkeit des Menschen und der Anteilnahme Gottes an seiner Schöpfung ab.
Wie begründet Immanuel Kant die Menschenrechte?
Kant nutzt einen deontologischen Ansatz, bei dem die Würde des Menschen durch die Vernunft und moralische Autonomie begründet wird.
Was besagt der konsequenzialistische Ansatz nach Peter Singer?
Dieser utilitaristische Ansatz versucht, Menschenrechte durch die Optimierung des Interessenaggregats aller Beteiligten zu begründen.
Was wird an einer rein rechtspositivistischen Begründung kritisiert?
Kritiker bemängeln, dass eine rein empirische Sichtweise nicht ausreicht, um den universellen Geltungsanspruch der Menschenrechte normativ abzusichern.
- Arbeit zitieren
- Benno Valentin Villwock (Autor:in), 2014, (Wie) können Menschenrechte universell begründet werden? Die normative Letztbegründung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317032