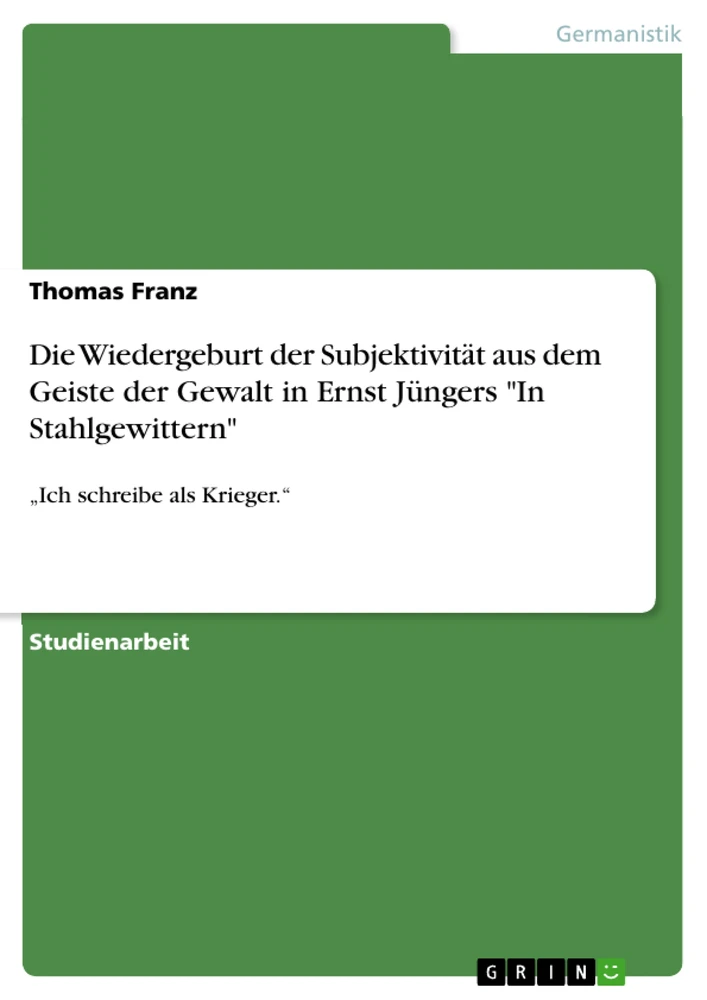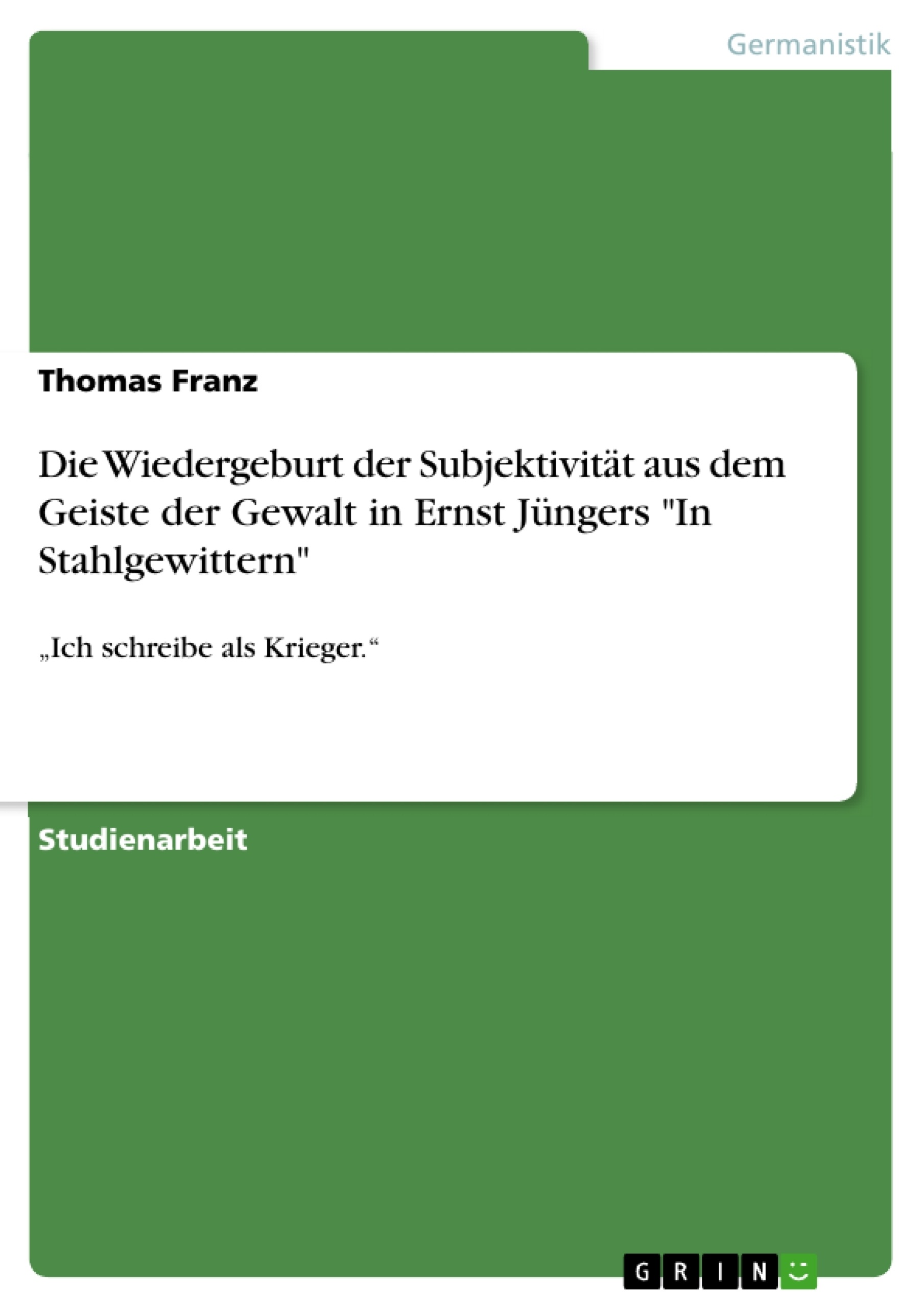Ernst Jüngers Prosatext „In Stahlgewittern“, der in sieben Fassungen vorliegt und „aus dem in Form gebrachten Inhalt meiner Kriegstagebücher“ entstanden ist, versucht für die historische Schockerfahrung des modernen Krieges ein ästhetisch-literarisches Wahrnehmungs- und Gestaltungsmuster bereitzustellen, anhand dessen Geschichte als sinnreich und sinnvoll verstanden werden kann. Der Erste Weltkrieg (WK I) als moderner und weitgehend technisierter Krieg trieb die für die Moderne typische Erfahrung von Determinierung, Kontingenz und Vereinzelung des Subjektes (uniformierte Vermassung) auf die Spitze. Der moderne Mensch erfährt sich nirgendwo deutlicher als im Schützengraben als ein Jemand, an dem nur noch gehandelt wird, als ein Jemand, der seine Identität einbüßt und letztlich jederzeit von anonymen Mächten vernichtet werden kann.
Der moderne Krieg wird gleichsam zur gesteigerten zivilisatorischen Moderne. Die Depersonalisierung verbunden mit der Erfahrung des Verlustes von Subjektautonomie schwebt wie ein Damoklesschwert über den Stahlhelmen. Diesem Befund zum Trotz zeigt der erzählende Frontleutnant in den „Stahlgewittern“ einen Weg zur Wiedergewinnung von Subjektivität unter den Bedingungen einer im Materialkrieg gesteigerten Moderneerfahrung. Anhand der Thematisierung des modernen Krieges als gesteigerter zivilisatorischer Moderne soll gefragt werden, wie über das Thema der Gewalt und ihrer literarischen Darstellung in Jüngers Text „In Stahlgewittern“ Vorstellungen von Subjektivität verhandelt und Probleme der Thematisierung von Macht bzw. Gewalt zwischen Literatur, Geschichtskonstruktion und Moral transparent werden.
Diese Arbeit versucht, die These zu belegen, dass der Stahlgewitter-Text die Geschichtsepoche und epochale Zäsur des WK I mittels literarisch-ästhetischer Wahrnehmungs- und Gestaltungsmittel so zu deuten versucht, dass zum einen das millionenfache Sterben als sinnvoll legitimiert wird und zum anderen das im „Stahlgewitter“ des industrialisierten Materialkrieges depotenzierte Individuum seine autonome Subjektivität wieder erlangen kann. Aufgrund der interdisziplinär differenten Verwendung des Begriffs der Subjektivität und der Aporie, diesen zu monosemieren, lege ich folgende Vorstellung von Subjektivität dieser Arbeit zugrunde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Krieg, Geschichte und Literatur in Ernst Jüngers In Stahlgewittern
- „Das ist der neue Mensch, der Sturmpionier, die Auslese Mitteleuropas.“ - Der Untergang des Zeitalters des Bürgers in der Zäsur des Ersten Weltkriegs als geschichts-philosophische Legitimation
- ,,als erlöschte für einen Augenblick der Unterschied von Leben und Tod\" - Das Deutungsmuster des Krieges als Naturgesetz im Kontext der Lebensphilosophie
- Wiedergeburt der Subjektivität aus dem Geiste der Gewalt
- Der Stoßtruppführer als „Fürst[en] des Grabens“ und Antwort auf die Depotenzierung des Subjekts unter den Bedingungen der Moderne
- ,,Und doch hat auch dieser Krieg seine Männer und seine Romantik gehabt!“ - Ein literarischer Versuch, selbst dem Sinn- und Ausweglosen noch einen Sinn abzutrotzen
- Sprache der Gewalt in Ernst Jüngers In Stahlgewittern
- Programm einer Désinvolture
- ,,das ist mir Evangelium: Ihr seid nicht umsonst gefallen.“ - Verbalsakralisierung des Kriegserlebnisses
- ,,Sehen, nicht verstehen, metaphorisieren“ – Metaphorik des Krieges
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Ernst Jüngers In Stahlgewittern und untersucht, wie der Text das Kriegserlebnis des Ersten Weltkriegs ästhetisch und literarisch verarbeitet und gleichzeitig das depotenzierte Individuum in diesem Kontext zur Wiedergewinnung der Subjektivität befähigt.
- Geschichtsphilosophische Legitimation des Ersten Weltkriegs als epochale Zäsur
- Naturalisierung des Krieges als Naturgesetz im Kontext der Lebensphilosophie
- Wiedergeburt der Subjektivität durch die Erfahrung der Gewalt
- Sprache der Gewalt in Ernst Jüngers In Stahlgewittern: Metaphorik, Verbalsakralisierung, Désinvolture
- Die Darstellung des Stoßtruppführers als „Fürst[en] des Grabens“ und die Rolle des Krieges als Möglichkeit zur Selbstermächtigung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die besondere Rolle des Krieges im Prozess der Modernisierung. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die Erfahrung der Gewalt in Jüngers Werk die Vorstellung von Subjektivität prägt.
Das Kapitel „Krieg, Geschichte und Literatur in Ernst Jüngers In Stahlgewittern“ analysiert die geschichts-philosophische Legitimation des Ersten Weltkriegs als epochale Zäsur und den Krieg als Naturgesetz im Kontext der Lebensphilosophie.
Das Kapitel „Wiedergeburt der Subjektivität aus dem Geiste der Gewalt“ untersucht die Rolle des Stoßtruppführers als „Fürst[en] des Grabens“ und die literarische Annäherung an die Erfahrung des sinn- und ausweglosen Krieges.
Das Kapitel „Sprache der Gewalt in Ernst Jüngers In Stahlgewittern“ fokussiert auf die sprachlichen Mittel der Verbalsakralisierung, die Metaphorik des Krieges und das Programm einer Désinvolture.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Ernst Jünger, In Stahlgewittern, Erster Weltkrieg, Kriegserfahrung, Moderne, Subjektivität, Gewalt, Lebensphilosophie, Geschichtsschreibung, Literatur, Sprache, Metaphorik, Verbalsakralisierung, Désinvolture, Stoßtruppführer, Krieg als Naturgesetz.
- Quote paper
- Thomas Franz (Author), 2015, Die Wiedergeburt der Subjektivität aus dem Geiste der Gewalt in Ernst Jüngers "In Stahlgewittern", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316989