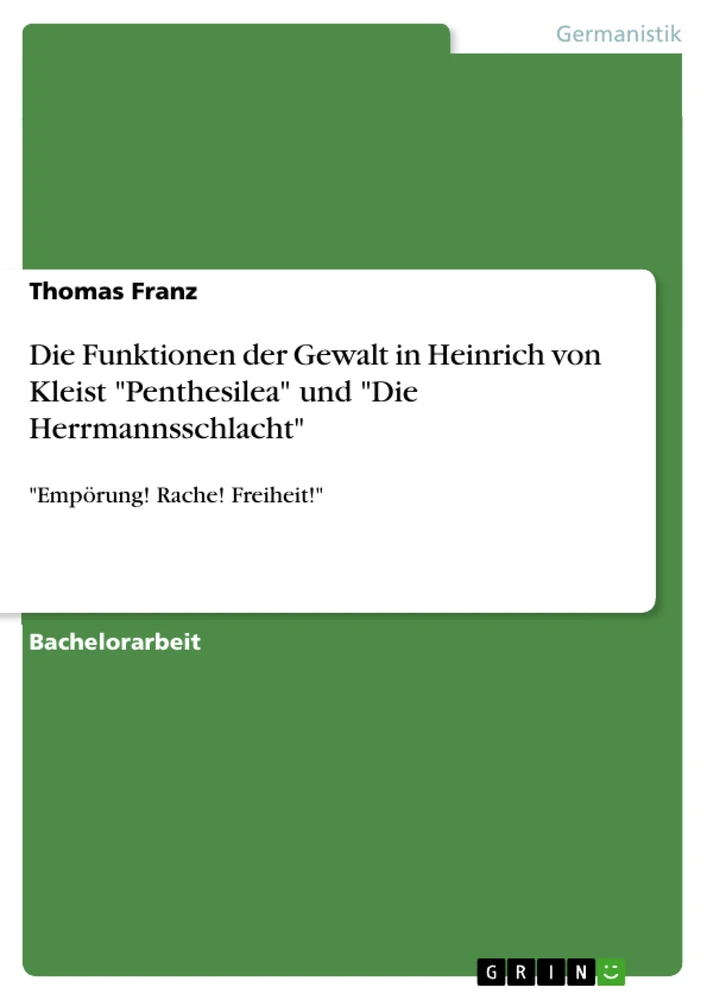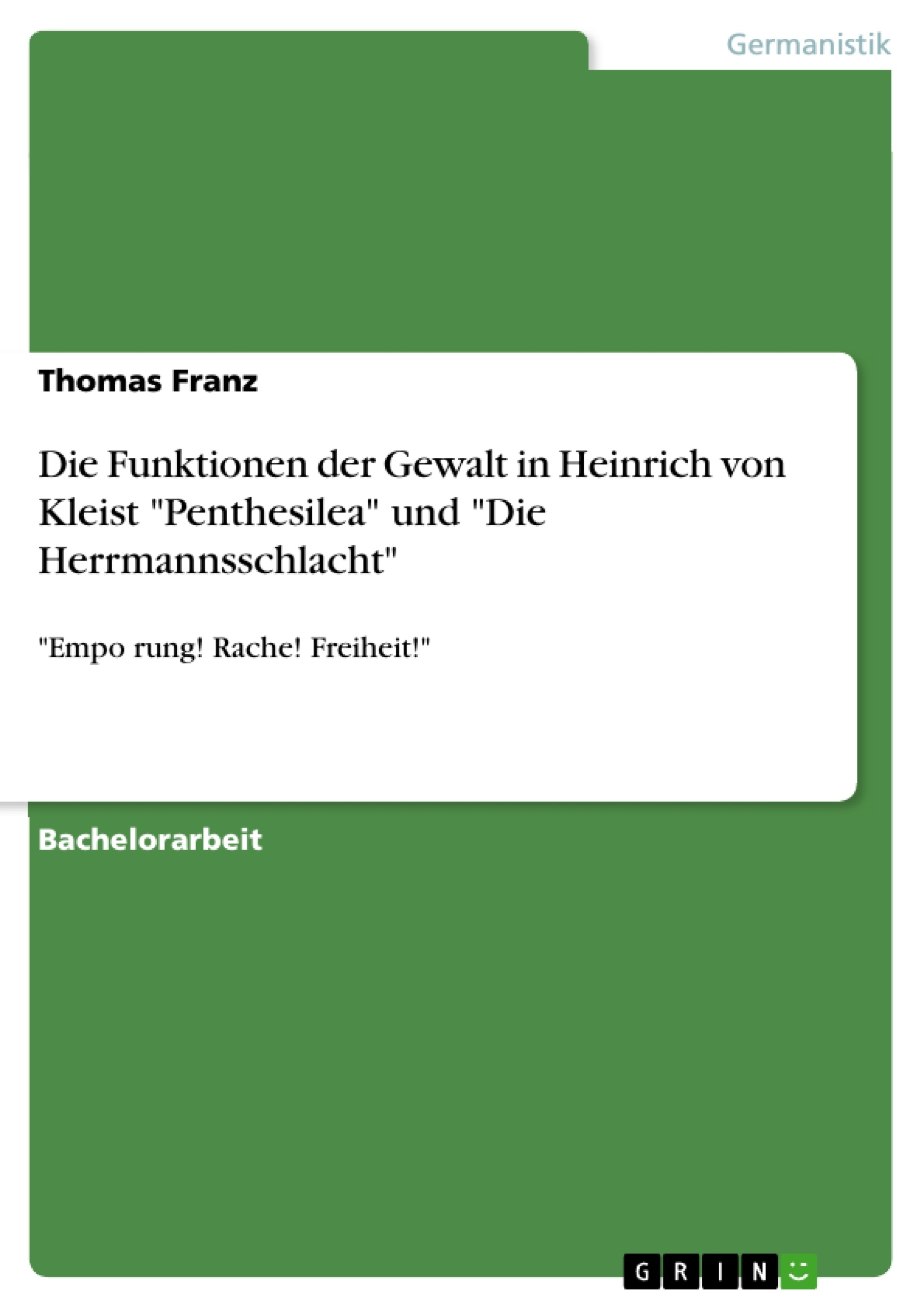Heinrich von Kleists Texte verstören. Niemals sind sie banal oder einfach. Seine Poetik der Irritation wird als "Erschütterungskunst" empfunden, die ihre Leser oft ratlos zurücklässt. Die irritierende und verstörende Wirkung hat verschiedene Gründe. Neben nicht aufgelösten Inkonsistenzen und Widersprüchen in den Texten, die von Kleist gewollt sind, um die "gebrechliche Einrichtung der Welt" in ihrer ganzen Komplexität, Opazität und Widersprüchlichkeit darzustellen, zeichnet auch die Ubiquität der Gewalt verantwortlich für die Irritationswirkung der Texte.
In der Forschungs- und Rezeptionsgeschichte stand die Erforschung der Funktion und Bedeutung der Gewaltdarstellung nicht selten im Fokus des Interesses an den Texten. Gewalt ist eines der zentralen Themen bei Kleist. Es wird in nahezu jedem Text verhandelt. Gewalt in ihrer zutiefst abstoßenden Form von seelischer oder körperlicher Grausamkeit ist omnipräsent. Im Rahmen der Ubiquität der Gewaltdarstellung ist eine monokausale Erklärungsperspektive nicht zielführend. Kleist verhandelt Gewalt vielmehr in verschiedenen Diskursfeldern. Exemplarische Diskursfelder sind die Verquickung von Gewalt und Revolution als Befreiungskampf, der Nexus zwischen Gewalt und Recht sowie das diskursive Verknüpfungsfeld von Gewalt und Liebe oder Liebe als Geschlechterkampf.
Insbesondere die Dramen 'Die Herrmannsschlacht' als das "Hohelied des dämonischen Hasses" und 'Penthesilea' als das "Hohelied des Sadismus" erregen die Gemüter bis heute und lassen den Leser zweifeln, ob Gewalt für Kleist einen Wert an sich darstellt, der Ausfluss eines Menschenhasses Kleists ist und der seine Weltwahrnehmung und literarische Darstellung in unlauterer Weise prägt und verzerrt.
Methodisch werde ich so vorgehen, dass ich mich zunächst für jedes der beiden Dramen separat den drei Funktionen der Gewaltdarstellung widme und diese nah am Text im Einzelnen zu belegen versuche, um dann in einem Folgeschritt die ästhetische, d.h. die formale, Umsetzung der Gewaltdarstellung zu untersuchen und den als Strukturelement in den Texten eingeschriebenen Nexus von Liebe, Gewalt und Sprache aufzuzeigen. Am Ende soll im Rahmen von die Arbeit abrundenden Schlussbetrachtungen eine vergleichende Perspektive gewagt werden und im Rahmen einer Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse der Beweis für meine These von der Funktionstrias der Gewaltdarstellung als Fortführung der Aufklärung, als Aufklärungskritik und als Didaxe der Macht erbracht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Penthesilea - Liebe und Gewalt
- Gewaltdarstellung als sozialkritische Weiterführung der Aufklärung
- Gewaltdarstellung als Aufklärungskritik
- "Der Tanais Asche, streut sie in die Luft!" - Gewaltsame Veränderung repressiver Verhältnisse
- "Und schärf' und spitz es mir zu einem Dolch" - Sprache und Gewalt
- Die Herrmannsschlacht - selbstkritische Reflexion der "größten Partisanendichtung aller Zeiten"
- Die négritude von Herrmanns Germanen - Gewalt als Produkt imperialer Ausbeutung und des Kriegs als Ausnahmezustand
- "Hass als Amt" und "Rache als Tugend". "Er hat zur Bärin mich gemacht!" - Kleists negative Anthropologie als Form einer Aufklärungskritik
- "Nun denn, ich glaubte, Eure Freiheit wär's." - Didaxe der Macht
- Sprache als Gewalt und poetische Reflexion über Propaganda - Drama der Metapropaganda
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktion von Gewaltdarstellungen in Heinrich von Kleists Dramen "Penthesilea" und "Die Herrmannsschlacht". Ziel ist es, die These zu belegen, dass Kleist Gewalt in dreifacher Funktion darstellt: als Fortführung der Aufklärung, als Aufklärungskritik und als Didaxe der Macht.
- Gewalt als sozialkritisches Instrument und Reflexion verkehrter sozialer Verhältnisse
- Gewalt als Ausdruck einer Subjektkrise und Kritik an der Aufklärung
- Gewalt als didaktisches Mittel zur Darstellung von Macht und deren Missbrauch
- Die Rolle der Sprache in der Inszenierung und Verstärkung von Gewalt
- Der Vergleich der Gewaltdarstellungen in "Penthesilea" und "Die Herrmannsschlacht"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Gewaltdarstellung bei Heinrich von Kleist ein. Sie hebt die irritierende und verstörende Wirkung seiner Texte hervor, die durch die omnipräsente Gewalt und deren komplexe Funktion bedingt ist. Die Arbeit konzentriert sich auf die Dramen "Penthesilea" und "Die Herrmannsschlacht", um die These von der dreifachen Funktion der Gewaltdarstellung (Aufklärung, Aufklärungskritik, Didaxe der Macht) zu untersuchen. Die enge Verbindung zwischen beiden Dramen in Bezug auf die Gewaltdarstellung und deren Rezeption begründet die Auswahl dieser Werke.
Penthesilea - Liebe und Gewalt: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Facetten der Gewaltdarstellung in Kleists "Penthesilea". Es untersucht, wie Gewalt als sozialkritische Weiterführung der Aufklärung, als deren Kritik und als Mittel zur Veränderung repressiver Verhältnisse dargestellt wird. Besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle der Sprache in der Inszenierung von Gewalt gewidmet, wobei der Akt des physischen Zerreißens als Manifestation der seelischen Zerrissenheit der Protagonistin gedeutet wird. Die Verbindung von Liebe und Gewalt im Kontext des Geschlechterkampfes wird ebenfalls beleuchtet.
Die Herrmannsschlacht - selbstkritische Reflexion der "größten Partisanendichtung aller Zeiten": Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der Gewaltdarstellung in "Die Herrmannsschlacht". Es untersucht die Gewalt als Produkt imperialer Ausbeutung und Krieg als Ausnahmezustand, beleuchtet Kleists negative Anthropologie als Form der Aufklärungskritik und analysiert die Didaxe der Macht im Drama. Die Rolle der Sprache als Gewalt und als Mittel der Propaganda wird ebenfalls untersucht, wobei die "Zerreißung" als Ausdruck bestialischer Rache thematisiert wird. Die enge Beziehung zwischen den beiden Dramen hinsichtlich der Funktionalität der Gewaltdarstellung wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Heinrich von Kleist, Penthesilea, Die Herrmannsschlacht, Gewaltdarstellung, Aufklärung, Aufklärungskritik, Sozialkritik, Macht, Sprache, Propaganda, Geschlechterkampf, negative Anthropologie, Didaxe der Macht, Imperialismus, Subjektkrise.
Häufig gestellte Fragen zu Heinrich von Kleists Gewaltdarstellung in "Penthesilea" und "Die Herrmannsschlacht"
Was ist der Fokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Funktion von Gewaltdarstellungen in Heinrich von Kleists Dramen "Penthesilea" und "Die Herrmannsschlacht". Der Schwerpunkt liegt auf der These, dass Kleist Gewalt in dreifacher Funktion darstellt: als Fortführung der Aufklärung, als Aufklärungskritik und als Didaxe der Macht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu "Penthesilea - Liebe und Gewalt", ein Kapitel zu "Die Herrmannsschlacht - selbstkritische Reflexion der 'größten Partisanendichtung aller Zeiten'", und Schlussbetrachtungen. Jedes Kapitel untersucht spezifische Aspekte der Gewaltdarstellung in den jeweiligen Dramen.
Wie wird Gewalt in "Penthesilea" dargestellt?
In "Penthesilea" wird Gewalt als sozialkritische Weiterführung der Aufklärung, als deren Kritik und als Mittel zur Veränderung repressiver Verhältnisse dargestellt. Die Rolle der Sprache in der Inszenierung von Gewalt und die Verbindung von Liebe und Gewalt im Kontext des Geschlechterkampfes werden besonders beleuchtet.
Wie wird Gewalt in "Die Herrmannsschlacht" dargestellt?
In "Die Herrmannsschlacht" wird Gewalt als Produkt imperialer Ausbeutung und Krieg als Ausnahmezustand untersucht. Kleists negative Anthropologie als Form der Aufklärungskritik und die Didaxe der Macht im Drama werden analysiert. Die Rolle der Sprache als Gewalt und als Mittel der Propaganda wird ebenfalls untersucht.
Welche Schlüsselthemen werden behandelt?
Schlüsselthemen sind die Gewaltdarstellung in beiden Dramen im Kontext der Aufklärung und Aufklärungskritik, die Rolle der Sprache in der Inszenierung von Gewalt, die Darstellung von Macht und deren Missbrauch, der Geschlechterkampf, die negative Anthropologie Kleists, und der Einfluss von Imperialismus und Subjektkrise.
Welche These wird in der Arbeit vertreten?
Die zentrale These besagt, dass Kleist Gewalt in seinen Dramen "Penthesilea" und "Die Herrmannsschlacht" nicht eindimensional darstellt, sondern als sozialkritisches Instrument, als Ausdruck einer Subjektkrise und als didaktisches Mittel zur Darstellung von Macht und deren Missbrauch verwendet.
Wie werden die beiden Dramen verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Gewaltdarstellungen in "Penthesilea" und "Die Herrmannsschlacht", um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Funktionalität der Gewalt aufzuzeigen und die enge Verbindung beider Dramen in Bezug auf die Gewaltdarstellung und deren Rezeption zu belegen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heinrich von Kleist, Penthesilea, Die Herrmannsschlacht, Gewaltdarstellung, Aufklärung, Aufklärungskritik, Sozialkritik, Macht, Sprache, Propaganda, Geschlechterkampf, negative Anthropologie, Didaxe der Macht, Imperialismus, Subjektkrise.
- Quote paper
- Thomas Franz (Author), 2014, Die Funktionen der Gewalt in Heinrich von Kleist "Penthesilea" und "Die Herrmannsschlacht", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316981