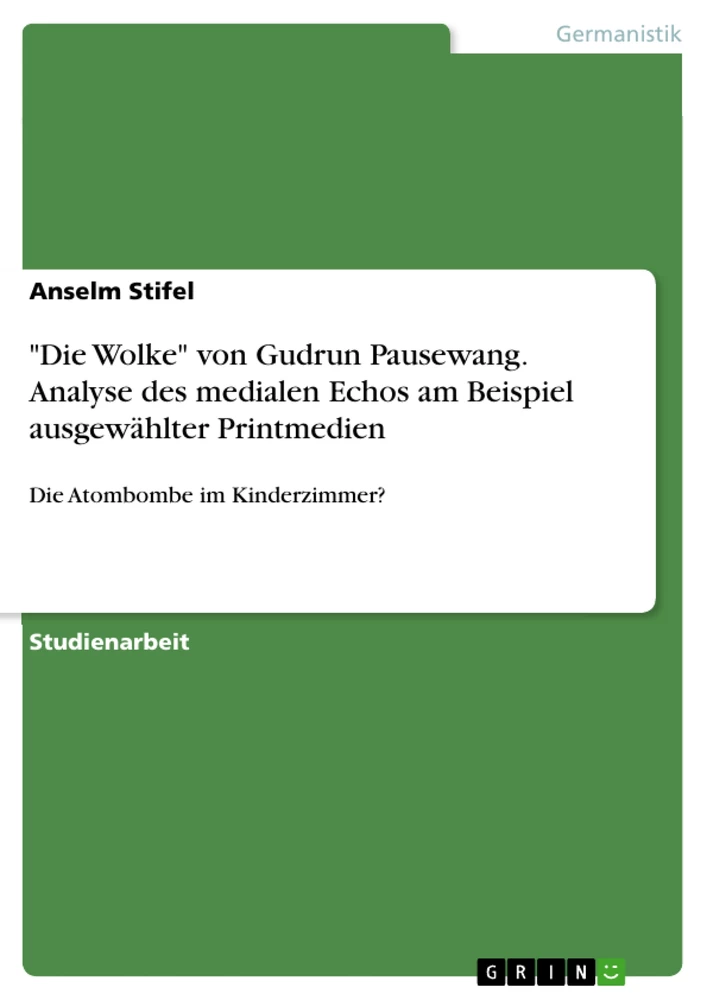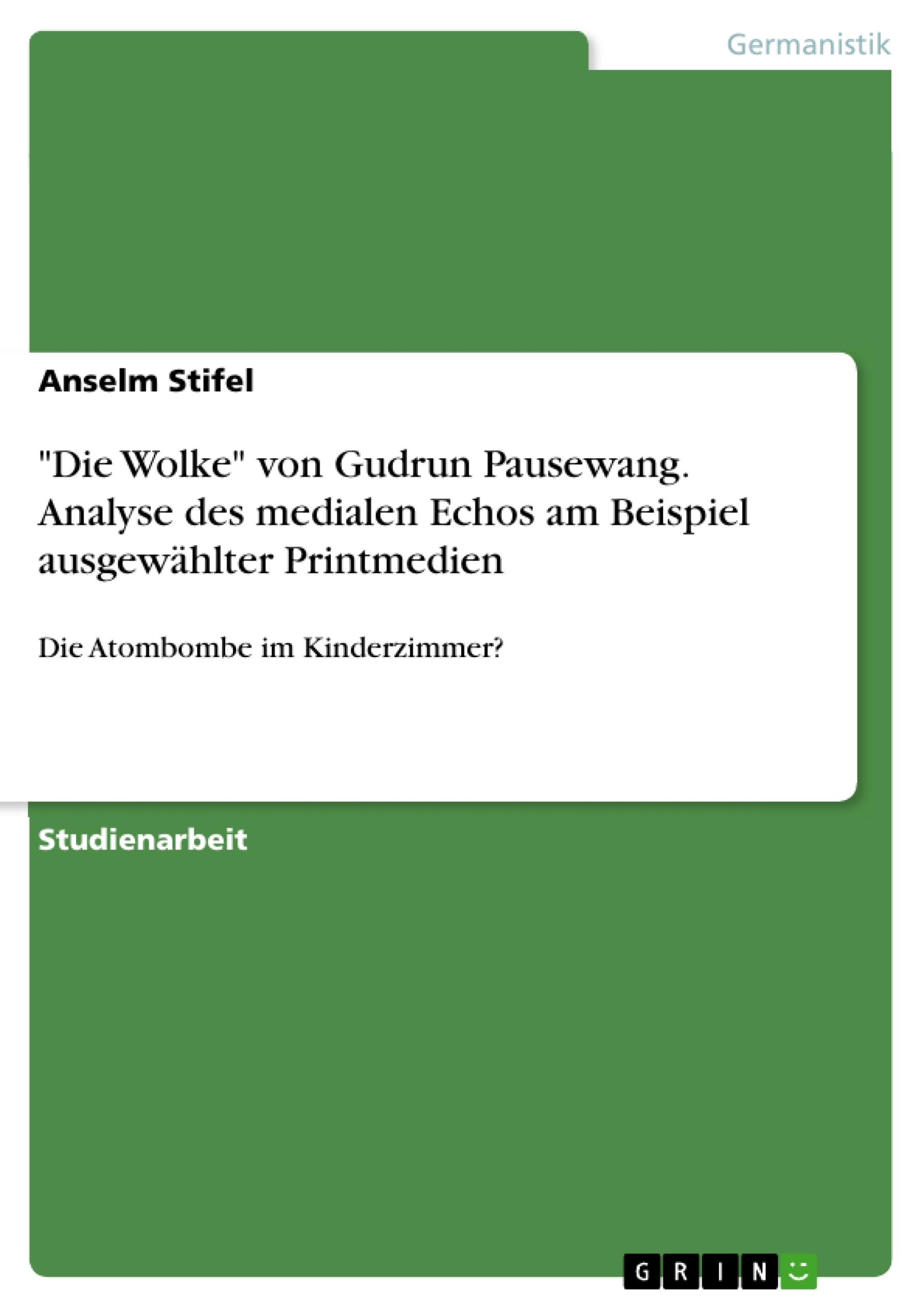1986 geriet in Tschernobyl ein Kernreaktor außer Kontrolle und explodierte. Eine riesige Region um das Kraftwerk in der Ukraine wurde verstrahlt. In der Presse wurde von Wolken berichtet, die radioaktive Stoffe nach Russland und weite Teile Europas tragen. Tschernobyl sorgte für Beunruhigung und Angst. Es war Auslöser für Protestströmungen und prägend für die Gesellschaft der zweiten Hälfte der 1980er.
Entsprechend hielt die Atomkraftproblematik auch Einzug in die Literatur. Unter dem Eindruck der Geschehnisse in Tschernobyl, und den weitreichenden Konsequenzen für die europäische Bevölkerung, entstand Christa Wolfs "Störfall – Nachrichten eines Tages" (1987) und das Jugendbuch "Die Wolke" (1987) von Gudrun Pausewang. Beide Werke verarbeiten die Tschernobyl-Katastrophe, jedoch auf unterschiedliche Weise. Im Rahmen dieser Arbeit soll das Augenmerk auf Pausewangs "Wolke" gerichtet werden.
Ein entscheidender Punkt ist, dass "Die Wolke" gar nicht in bzw. von Tschernobyl handelt. Pausewang verlagert den Schauplatz des Geschehens in die Bundesrepublik. Dort schildert sie das Reaktorunglück unter Verwendung eines ausgeprägten Realismus. In Pausewangs Text wird die Atomkatastrophe lebendig und die geographische Distanz schwindend klein.
Vor den gegenwärtigen Vorkommnissen erhält die Thematik und damit Die Wolke Brisanz und wirft erneut Fragen auf. Eine Frage der Rezeption ist, ob diese Lektüre einer jugendlichen Zielgruppe zumutbar sei. Über die Zumutbarkeit dieses Buches, welches seit den 1980ern zu einer beliebten Schullektüre gereift ist, wurde, weil es 1988 die Auszeichnung Deutscher Jugendliteraturpreises erhielt, in den (Print-)Medien kontrovers diskutiert. Dabei stellt sich, besonders auch im Hinblick auf den schulischen Gebrauch dieses Jugendbuches, die Frage inwieweit eine fiktive Erzählung die Wirklichkeit wiedergeben und abbilden könne. Diese Frage ist, aufgrund der Tatsache, dass ein selektiver Umgang mit dem Gelesenen unvermeidbar ist, akut. Nennenswert ist noch die filmische Adaption des Jugendbuches im Jahr 2006. Infolge des Medienwechsels ergaben sich nämlich neue Leerstellen, welche die eben genannten Selektion neue dimensionieren.
Diese Hausarbeit fragt nach der Wirkung des Jugendbuches, wobei die Reaktionen auf die knapp 20 Jahre später erfolgte Verfilmung nicht ausgeklammert werden sollen. Genauer gesagt befasst sich diese Arbeit mit der Analyse ausgewählter Printmedien, die eine Rezension dieser Werke veröffentlicht haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jugendliteratur in der literaturwissenschaftlichen Pragmatik
- Die Tragweite einer ideologiekritischen Betrachtungsweise
- Der kommunikationstheoretische Ansatz - die jugendliterarische Kommunikationssituation
- Der rezeptionsanalytische Blickwinkel - eine (Er-)Klärung
- Die 80er Jahre - Literatur für die verunsicherte Generation
- Der Deutsche Jugendliteraturpreis 1988
- Die Idee: staatliche Jugendförderung
- Die Wolke als Politikum sorgt für Resonanz
- Medienwechsel: Filmische Adaption des Buches
- Ein medialer Perspektivenwechsel? - die Wirkung der Adaption in der Öffentlichkeit
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Rezeption von Gudrun Pausewangs Jugendbuch "Die Wolke" und seiner Verfilmung im Kontext der Atomkraftdebatte. Sie untersucht die mediale Resonanz, insbesondere in Printmedien, und beleuchtet die Frage der Zumutbarkeit des Themas für junge Leser. Die Arbeit betrachtet "Die Wolke" im Lichte der literaturwissenschaftlichen Pragmatik, indem sie ideologiekritische, kommunikationstheoretische und rezeptionsanalytische Ansätze berücksichtigt.
- Rezeption von "Die Wolke" in Printmedien
- Die Zumutbarkeit des Themas Atomkatastrophe für junge Leser
- Ideologiekritik in der Jugendliteratur
- Kommunikation und Rezeption von Jugendbüchern
- Der Einfluss von Medienwechsel auf die Interpretation des Werkes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und thematisiert aktuelle und historische Atomkraftunfälle, insbesondere Tschernobyl, als Hintergrund für die Entstehung von Gudrun Pausewangs "Die Wolke". Sie betont die Relevanz der Thematik und den Fokus der Arbeit auf die Analyse der medialen Rezeption des Buches und seiner Verfilmung, insbesondere die kontroverse Diskussion um die Zumutbarkeit des Buches für junge Leser und die Frage der Abbildung von Wirklichkeit in fiktionalen Erzählungen. Die Arbeit untersucht die selektive Rezeption des Textes, vor allem im Kontext der schulischen Nutzung und des Medienwechsels durch die Verfilmung.
Jugendliteratur in der literaturwissenschaftlichen Pragmatik: Dieses Kapitel etabliert den theoretischen Rahmen der Arbeit. Es diskutiert die literaturwissenschaftliche Pragmatik und deren Relevanz für die Analyse von Jugendbüchern, besonders im Hinblick auf "Die Wolke" als problemorientiertes Jugendbuch. Der gesellschaftliche Verwendungsrahmen des Buches wird als zentraler Aspekt hervorgehoben. Es werden drei wichtige Theorieansätze eingeführt: Ideologiekritik, Kommunikationstheorie und Rezeptionstheorie, die für die Analyse des Text-Leser-Verhältnisses essentiell sind. Der Beitrag betont die Bedeutung der pragmatischen Perspektive für das Verständnis von Kinder- und Jugendliteratur.
Die 80er Jahre - Literatur für die verunsicherte Generation: Dieses Kapitel (falls vorhanden im Originaltext, ansonsten ausgelassen) würde den Kontext der 1980er Jahre und die gesellschaftlichen Auswirkungen von Tschernobyl auf die Jugendliteratur beleuchten. Es würde die Rolle von Jugendbüchern bei der Auseinandersetzung mit politischen und gesellschaftlichen Problemen untersuchen und den spezifischen Kontext von "Die Wolke" innerhalb dieser Entwicklung beschreiben.
Der Deutsche Jugendliteraturpreis 1988: Dieses Kapitel (falls vorhanden im Originaltext, ansonsten ausgelassen) würde die Auszeichnung von "Die Wolke" mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 1988 analysieren. Es würde die Bedeutung dieses Preises im Kontext der Förderung von Jugendliteratur und die damit verbundene öffentliche Resonanz auf das Buch untersuchen, einschließlich der Kontroversen um seine politische Botschaft und seine Zumutbarkeit für junge Leser.
Schlüsselwörter
Die Wolke, Gudrun Pausewang, Jugendliteratur, Atomkatastrophe, Tschernobyl, Medienrezeption, Ideologiekritik, Kommunikationstheorie, Rezeptionstheorie, Deutscher Jugendliteraturpreis, Verfilmung, Problemorientierte Jugendliteratur, Wirklichkeitsabbildung, Zumutbarkeit.
Häufig gestellte Fragen zu Gudrun Pausewangs "Die Wolke"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Rezeption von Gudrun Pausewangs Jugendbuch "Die Wolke" und seiner Verfilmung im Kontext der Atomkraftdebatte. Sie untersucht die mediale Resonanz, insbesondere in Printmedien, und beleuchtet die Frage der Zumutbarkeit des Themas für junge Leser. Die Arbeit betrachtet "Die Wolke" unter Anwendung literaturwissenschaftlicher Pragmatik, indem sie ideologiekritische, kommunikationstheoretische und rezeptionsanalytische Ansätze berücksichtigt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rezeption von "Die Wolke" in Printmedien, die Zumutbarkeit des Themas Atomkatastrophe für junge Leser, Ideologiekritik in der Jugendliteratur, Kommunikation und Rezeption von Jugendbüchern, sowie den Einfluss des Medienwechsels (Buch zu Film) auf die Interpretation des Werkes. Die historische Einbettung in die 80er Jahre und die Rolle des Deutschen Jugendliteraturpreises 1988 werden ebenfalls beleuchtet (falls im Originaltext vorhanden).
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit nutzt einen literaturwissenschaftlich-pragmatischen Ansatz, der ideologiekritische, kommunikationstheoretische und rezeptionsanalytische Perspektiven integriert. Diese Ansätze helfen, das komplexe Verhältnis zwischen Text, Leser und gesellschaftlichem Kontext zu verstehen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Jugendliteratur in der literaturwissenschaftlichen Pragmatik, (optional) ein Kapitel über die 80er Jahre und Jugendliteratur, (optional) ein Kapitel zum Deutschen Jugendliteraturpreis 1988, ein Kapitel zum Medienwechsel durch die Verfilmung und einen Schluss. Jedes Kapitel untersucht Aspekte der Rezeption und Interpretation von "Die Wolke".
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage beschäftigt sich mit der medialen Rezeption von "Die Wolke" und seiner Verfilmung, insbesondere der kontroversen Diskussion um die Zumutbarkeit des Themas für junge Leser und der Abbildung von Wirklichkeit in fiktionalen Erzählungen. Die selektive Rezeption, vor allem im schulischen Kontext und durch den Medienwechsel, steht im Fokus.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Die Wolke, Gudrun Pausewang, Jugendliteratur, Atomkatastrophe, Tschernobyl, Medienrezeption, Ideologiekritik, Kommunikationstheorie, Rezeptionstheorie, Deutscher Jugendliteraturpreis, Verfilmung, Problemorientierte Jugendliteratur, Wirklichkeitsabbildung, Zumutbarkeit.
- Quote paper
- Anselm Stifel (Author), 2009, "Die Wolke" von Gudrun Pausewang. Analyse des medialen Echos am Beispiel ausgewählter Printmedien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316970