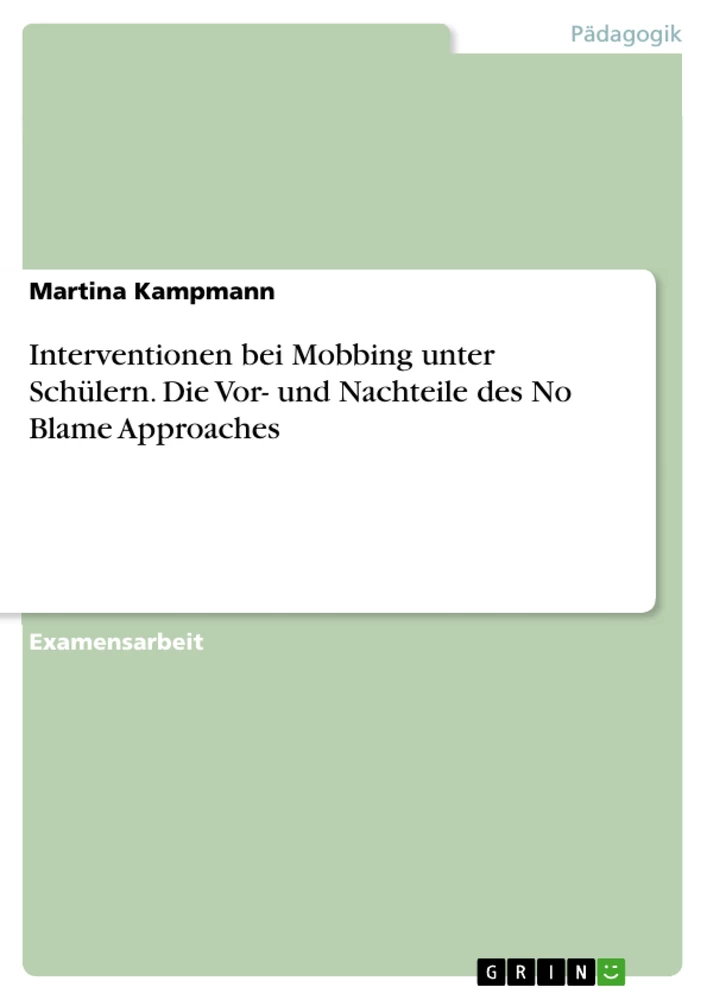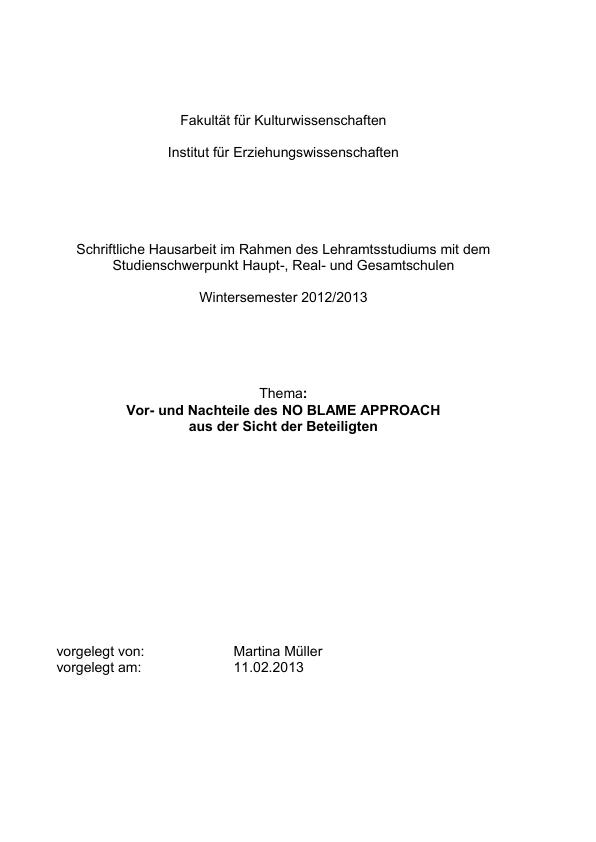Seit den 1990er Jahren hat sich der Begriff Mobbing in der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion etabliert und erfährt kontinuierlich große Aufmerksamkeit. Nicht selten werden in den Medien körperliche Übergriffe dargestellt, die drastische Ausmaße annehmen. Hierbei stehen zumeist emotional geladene Interviews der Schülerschaft im Mittelpunkt, die Täter und Opfer fokussieren und die Machtlosigkeit der Schulen thematisieren. Grundsätzlich kann in der Schule nicht nur Mobbing unter Schülern entstehen, sondern auch zwischen Schülern und Lehrern oder innerhalb des Lehrerkollegiums. Diese Examensarbeit konzentriert sich explizit auf die Mobbing-Problematik unter Schülern.
Der Begriff Mobbing ist heute international zu einem zentralen Forschungsgegenstand geworden, wie die Vielzahl an Publikationen zeigt, die selbst der Experte kaum mehr überschauen kann. Durch das öffentliche Interesse an dieser Problematik stellen sich Wissenschaft und Schule die Frage, was man dagegen tun kann. Bei einer pädagogischen Reaktion auf Mobbing in der Schule ist zwischen Mobbingprävention und -intervention zu unterscheiden. Die Autorin grenzt die Begriffe Prävention und Intervention klar voneinander ab. Der Fokus dieser Examensarbeit liegt auf der Intervention bei Schülermobbing seitens der Pädagoginnen und Pädagogen: Wie können Pädagoginnen und Pädagogen intervenieren, um eine Mobbing-Situation zeitnah zu lösen? Warum ist Mobbing unter Schülerinnen und Schülern eine pädagogische Herausforderung?
Der No-Blame-Approach stellt für pädagogische Fachkräfte eine Interventionsmöglichkeit für jede Klassenstufe und Schulform dar, die sich im Gegensatz zu anderen Interventionsprogrammen im Wesentlichen darin unterscheidet, dass sie auf Schuldzuweisungen, Verurteilungen und Strafen verzichtet. Ziel dieser Examensarbeit ist es, die Vor- und Nachteile des Mobbing-Interventionsprogramms No Blame Approach aus der Sicht der Beteiligten darzustellen. Anhand der Pro- und Contra Bilanz soll die Praktikabilität des Programms im Alltag Schule untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- THEORETISCHE GRUNDLAGEN
- Mobbing: Definition und Begriffsklärungen
- Cyber-Mobbing
- Folgen von Mobbing
- Intervention und Prävention
- Systemisch denken und handeln in der Schule
- Ressourcen- und Lösungsorientierung
- Mobbing als Gruppenphänomen
- Die Aufgaben des Lehrers bei Mobbing unter Schülern
- Zusammenfassung
- DER NO BLAME APPROACH
- Die historischen Wurzeln des No Blame Approach
- Forschungsstand
- Die drei Schritte des NO BLAME APPROACH
- Schritt 1: Gespräch mit den Mobbing-Betroffenen
- Schritt 2: Die Unterstützergruppe bilden
- Schritt 3: Nachgespräche
- Weiteres Vorgehen nach der Intervention
- Zusammenfassung
- METHODISCHES VORGEHEN
- Ziel und Zielgruppe der Untersuchung
- Wahl und Begründung der Erhebungsmethode
- Entwicklung des Online-Fragebogens
- Die Entwicklung des Interview-Leitfadens
- Die Durchführung der Interviews
- Die inhaltsanalytische Auswertung
- DATENAUSWERTUNG UND DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE
- EVALUATION DES FORSCHUNGSMETHODISCHEN VORGEHENS
- SCHLUSSBETRACHTUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den Vor- und Nachteilen des No Blame Approach (NBA) aus der Sicht der Beteiligten. Ziel ist es, die Wirksamkeit und Anwendbarkeit dieses Interventionsansatzes im Kontext von Mobbing an Schulen zu untersuchen.
- Definition und Folgen von Mobbing
- Systemisches Denken und Handeln in der Schule
- Die Rolle des Lehrers bei Mobbing
- Der No Blame Approach als Interventionsmethode
- Evaluation des No Blame Approach
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Hausarbeit vor und erläutert die Relevanz des Themas. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen des Mobbings beleuchtet, einschließlich Definitionen, Folgen und Interventionen. Das dritte Kapitel widmet sich dem No Blame Approach, seiner historischen Entwicklung, seinem Forschungsstand und seinen drei zentralen Schritten. Im vierten Kapitel wird das methodische Vorgehen der Untersuchung erläutert, einschließlich der Zielsetzung, der Erhebungsmethode und der Datenauswertung. Das fünfte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung und diskutiert die gewonnenen Erkenntnisse. Das sechste Kapitel evaluiert die Forschungsmethodik und die Stärken und Schwächen des gewählten Vorgehens. Die Schlussbetrachtung fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und bietet einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Mobbing, Schule, Intervention, Prävention, No Blame Approach, Systemisches Denken, Ressourcenorientierung, Lösungsorientierung, Online-Fragebogen, Interview, Datenanalyse, Evaluation.
- Quote paper
- Martina Kampmann (Author), 2013, Interventionen bei Mobbing unter Schülern. Die Vor- und Nachteile des No Blame Approaches, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316834