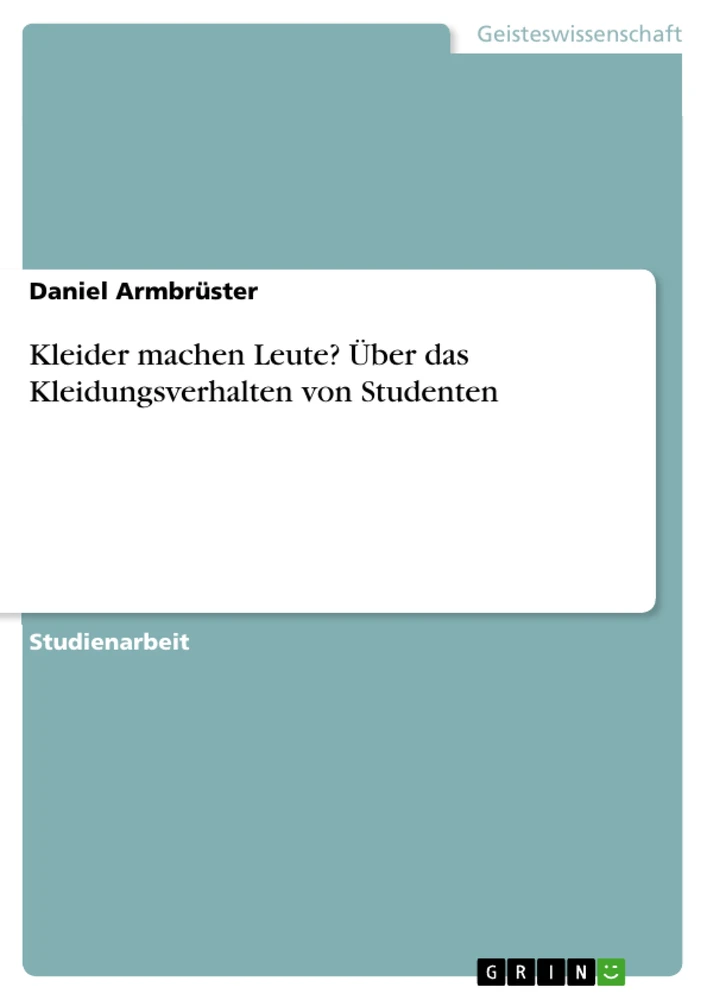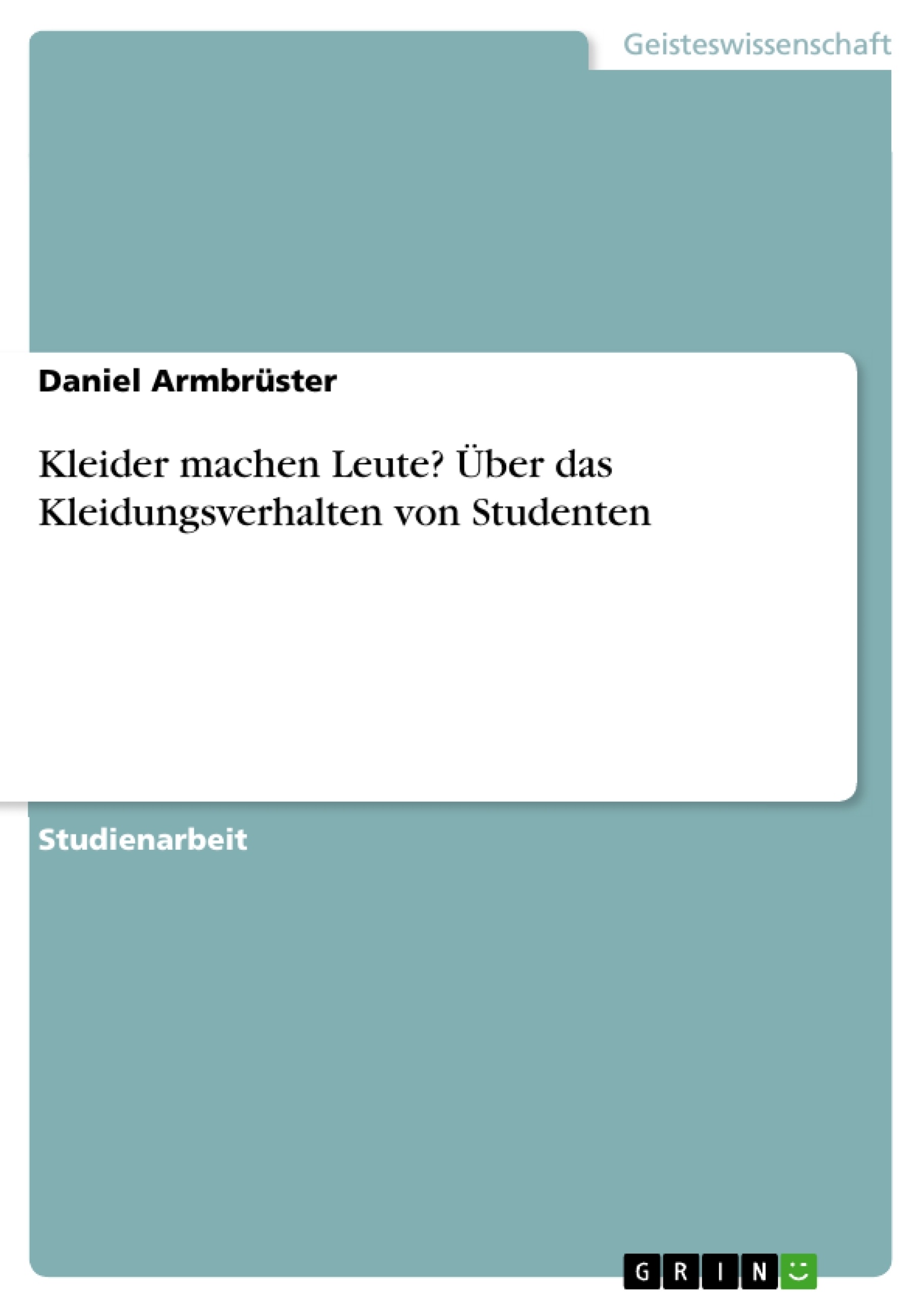Kleider machen Leute, diese These wird als zutreffend vorausgesetzt. Die Zweideutigkeit in dieser Aussage ist nicht ganz offensichtlich. In der vorliegenden Arbeit spielen allerdings beide Bedeutungen durchweg eine wichtige Rolle: die Selbstwahrnehmung zum einen, zum andern die Fremdwahrnehmung.
Die Wahrnehmung, die andere von mir haben und die Wahrnehmung, die nach meiner Ansicht die anderen von mir haben sowie die Wahrnehmung, wie ich mich selbst sehe, unterscheiden sich meist voneinander. Deswegen finden wir manchmal ein Bild von uns unschön, das unsere Freunde als sehr treffend beschreiben. Da wir im Alltag stets Menschen treffen, die wir nicht kennen, müssen wir sie möglichst schnell einschätzen. Wieso müssen wir sie überhaupt einschätzen? Dieser Beurteilungsprozess ist schon ziemlich alt und beruht im Kern wohl auf dem einfachen Trieb zu überleben. Stellt mein Gegenüber eine Gefahr dar oder ist er ein Freund? Ob Freund oder Feind muss so schnell wie möglich geklärt werden. Dieser Mechanismus ist so alt wie der Mensch selbst, hat aber in der heutigen Gesellschaft nicht mehr den ursprünglichen überlebensnotwendigen Sinn. Wir wissen bereits, dass unser Gegenüber uns nicht umbringen wird - es bleibt aber die Frage, ob er Freund oder Feind ist. Demnach versuchen wir zu überprüfen, ob er Gemeinsamkeiten mit uns teilt, ob wir der gleichen Gruppe angehören, wir versuchen zu kategorisieren. Jemand ist uns sympathisch, der uns ähnlich ist. Kommt jemand aus dem gleichen Ort wie man selbst, so ist er uns bereits sympathischer als eine Person, die wir vielleicht ebenso lange kennen, die aber woanders herkommt.
Was nun Kleider mit Leuten „machen“, ist von Individuum zu Individuum verschieden. Des Weiteren ist die Wahrnehmung abhängig von mindestens zwei Personen. Je nachdem wer, mit welchen Kleidern, wem gegenübertritt, weicht die Wirkung der Kleidung stark voneinander ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Macht der Kleidung
- Exkurs: Stereotypisierung durch Induktion
- „Habitus“ nach Norbert Elias und Pierre Bourdieu
- Fachspezifische Studentenkleidung?
- Einführung in die Studie
- Stereotypen
- Interviews
- Geisteswissenschaften
- Naturwissenschaften
- Sport
- Jura
- Kunst
- Psychologie
- Medizin
- BWL/VWL
- Informatik/Physik
- Ethnologie/Soziologie/Philosophie
- Methodenreflexion
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Kleidung im Kontext des studentischen Alltags und die damit verbundenen Stereotypisierungen. Sie beleuchtet die Rolle der Kleidung bei der Selbst- und Fremdwahrnehmung und analysiert, wie Kleidung zur schnellen sozialen Kategorisierung beiträgt. Die Studie untersucht, ob und wie sich fachspezifische Kleidungsmerkmale bei Studenten beobachten lassen.
- Die Macht der Kleidung in der Selbst- und Fremdwahrnehmung
- Stereotypisierung und soziale Kategorisierung durch Kleidung
- Einfluss von Kleidung auf die soziale Einordnung von Studenten
- Fachspezifische Unterschiede im Kleidungsstil von Studenten
- Methodische Reflexion der Untersuchung
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einführung beginnt mit einer Anekdote über die fälschliche Zuordnung einer Medizinstudentin zu den Jurastudierenden aufgrund ihres Kleidungsstils. Dies führt zur zentralen Frage nach dem Einfluss von Kleidung auf die soziale Wahrnehmung und die damit verbundenen Stereotypen. Der Text betont die Doppeldeutigkeit der Aussage "Kleider machen Leute", indem er sowohl die Selbst- als auch die Fremdwahrnehmung in den Fokus rückt. Die Notwendigkeit der schnellen sozialen Einschätzung im Alltag wird als evolutionär bedingter Mechanismus dargestellt, der auch im modernen Kontext wirkt, wenn auch mit veränderter Bedeutung. Beispiele unterschiedlicher Begegnungen (Sportler/Sportler, Sportler/Banker, Sportstudent/Jurastudent) illustrieren die Variabilität und Subjektivität der Interpretation von Kleidung.
Die Macht der Kleidung: Dieses Kapitel erörtert die Bedeutung von Kleidung als Mittel zur Kommunikation von Status, Eigenschaften und Gruppenzugehörigkeit. Es verweist auf klassische Beispiele wie Federschmuck bei Indianern oder lange Zöpfe bei japanischen Kriegern. Der Text verortet Kleidung als Kommunikationsmittel, welches Informationen über soziale Schicht, Beruf, und Selbstpräsentation vermittelt, jedoch stets auf der Basis von Stereotypisierungen und Vereinfachungen. Der anschließende Exkurs zur Stereotypisierung durch Induktion beleuchtet die kognitiven Prozesse der Vereinfachung und Fokussierung, mit denen das menschliche Gehirn die Informationsflut des Alltags bewältigt.
Schlüsselwörter
Kleidung, Studenten, Stereotypisierung, soziale Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, soziale Kategorisierung, Kleidungsstil, Fächerspezifische Kleidung, Habitus, Kognitionswissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: "Die Macht der Kleidung im studentischen Alltag"
Was ist der Gegenstand der Studie?
Die Studie untersucht die Bedeutung von Kleidung im studentischen Alltag und die damit verbundenen Stereotypisierungen. Sie analysiert, wie Kleidung zur Selbst- und Fremdwahrnehmung beiträgt und zur schnellen sozialen Kategorisierung von Studenten genutzt wird. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, ob und wie sich fachspezifische Kleidungsmerkmale bei Studenten beobachten lassen.
Welche Themen werden in der Studie behandelt?
Die Studie beleuchtet die Macht der Kleidung in der Selbst- und Fremdwahrnehmung, Stereotypisierung und soziale Kategorisierung durch Kleidung, den Einfluss von Kleidung auf die soziale Einordnung von Studenten, fachspezifische Unterschiede im Kleidungsstil von Studenten und bietet eine methodische Reflexion der Untersuchung.
Welche Kapitel umfasst die Studie?
Die Studie beinhaltet eine Einführung, ein Kapitel zur Macht der Kleidung, einen Exkurs zur Stereotypisierung durch Induktion, ein Kapitel zu "Habitus" nach Elias und Bourdieu, ein Kapitel zu fachspezifischer Studentenkleidung, ein Kapitel zur Einführung in die Studie, Kapitel zu Interviews und Kapitel zu verschiedenen Fachbereichen (Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Sport, Jura, Kunst, Psychologie, Medizin, BWL/VWL, Informatik/Physik, Ethnologie/Soziologie/Philosophie), eine Methodenreflexion und ein Schlusswort.
Wie wird die Bedeutung von Kleidung im studentischen Alltag dargestellt?
Die Studie veranschaulicht, wie Kleidung als Kommunikationsmittel Status, Eigenschaften und Gruppenzugehörigkeit vermittelt. Sie zeigt auf, wie Kleidung – basierend auf Stereotypisierungen und Vereinfachungen – Informationen über soziale Schicht, Beruf und Selbstpräsentation übermittelt. Die Studie vergleicht unterschiedliche Begegnungen (z.B. Sportler/Sportler, Sportler/Banker, Sportstudent/Jurastudent), um die Variabilität und Subjektivität der Interpretation von Kleidung aufzuzeigen.
Welche Rolle spielen Stereotypisierungen in der Studie?
Stereotypisierungen spielen eine zentrale Rolle. Die Studie untersucht, wie Kleidung zur schnellen sozialen Kategorisierung beiträgt und wie diese Kategorisierungen auf vereinfachenden kognitiven Prozessen basieren, die das menschliche Gehirn zur Bewältigung der Informationsflut nutzt. Der Exkurs zur Stereotypisierung durch Induktion beleuchtet diese kognitiven Prozesse genauer.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Studie verwendet Interviews als Methode zur Datenerhebung. Die Methodenreflexion kritisch die angewandten Methoden und deren Grenzen.
Welche Fachbereiche werden in der Studie untersucht?
Die Studie untersucht Studenten aus verschiedenen Fachbereichen: Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Sport, Jura, Kunst, Psychologie, Medizin, BWL/VWL, Informatik/Physik und Ethnologie/Soziologie/Philosophie.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Studie?
Schlüsselwörter sind: Kleidung, Studenten, Stereotypisierung, soziale Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, soziale Kategorisierung, Kleidungsstil, fachspezifische Kleidung, Habitus, Kognitionswissenschaft.
Was ist das Fazit der Studie?
(Das Schlusswort der Studie wird in der vorliegenden Zusammenfassung nicht explizit wiedergegeben. Es ist anzunehmen, dass hier die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst und bewertet werden.)
- Quote paper
- Daniel Armbrüster (Author), 2013, Kleider machen Leute? Über das Kleidungsverhalten von Studenten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316793