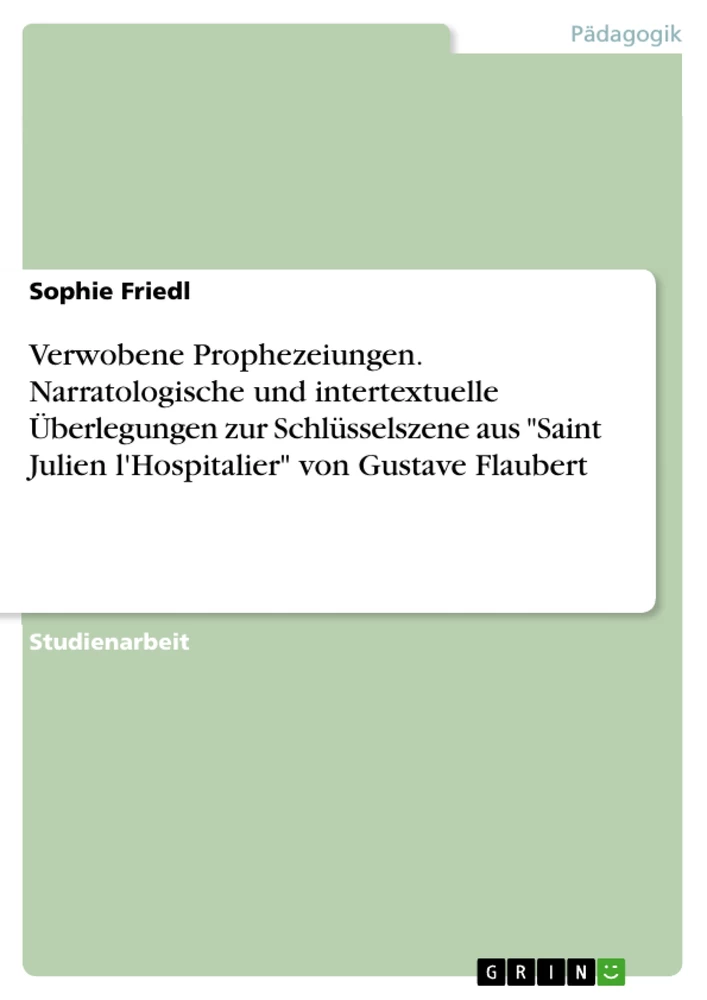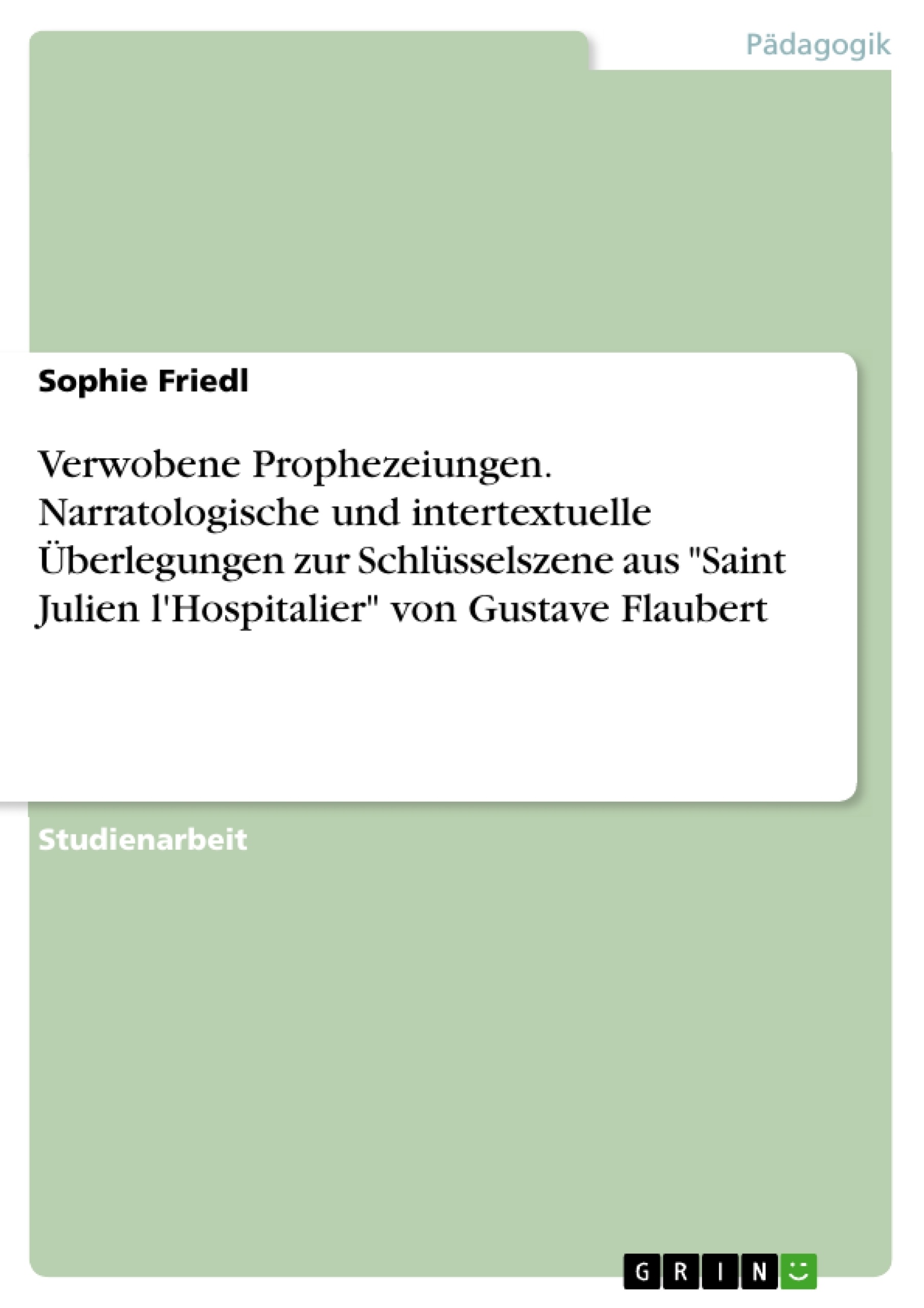Die zu Beginn der Arbeit zitierte Textstelle aus „La Légende de Saint Julien l’Hospitalier“ beschreibt die Prophezeiungen, derer Juliens Eltern Zeugen werden. Sie ist von zentraler Bedeutung für die Interpretation der gesamten Erzählung. Dass es sich um eine Schlüsselszene handelt, wird sowohl durch die narratologischen Befunde, die intertextuellen Referenzen als auch die inhaltliche Logik des Textes deutlich.
Erstens heben die narratologischen Verfahren diese Stelle aus dem übrigen Text heraus. Zweitens deutet der Vergleich mit einigen Referenztexten auf die besondere Bedeutung der hier beschriebenen Prophezeiungen für die gesamte Erzählung hin. Drittens wirft diese Stelle unzählige interessante Fragestellungen auf und enthält komplexe Verweise auf den weiteren Fortgang der Handlung: die beiden Prophezeiungen und der mit ihnen eng verwebte Fluch des Hirschen stellen die Grundstruktur der Handlung dar.
Mit der zu analysierenden Szene setzt die eigentliche Handlung ein, nachdem der vorausgehende Text der Beschreibung der Ausgangssituation und Einbettung der Handlung diente. Dieser Übergang wird anhand der Untersuchung der narratologischen Verfahren deutlich. Wenn auch durchgehend heterodiegetisch erzählt wird, so ist doch ein Wechsel in der Dauer, im Grad der Distanz und in der Fokalisierung festzustellen: von iterativer Raffung zu annähernd szenischer Darstellung, vom narrativen Modus zum dramatischen Modus sowie von Nullfokalisierung zu interner Fokalisierung, nämlich zunächst zur Perspektive der Mutter. Der Übergang zur Schilderung der Prophezeiung an den Vater vollzieht sich inhaltlich und narratologisch abrupt – letzteres durch einen kleinen Zeitsprung zurück. Zudem wechselt die Perspektive zum Vater. Das Erzähltempo verlangsamt sich hier erneut, es wird wie zuvor annähernd szenisch-singulativ erzählt. Gegen Ende der Szene werden beide Stränge zusammengeführt und resümiert. Der Erzähler hat nun, nullfokalisierend, Einsicht in beide Figuren. Er entfernt sich zunehmend wieder vom Geschehen und das Erzähltempo nimmt deutlich zu.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Eine Geburt und zwei Prophezeiungen
Narratologische Feinanalyse
Julien, Jesus und Saulus
Julien, freier als gedacht
Verwobene Prophezeiungen – ein Blick ins Märchenbuch
Die Flucht vor der Prophezeiung als ihre Erfüllung
Welche Prophezeiung ist die entscheidende?
Literaturverzeichnis
Einleitung
„La nouvelle accouchée n'assista pas à ces fêtes. Elle se tenait dans son lit, tranquillement. Un soir, elle se réveilla, et elle aperçut, sous un rayon de la lune qui entrait par la fenêtre, comme une ombre mouvante. C'était un vieillard en froc de bure, avec un chapelet au côté, une besace sur l'épaule, toute l'apparence d'un ermite. Il s'approcha de son chevet et lui dit, sans desserrer les lèvres :- « Réjouis-toi, ô mère ! Ton fils sera un saint ! »Elle allait crier ; mais glissant sur le rais de la lune, il s'éleva dans l'air doucement, puis disparut. Les chants du banquet éclatèrent plus fort. Elle entendit les voix des anges ; et sa tête retomba sur l'oreiller, que dominait un os de martyr dans un cadre d'escarboucles.Le lendemain, tous les serviteurs interrogés déclarèrent qu'ils n'avaient pas vu d'ermite. Songe ou réalité, cela devait être une communication du ciel ; mais elle eut soin de n'en rien dire, ayant peur qu'on ne l'accusât d'orgueil.Les convives s'en allèrent au petit jour ; et le père de Julien se trouvait en dehors de la poterne, où il venait de reconduire le dernier, quand tout à coup un mendiant se dressa devant lui, dans le brouillard. C'était un Bohème à barbe tressée, avec des anneaux d'argent aux deux bras et les prunelles flamboyantes. Il bégaya d'un air inspiré ces mots sans suite :- « Ah ! Ah ! Ton fils !... Beaucoup de sang !... Beaucoup de gloire !... Toujours heureux ! La famille d'un empereur. »Et, se baissant pour ramasser son aumône, il se perdit dans l'herbe, s'évanouit.Le bon châtelain regarda de droite et de gauche, appela tant qu'il put. Personne ! Le vent sifflait, les brumes du matin s'envolaient.Il attribua cette vision à la fatigue de sa tête pour avoir trop peu dormi. « Si j'en parle, on se moquera de moi », se dit-il. Cependant les splendeurs destinées à son fils l'éblouissaient, bien que la promesse n'en fût pas claire et qu'il doutât même de l'avoir entendue.Les époux se cachèrent leur secret. Mais tous deux chérissaient l'enfant d'un pareil amour ; et, le respectant comme marqué de Dieu, ils eurent pour sa personne des égards infinis. Sa couchette était rembourrée du plus fin duvet ; une lampe en forme de colombe brûlait dessus, continuellement ; trois nourrices le berçaient ; et, bien serré dans ses langes, la mine rose et les yeux bleus, avec son manteau de brocart et son béguin chargé de perles, il ressemblait à un petit Jésus.“
Die hier zitierte Textstelle aus „ La Légende de Saint Julien l’Hospitalier “[1] ist von zentraler Bedeutung für die Interpretation der gesamten Erzählung. Dass es sich um eine Schlüsselszene handelt, wird sowohl durch die narratologischen Befunde, die intertextuellen Referenzen als auch die inhaltliche Logik des Textes deutlich. Erstens heben die narratologischen Verfahren diese Stelle aus dem übrigen Text heraus. Zweitens deutet der Vergleich mit einigen Referenztexten auf die besondere Bedeutung der hier beschriebenen Prophezeiungen für die gesamte Erzählung hin. Drittens wirft diese Stelle unzählige interessante Fragestellungen auf und enthält komplexe Verweise auf den weiteren Fortgang der Handlung: Die beiden Prophezeiungen und der mit ihnen eng verwebte Fluch des Hirschen stellen die Grundstruktur der Handlung dar.
Eine Geburt und zwei Prophezeiungen
Dieser Szene geht die ausführliche Beschreibung der Ausgangssituation voraus:[2] Die detailreiche Schilderung der Atmosphäre, der Eltern Juliens, vor allem aber der Örtlichkeiten und ihrer prächtigen Ausstattung – ein idyllisch gelegenes Schloss, Reichtum an allen Dingen, Frieden[3]. Nachdem das Bitten der Königin bei Gott Gehör gefunden hat, wird Julien geboren und ein großes, mehrtägiges Fest veranstaltet.
Kurz nach der Geburt, das Fest ist noch zugange, erscheint seiner Mutter im Mondlicht ein alter Mann, der ihr weissagt, Julien werde ein Heiliger sein, bevor er wieder auf zauberhafte Weise verschwindet. Nur sie scheint diesen Mann gesehen zu haben. Die Mutter hält seine Worte für eine Botschaft Gottes, beschließt aber, darüber Schweigen zu bewahren, da sie befürchtet, für hochmütig gehalten zu werden. Kurz darauf erlebt Juliens Vater etwas Ähnliches: Im Nebel des frühen Morgens tritt ihm ein Bettler gegenüber, der ihm bruchstückhaft prophezeit, Julien werde viel Ruhm ernten, er werde stets glücklich sein und der „ famille d’un empereur “ angehören. Er erwähnt zudem, dass „ beaucoup de sang “ fließen werde. Der Vater ist sich nicht sicher, ob er sich diese Begegnung nur eingebildet hat, doch er ist beeindruckt von der hoffnungsvoll klingenden Zukunft seines Sohnes. Auch er behält das Erlebnis für sich.
Die Eheleute sprechen nicht über das Vorgefallene, lieben Julien über alles, halten ihn für einen von Gott Auserwählten und umgeben ihn mit jedem vorstellbaren Luxus. Im weiteren Verlauf der Geschichte wird das Heranwachsen Juliens geschildert, das heißt, seine zunehmend sadistische Entwicklung bis dahin, dass er ein Blutbad unter Tieren anrichtet und von einem sterbenden Hirsch verflucht wird.[4]
Narratologische Feinanalyse
Mit der zu analysierenden Szene setzt die eigentliche Handlung ein, nachdem der vorausgehende Text der Beschreibung der Ausgangssituation und Einbettung der Handlung diente. Dieser Übergang wird anhand der Untersuchung der narratologischen Verfahren deutlich. Wenn auch durchgehend heterodiegetisch erzählt wird, so ist doch ein Wechsel in der Dauer, im Grad der Distanz und in der Fokalisierung festzustellen: Von iterativer Raffung zu annähernd szenischer Darstellung, vom narrativen Modus zum dramatischen Modus sowie von Nullfokalisierung zu interner Fokalisierung, nämlich zunächst zur Perspektive der Mutter.[5] Der Übergang zur Schilderung der Prophezeiung an den Vater vollzieht sich inhaltlich und narratologisch abrupt – letzteres durch einen kleinen Zeitsprung zurück.[6] Zudem wechselt die Perspektive zum Vater,[7] Das Erzähltempo verlangsamt sich hier erneut, es wird wie zuvor annähernd szenisch-singulativ erzählt. Gegen Ende der Szene werden beide Stränge zusammengeführt und resümiert. Der Erzähler hat nun, nullfokalisierend, Einsicht in beide Figuren. Er entfernt sich zunehmend wieder vom Geschehen und das Erzähltempo nimmt deutlich zu. Die unmittelbar auf die vorliegende Szene folgenden Sätze verdeutlichen dies: „ Les dents lui poussèrent sans qu’il pleurât une seule fois. Quand il eut sept ans (…)“.[8]
Es zeigt sich also, dass diese Stelle sich vom vorhergehenden wie auf sie folgenden Text hervorhebt und eine besondere Stellung einnimmt. Tatsächlich taucht ein ähnlich langsames Erzähltempo erst wieder auf, als Julien die Hirschenfamilie tötet und verflucht wird.[9] Unterstrichen wird diese Feststellung dadurch, dass in der vorliegenden Szene das erste Mal im Text direkte Rede verwendet wird – und danach erst wieder, als der Hirsch Julien verflucht. Das weist auf eine Verbindung zwischen diesen beiden Szenen hin. Außerdem legt das Muster des Erzähltempos einen Parallelismus zwischen der Darstellung der Prophezeiung gegenüber der Mutter und jener der Prophezeiung gegenüber dem Vater nahe: Szene – Raffung (Mutter) gegenüber Szene – Raffung (Vater). Eine solche Parallelität ist sehr weitgehend zu beobachten.[10]
Die Art des Perspektivwechsels sowie dieser parallele Aufbau verdeutlichen den Gegensatz, der zwischen den beiden Prophezeiungen besteht: Julien soll sowohl weltlicher Erfolg (Ruhm, hoher sozialer Stand) als auch zeitlich überdauernde, religiöse Bedeutung als Heiliger beschieden sein. Die Widersprüchlichkeit auf der Bedeutungsebene wird unterstrichen, indem sich die Darstellung in allen anderen Punkten stark ähnelt. Dies dient zum einen dem Spannungsaufbau – welche Prophezeiung wird eintreten? Oder auf welche Art und Weise beide? Zum anderen ist die Ambivalenz der Persönlichkeit Juliens und seine spätere Entwicklung in dieser Szene angelegt. In diesem Sinn könnte man die Tatsache, dass er das Bild eines „ petit Jésus “ evoziert, verstehen – das heißt, als Verweis auf sein Lebensende, wobei doch auffällt, wie schief dieser Vergleich anmutet. Wurde Jesus der Weihnachtsgeschichte zufolge nicht in bitterer Armut geboren?
Julien, Jesus und Saulus
Es lohnt sich, die betreffende Textstelle genauer zu untersuchen. Zunächst wird die große Liebe und Wertschätzung beschrieben, die König und Königin ihrem Sohn entgegenbringen. Direkt darauf folgt, geradezu kontrastierend mit der erwähnten „ amour “ und den „ égards infinis “, die ausführliche Auflistung des Reichtums, von dem das Kind umgeben ist. Elternliebe wird hier nicht mit besonderer Aufmerksamkeit oder ähnlichem belegt, sondern mit Prunk und materieller Großzügigkeit in Verbindung gebracht. Diese feine Ironie stellt die Liebe der Eltern letztlich in Frage.[11] Die Stelle kulminiert nun in dem zweifelhaften Vergleich Juliens mit einem kleinen Jesus. Julien ähnelt keineswegs dem sozusagen echten Jesuskind, sondern seiner späteren verklärten, geschönten Darstellung.[12] Ein Verweis auf das Lebensende Juliens ist genau darin zu sehen – in dieser Geschichte zeigt sich Heiligkeit eben nicht in Prunk und Glanz, im Gegenteil, Gott tritt als Leprakranker auf.
Die angesprochene Spannung zwischen den beiden Prophezeiungen in dieser Szene lässt an die Entwicklung denken, die der biblische Saulus durchmacht, und in deren Verlauf er zu Paulus wird.[13] Saulus ist maßgeblich an der Hinrichtung des Stephanus beteiligt, wie auch an der Verfolgung der Anhänger Christi allgemein.[14] Im Gegensatz zu Julien ist er nicht verflucht, keine Prophezeiung zwingt ihn, so zu handeln. Dagegen wurde über Julien schon als Kind, nämlich seinem Vater gegenüber, geweissagt, in seinem Leben werde „ beaucoup de sang “ fließen, und später zieht er, wenn auch aus eigener Schuld, einen Fluch auf sich.
Nachdem Jesus Paulus erschienen ist, wird dieser zum „ Werkzeu g“[15] Gottes. Predigend und missionierend zieht er durch das Land, wobei er Misstrauen und Verfolgung ertragen muss. Juliens zurückgezogenes, selbstloses Dasein nach der Ermordung seiner Eltern ähnelt dem des Paulus. Doch liegt seinem Wandel durchaus eigene Einsicht, vielleicht sogar eine eigene Entscheidung zugrunde. Wenn er zum Werkzeug Gottes wird, so hat er daran zumindest Anteil.[16]
Julien, freier als gedacht
Der besondere Stellenwert der eingangs zitierten Textstelle und der in ihr erzählten Vorkommnisse zeigt sich auch darin, wie sie sich vom wohl am manifestesten in ihr verankerten Referenztext abhebt, nämlich der Erzählung des Julien-Stoffes in der Legenda Aurea [17] des Jacobus de Voragine.[18] Bei de Voragine wird gleich zu Beginn unvermittelt vorweggenommen, dass Julien seine Eltern umbringen wird. Über seine Herkunft und Kindheit erfährt man lediglich, dass er adlig ist. Die Handlung setzt mit der Jagdszene ein. Die ersten beiden Prophezeiungen, denen in der Légende durch verschiedene Verfahren eine bedeutende Stellung innerhalb der Erzählung eingeräumt wird, finden sich in diesem Referenztext nicht wieder. Das unterstreicht ihre Bedeutung noch zusätzlich. Daher werden im Folgenden als intertextuelle Bezüge vor allem Darstellungen von Prophezeiungen untersucht.
In der Bibel finden sich die Prophezeiungen an Maria, an Josef und an Zacharias.[19] Allen dreien gemeinsam ist der Zeitpunkt der Prophezeiung, nämlich vor der Geburt des betreffenden Kindes. Darin liegt bereits ein erster Unterschied zu den Prophezeiungen, die gegenüber Juliens Eltern ausgesprochen werden. Die drei künftigen Eltern aus der Bibel erfahren von einem Engel[20] von der Geburt eines Kind von besonderer religiöser Bedeutung, was jeweils mit einer Handlungsanweisung verbunden ist: Den Neugeborenen ist ein bestimmter Namen zu geben – es scheint ganz so, als habe der Name eine Bedeutung für die Erfüllung der Prophezeiung. Julien dagegen trägt seinen Namen bereits, als die Weissagungen gegenüber seinen Eltern ausgesprochen werden. Hier stellt sich die Frage, ob Juliens Leben deshalb in geringerem Maße vorherbestimmt ist.
In der Bibel werden anfängliche Zweifel der Rezipienten zerstreut (Maria) bzw. zuerst bestraft und dann zerstreut (Zacharias). Juliens Eltern dagegen erfahren zwar unter übersinnlich wirkenden Umständen von der Zukunft ihres Sohnes, allerdings aus der Hand eines Greises bzw. eines Bettlers, nicht durch einen sich eindeutig zu Erkennen gebenden Engel. Dennoch hegen sie geringere Zweifel, sie fragen nicht etwa wie Maria und Zacharias nach, wie das denn vonstatten gehen solle – vielleicht deshalb nicht, weil ihnen die vorausgesagte Zukunft so gefällt? Alle drei Prophezeiungen der Bibel erfüllen sich, wenigstens ein Aspekt der Vorhersagen an die Eltern Juliens hingegen nicht – ist er wirklich „ toujours heureux “? Zudem wird den Eltern nur ein Teil der Zukunft enthüllt und ihnen dabei suggeriert, das Leben des eigenen Sohnes zu kennen.
Wie viel Freiheit verbleibt Julien also nach diesen beiden Prophezeiungen? Wie mächtig sind diese? Welche Rolle spielt die – teils trügerische – Zuversicht, die Juliens Eltern aus ihnen ziehen? Wie zuverlässig und eindeutig sind die Weissagungen?[21]
Verwobene Prophezeiungen – ein Blick ins Märchenbuch
Auch in vielen Märchen tauchen Prophezeiungen über die Zukunft eines Kindes auf, beispielsweise in Sterntale r, in Das Feuerzeug und in Dornröschen.[22] In letzterem sprechen elf Feen gute Wünsche für das kleine Kind aus, doch eine böse Fee verflucht es, mit 15 Jahren zu sterben. Darauf reagiert eine weitere Fee mit dem Wunsch, dieser Tod möge sich in einen hundertjährigen Schlaf umwandeln. Es werden also prinzipiell eine gute und eine schlechte Prophezeiung gegenübergestellt. Die gute neutralisiert die schlechte.
Der Fluch des Hirschen in der Légende ist als eine unheilvolle Prophezeiung aufzufassen. Ihm steht die Weissagung gegenüber, dass Julien ein Heiliger sein werde. Die gute Prophezeiung kann allerdings aus chronologischen Gründen nicht wie in Dornröschen eine Reaktion auf die schlechte sein. Ist möglicherweise die Prophezeiung des Hirschen eine Folge der ersten beiden? Stehen diese drei in irgendeinem ursächlichen oder in einem andersartigen Verhältnis zueinander? Einen Zusammenhang zwischen den beiden Textstellen, die die drei Prophezeiungen enthalten, legten schon die narratologischen Verfahren dar.
Der letzte an Dornröschen ausgesprochene Wunsch enthält bereits den vorhergehenden Fluch. Beinhaltet möglicherweise eine der Prophezeiungen über Juliens Leben die beiden anderen? Anders interpretiert wandelt die letzte Fee den Fluch ihrer Vorgängerin nicht ab, sondern sie wünscht, die Worte ihrer Vorgängerin mögen freier, poetischer ausgelegt werden – ‚Tod’ soll nicht ‚Tod’ bedeuten, sondern ‚hundertjähriger Schlaf’. Mit dieser Präzisierung, die die letzte Gelegenheit darstellt, Dornröschens Zukunft in bestimmte Bahnen zu lenken (denn jede Fee kann nur einen Wunsch aussprechen), fällt jeder Freiraum für die Entwicklung der Handlung weg – keine unerwarteten Wendungen, keine überraschende Art und Weise, in der sich die Prophezeiungen erfüllen, auch nicht, was ihre Reihenfolge anbelangt.
Welchen Interpretationsspielraum belassen die Prophezeiungen in der Légende den Protagonisten? Wie wird er genutzt? Innerhalb welchen Rahmens bewegen sie sich?
Juliens Eltern liegen nur unvollständige Informationen vor, noch dazu scheinen sie davon auszugehen, jeweils für sich die ganze Wahrheit zu kennen, was die Unvollständigkeit noch verstärkt. Entsprechend ihrem Erkenntnisstand erziehen sie Julien, und projizieren auf ihn ihre vermeintlich belegte Vorstellung darüber, wer er ist und sein wird. Sie hören jeweils den Teil der Prophezeiung, der ihnen zusagt als Zukunftsvision des eigenen Sohnes, und interpretieren diesen Teilaspekt nach ihren persönlichen Wünschen. Die weiter oben besprochene Textstelle legt nahe, dass die Eltern Juliens mehr in die schöne Vorstellung von ihrem Sohn verliebt sind, als sie diesem wirkliche Liebe entgegenbringen. Die Vorstellung der strahlenden Zukunft seines Sohnes zerstreut die Zweifel, die Juliens Vater zunächst hegt. Er meint zu erkennen, dass Juliens Begabung in und Neigung zur Jagd auf eine ruhmreiche militärische Zukunft hindeute. Seine Mutter fühlt sich schon aus einem geringen Anlass – Julien spendet großzügig an Arme – an seine vermeintliche Zukunft als hoher Geistlicher erinnert.[23] Womöglich übersehen Juliens Eltern aus diesem Grund Anzeichen für gefährliche, sadistische Züge des Jungen. Wie geht Julien mit dem Fluch des Hirschen um?
Die Flucht vor der Prophezeiung als ihre Erfüllung
Viele Elemente der Handlung verweisen auf die Geschichte des Ödipus. Sophokles führt in König Ödipus vor, wie ein Mensch sich aufgrund seines Hoffnungsdenkens vor der unheilvollen Realität verschließt.[24] Die Protagonisten meinen, dunklen Prophezeiungen entgehen zu können, und verweigern sich bis zuletzt der Einsicht in ihr Scheitern. Der Versuch, die Orakel umzudeuten oder ihnen zu entgehen, führt sie geradewegs zur ungewollten Erfüllung der Weissagungen.[25]
Juliens Verhalten ähnelt dem des herangewachsenen Ödipus. Er meint, den unmissverständlichen Fluch abwenden zu können, indem er weit von zuhause weg geht und nicht jagt. Allerdings hat Ödipus den Fluch nicht durch sein eigenes Fehlverhalten provoziert, sondern sein Vater trägt die Verantwortung dafür. Julien wird für seine eigene Grausamkeit verflucht – auch wenn diese ihm vielleicht durch eine zweifelhafte Jagdtradition der Familie in die Wiege gelegt wurde. Die Erfüllung dieser dritten Prophezeiung stellt für ihn eine Art Läuterung dar, sie löst bei ihm einen Reflexionsprozess aus, in dessen Verlauf er immer selbstloser und reuevoller handelt. Sophokles’ Ödipus dagegen hat zwar an der Verfluchung keine eigene Schuld, leugnet sie aber. Julien wehrt sich kaum gegen die Realität; er versucht zwar, irgendeine andere Erklärung zu finden als die, dass es sich bei den Getöteten um seine Eltern handelt.[26] Doch noch am selben Tag trifft er Entscheidungen, die der Einsicht in seine Schuld folgen, wodurch er, wie bereits in Hinblick auf die Referenz zu Saulus/Paulus dargelegt, Anteil an seiner Entwicklung zum Heiligen hat. Damit stellt die erfüllte Prophezeiung für Julien eine Art Lehre dar, wie es auch die Worte von Jean de La Fontaines „L’Oiseau blessé d’une flèche“ sind – keine Drohung, kein Fluch, sondern eine belehrende, weise Ankündigung: „ Souvent il vous arrive un sort comme le notre. “[27]
Welche Prophezeiung ist die entscheidende?
Die Erfüllung des Fluches, der ausgeführte Elternmord scheint die Voraussetzung dafür zu sein, dass Julien den richtigen Weg findet. Insofern verweist die erste Prophezeiung – die, dass Julien ein Heiliger sein werde – unmittelbar auf die dritte, den Fluch des Hirschen. Auch die zweite Prophezeiung verweist auf sie, wenn sie besagt, dass „ beaucoup de sang “ fließen werde. Es fließt viel Blut, bevor die dritte Prophezeiung ausgesprochen wird – durch Juliens Grausamkeit nämlich, welche wiederum zum Fluch führt. Es fließt auch nachher viel Blut, weil Julien auf der Flucht vor dem Fluch Karriere als Feldherr macht – womit sich weitere Aspekte der zweiten Weissagung erfüllen – und seine Eltern tötet.[28] Hier schließt sich der Kreis, denn wie bereits erwähnt, ist der Elternmord die Basis dafür, dass die erste Prophezeiung zum Tragen kommt.
Der Fluch des Hirschen nimmt noch eine weitere Funktion ein: Die angesprochene Spannung zwischen den beiden ersten Prophezeiungen wird erst durch ihn als verbindendes Element gelöst. Was der Hirsch sagt, so grausam es sein mag, ermöglicht sowohl Juliens irdischen Erfolg als auch seine Wandlung zum Heiligen, es ermöglicht die Erfüllung der beiden ersten Prophezeiungen trotz ihrer scheinbaren Widersprüchlichkeit. Denn Julien wird erst dadurch zum erfolgreichen, ruhmreichen Mann, der die Tochter des Kaisers heiratet, dass er dem Fluch bzw. der Prophezeiung zu entgehen versucht. Er ist so erfolgreich, weil er nicht sterben kann, ehe er nicht seine Eltern getötet hat und dafür Buße getan hat. Julien wird erst dadurch zum Heiligen, dass die Erfüllung des Elternmordes in ihm einen Reflexionsprozess anregt, der darin mündet, dass er für die Tat büßt. Die beiden ersten Prophezeiungen sind folglich für ihre Erfüllung darauf angewiesen, dass ihnen die dritte folgt – einerseits. Andererseits legen sie, oder die Art und Weise, wie die Protagonisten mit dem (Halb-)Wissen über sie verfahren, möglicherweise das Fundament, auf dem Juliens Grausamkeit überhaupt erst gedeiht.[29]
Oder stellt die Prophezeiung an die Mutter die allgemeinste, bedeutendste der drei dar? Sie steht am Anfang, und erfüllt sich als letzte. Insofern hat sie eine Rahmenfunktion innerhalb der Geschichte. Aus diesem Blickwinkel definieren die beiden folgenden Prophezeiungen lediglich den Weg, den Julien einschlägt, um schließlich zum Heiligen zu werden und die erste zu erfüllen. Das hieße, die erste würde die zwei anderen Weissagungen in gewisser Weise schon enthalten.
Welche Sichtweise man auch einnehmen will, es zeigt sich in jedem Fall, wie stark die Prophezeiungen – die beiden ersten der hier zu analysierenden Szene sowie die dritte, auf die bereits verwiesen wird – die Handlung grundlegend strukturieren und bestimmen. Daran anschließend wirft die vorgelegte Szene grundlegende Fragen auf – nach der Determinierung oder Freiheit Juliens, nach der direkten oder indirekten Wirkungsmacht der Weissagungen, nach ihrer Funktion, nach dem Interpretationsspielraum, der den Protagonisten bleibt und damit nach deren Rolle und Verantwortlichkeit. Damit erweist sich die vorgelegte Szene als zentral für „ La Légende de Saint Julien l’Hospitalier “.
Literaturverzeichnis
ANDERSEN, Hans Christian, Das Feuerzeug, in: Ders., Märchen, hg. v. Lisbeth Zwerger, Zürich u.a. 1996, S.45-54.
DE LA FONTAINE, Jean, L’Oiseau blessé d’une flèche, in: Ders., Oeuvres complètes I. Fables Contes et Nouvelles, hg. v. Jean-Pierre Collinet, Bibliothèque de la Pléiade 10, Paris 1991, S.77.
DE VORAGINE, Jacobus, Von Sanct Julianus, in: Ders.: Die Legenda Aurea, Gütersloh 1955, S.131f.
FLAUBERT, Gustave, La Légende de Saint Julien l’Hospitalier, in: Ders., Oeuvres II, hg. v. Albert Thibaudet, René Dumesnil, Bibliotèque de la Pléiade 37, Paris 1952, S. 623-648.
GRIMM, Jakob Ludwig Karl, GRIMM, Wilhelm Karl, Dornröschen, in: Dies., Grimms Märchen, hg. v. Arnica Esterl, Esslingen, Wien 1996, S. 31-38.
GRIMM, Jakob Ludwig Karl, GRIMM, Wilhelm Karl, Sterntaler. Märchen der Gebrüder Grimm, hg. v. Lesebuchausschuss der Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungswesens zu Hamburg, Braunschweig 1963.
HAMP, Vinzenz, STENZEL, Meinrad, KÜRZINGER, Josef (Hgg.), Die Bibel, München 2007, S.1218-1220.
JOHNSON, Bond, Flaubert’s Saint Julien: A Legend for Our Age, in: Ders., The Mode of Parody. An Essay at Definition and Six Studies, Frankfurt am Main u.a. 2000, S. 65 – 85.
OVID, Metamorphosen, hg. v. Niklas Holzberg, München 1990.
ZIMMERMANN, Bernhard (Hg.), Sophokles. König Ödipus. Studienausgabe, Düsseldorf, Zürich 1999.
[...]
[1] Gustave Flaubert, La Légende de Saint Julien l’Hospitalier, in: Ders., Oeuvres II, hg. v. Albert Thibaudet, René Dumesnil, Bibliotèque de la Pléiade 37, Paris 1952, S. 623-648. Im Folgenden wird diese Erzählung im Text als ‚ Légende ’ abgekürzt.
[2] Der Text setzt mit den Worten „ Le père et la mère de Julien “ ein. Das verweist möglicherweise bereits auf die Bedeutung der beiden für die spätere Handlung.
[3] Bond Johnson weist darauf hin, dass es sich nur scheinbar um eine Idylle handelt, da der materielle Reichtum auf Brutalität beruhe. Vgl. Bond Johnson, Flaubert’s Saint Julien: A Legend for Our Age, in: Ders., The Mode of Parody. An Essay at Definition and Six Studies, Frankfurt am Main u.a. 2000, S. 65-85, hier S. 71.
[4] Vgl. Flaubert, Saint Julien, S.631f.
[5] Damit geht eine sehr ausführliche, singulative Darstellung der Geschehnisse einher, zum Beispiel werden Sinneseindrücke aus Sicht der Mutter geschildert („ Les chants du banquet éclatèrent plus fort. Elle entendit (…)“), bildliche Ausdrucksweise herangezogen („ comme une ombre mouvante “) und der Beschreibung des greisen Mannes gleich vier Zeilen eingeräumt. Im sich anschließenden Abschnitt wird zwar wieder iterativ-gerafft erzählt, doch garantiert die Variation zwischen erlebter Rede, Gesprächsbericht und Bewusstseinsbericht eine besondere Anschaulichkeit und Nähe.
[6] Die Befragung der Diener durch die Mutter findet „ le lendemain “ statt, die Begegnung des Vaters mit dem ihm weissagenden Bettler aber schon „ au petit jour “.
[7] Dies wird belegt durch die Dominanz an Personalpronomen zu seiner Bezeichnung sowie durch die Darstellung seiner Gedanken als Bewusstseinsbericht, Gedankenzitat und erlebte Rede („ Personne! “).
[8] Vgl. Flaubert, Saint Julien, S. 626.
[9] Vgl. Ebd., S. 631f.
[10] „La nouvelle accouchée“ bzw. „le père de Julien“ befindet sich „dans son lit“ bzw. „en dehors de la poterne“, und zwar „un soir“ bzw. „au petit jour“. Die Lichtverhältnisse werden mit den Worten „un rayon de la lune“ bzw. „dans le brouillard“ geschildert. Ein „vieillard“ bzw. „un mendiant“ taucht auf rätselhafte Weise auf, wird zunächst ausführlich beschrieben, ehe er eine in direkter Rede wiedergegebene Prophezeiung ausspricht und „dispar(ait)“ bzw. „s’evanouit“. Es folgt jeweils eine Beschreibung der Atmosphäre und der Eindrücke der Figuren, die in erlebter Rede und Gedankenzitat über ihr Erlebnis nachdenken. Beide kommen zu dem Schluss, darüber Schweigen zu bewahren.
[11] Vgl. Johnson, A Legend, S.73f.
[12] Ebd.
[13] Vgl. Vinzenz Hamp, Meinrad Stenzel, Josef Kürzinger (Hgg.), Die Bibel, München 2007, hier S. 1218-1220. Dieser Referenztext steht in einer Similaritätsbeziehung zur vorliegenden Erzählung.
[14] Saulus ist „ entbrannt von Wut und Mordlust gegen die Jünger des Herrn “, vgl. Ebd., S. 1219.
[15] Ebd., S.1220.
[16] Beispielsweise verfügt er selbst, nunmehr in Armut zu leben (vgl. Flaubert, Saint Julien, S. 642f.) und nennt darüber hinaus die Umstände, die ihn den Mord begehen ließen, „ volonté de Dieu “ (Ebd., S. 643). Er selbst fertigt sich „ un cilice avec des pointes de fer “ (Ebd., S. 644) an. Inwiefern er für seine Entscheidung, sein Leben in den Dienst seiner Mitmenschen zu stellen, verantwortlich ist, lässt sich hier nicht eindeutig entscheiden, da die Formulierung „ l’idée lui vint “ (Ebd., S. 645) zumindest grammatikalisch gesehen nahe legt, dass irgend eine andere Instanz die Idee zu ihm hat kommen lassen, sie ihm also eingegeben hat.
[17] Jacobus de Voragine, Von Sanct Julianus, in: Ders.: Die Legenda Aurea, Gütersloh 1955, S. 131f.
[18] Die deutliche Bezugnahme zeigt sich bereits im Titel, aber auch u.a. in narratologischen Verfahren, die den Legendencharakter des Textes unterstreichen, so der relativ unbestimmte, aber eindeutig spätere Zeitpunkt des Erzählens, der heterodiegetische Erzähler, das meist singulative und chronologische Erzählen und der extradiegetische Kommentar am Ende. Es handelt sich um den einzigen Referenztext der im Folgenden besprochenen, der in Kontiguitätsbeziehung zum Phänotext steht. Alle anderen Texte sind der Légende in einer Similaritätsbeziehung verbunden.
[19] Vgl. Hamp, Die Bibel, S. 1074 und S. 1137.
[20] Bei Maria und Zacharias ist er als Engel Gabriel explizit benannt. Vgl. Ebd.
[21] Im Vergleich zur Prophezeiung des weisen Tiresias an die Mutter des Narziss in Ovids Metamorphosen erscheinen sie deutlich, wenn auch nicht unbedingt eindeutig. Narziss’ Mutter wendet sich mit der Frage an den Weissager, ob ihr Sohn ein hohes Alter erreichen werde. Er antwortet ihr: „ Wird sich selbst er nicht schauen!“. Die Mutter ist chancenlos, diese Aussage richtig zu interpretieren. Selbst wenn man die Geschichte kennt, kann man sich fragen, ob das heißen soll: ‚Ja, wenn er den Blick in den Spiegel (bzw. die sich spiegelnde Wasseroberfläche) vermeidet’? Oder: ‚Nein, denn er wird sich selbst nicht erkennen (und an der unerfüllbaren Liebe zu sich selbst zugrunde gehen)’? Vgl. Ovid, Metamorphosen, hg. v. Niklas Holzberg, München 1990, hier S. 88.
[22] Vgl. Hans Christian Andersen, Das Feuerzeug, in: Ders., Märchen, hg. v. Lisbeth Zwerger, Zürich u.a. 1996, S.45-54.; Jakob Ludwig Karl Grimm, Wilhelm Karl Grimm, Sterntaler. Märchen der Gebrüder Grimm, hg. v. Lesebuchausschuss der Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungswesens zu Hamburg, Braunschweig 1963; Jakob Ludwig Karl Grimm, Wilhelm Karl Grimm, Dornröschen, in: Dies., Grimms Märchen, hg. v. Arnica Esterl, Esslingen, Wien 1996, S. 31-38.
[23] Vgl. Flaubert, Saint Julien, S. 626.
[24] Vgl. Bernhard Zimmermann (Hg.), Sophokles. König Ödipus. Studienausgabe, Düsseldorf, Zürich 1999, hier S. 122-125.
[25] Laios lässt seinen Sohn aussetzen, nachdem ihm geweissagt wurde, sollte er einen Sohn zeugen, werde dieser ihn töten. Der von einem anderen Königspaar adoptierte Ödipus flieht vom Hof seiner vermeintlichen Eltern, um seinem Schicksal zu entgehen. Dabei gelangt er in das Land seiner echten Eltern, erschlägt seinen Vater und heiratet die Königin, seine Mutter. Im Folgenden erwehrt er sich der Wahrheit so lange es irgendwie geht. Vgl. Ebd.
[26] Vgl. Flaubert, Saint Julien, S. 642: „ en se disant, en voulant croire, que cela n’était pas possible, qu’il s’était trompé, qu’il y a parfois des ressemblances inexplicables.“
[27] Jean de La Fontaine, L’Oiseau blessé d’une flèche, in: Ders., Oeuvres complètes I. Fables Contes et Nouvelles, hg. v. Jean-Pierre Collinet, Bibliothèque de la Pléiade 10, Paris 1991, S. 77.
[28] Der Erfolg, der ihm bei seiner militärischen Karriere beschieden ist, beruht nun auf „ la faveur divine “ (S. 46) – aber ist es denn eine Gnade für Julien, nicht zu sterben? Er stirbt nicht, weil er nicht sterben soll, bevor er nicht die dritte Prophezeiung erfüllt hat.
Häufig gestellte Fragen
Was ist "La Légende de Saint Julien l’Hospitalier"?
"La Légende de Saint Julien l’Hospitalier" ist eine Erzählung von Gustave Flaubert. Der vorliegende Text ist eine akademische Analyse dieser Erzählung.
Worum geht es in der Einleitung?
Die Einleitung präsentiert eine Schlüsselstelle aus "La Légende de Saint Julien l’Hospitalier", die die Prophezeiungen über Juliens Zukunft enthält und für die Interpretation der Erzählung von zentraler Bedeutung ist.
Welche Prophezeiungen werden in der Erzählung thematisiert?
Es gibt zwei Prophezeiungen, die Juliens Eltern kurz nach seiner Geburt erhalten: Seine Mutter erfährt, dass Julien ein Heiliger sein wird, und sein Vater, dass er viel Ruhm ernten und stets glücklich sein wird, aber auch viel Blut vergießen wird.
Was bedeutet die narratologische Feinanalyse?
Die narratologische Feinanalyse untersucht die Erzähltechniken, wie Erzähltempo, Perspektivwechsel und Fokalisierung, um die Bedeutung der Prophezeiungsszene hervorzuheben und ihre Verbindung zu anderen Schlüsselmomenten der Erzählung aufzuzeigen.
Welche Rolle spielen Jesus und Saulus/Paulus in der Analyse?
Julien wird mit Jesus verglichen, um die Ironie seines luxuriösen Umfelds im Gegensatz zur Armut Jesu darzustellen. Der Vergleich mit Saulus/Paulus dient dazu, Juliens Wandlung vom Mörder zum Heiligen zu beleuchten, wobei Juliens eigene Entscheidungskraft im Gegensatz zu Paulus' göttlicher Berufung betont wird.
Inwiefern unterscheidet sich Flauberts Erzählung von der Legenda Aurea?
Im Gegensatz zur Legenda Aurea von Jacobus de Voragine, die Juliens Elternmord gleich zu Beginn vorwegnimmt, betont Flaubert die Prophezeiungen als entscheidendes Element und gibt ihnen innerhalb der Erzählung eine wichtige Stellung.
Welche anderen Referenztexte werden untersucht?
Neben der Legenda Aurea werden biblische Prophezeiungen (an Maria, Josef und Zacharias) sowie Märchen (Sterntaler, Das Feuerzeug, Dornröschen) untersucht, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Prophezeiungen in Flauberts Erzählung herauszuarbeiten.
Welche Bedeutung hat der Fluch des Hirsches?
Der Fluch des Hirsches, ausgesprochen nach Juliens grausamer Jagd, wird als dritte Prophezeiung betrachtet und mit den ersten beiden in Beziehung gesetzt. Er fungiert als verbindendes Element, das Juliens irdischen Erfolg und seine Wandlung zum Heiligen ermöglicht.
Inwiefern ähnelt Juliens Geschichte der des Ödipus?
Ähnlich wie Ödipus versucht Julien, dem Fluch zu entgehen, was ironischerweise zu dessen Erfüllung führt. Im Gegensatz zu Ödipus, der sich der Wahrheit verweigert, zeigt Julien Reue und wandelt sich.
Welche der Prophezeiungen ist die entscheidende?
Die Analyse diskutiert, ob die Prophezeiung an die Mutter (Julien wird ein Heiliger sein) als die grundlegendste betrachtet werden kann, da sie den Rahmen für Juliens Leben bildet und die anderen Prophezeiungen gewissermaßen schon enthält.
Was ist das Fazit der Analyse?
Die vorgelegte Szene mit den Prophezeiungen strukturiert die Handlung grundlegend. Sie wirft Fragen nach Determiniertheit versus Juliens Freiheit auf, nach der direkten oder indirekten Wirkungsmacht der Weissagungen, ihrer Funktion, und dem Interpretationsspielraum der Protagonisten, sowie nach deren Rolle und Verantwortlichkeit. Damit erweist sich diese Szene als zentral für „La Légende de Saint Julien l’Hospitalier“.
- Quote paper
- Sophie Friedl (Author), 2009, Verwobene Prophezeiungen. Narratologische und intertextuelle Überlegungen zur Schlüsselszene aus "Saint Julien l'Hospitalier" von Gustave Flaubert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316764