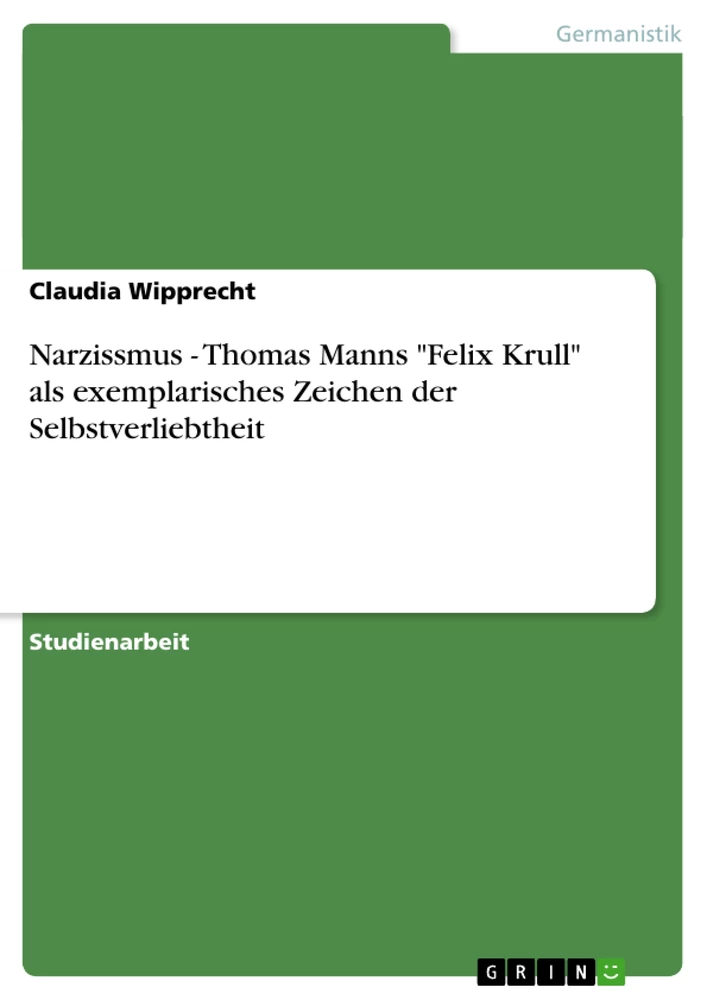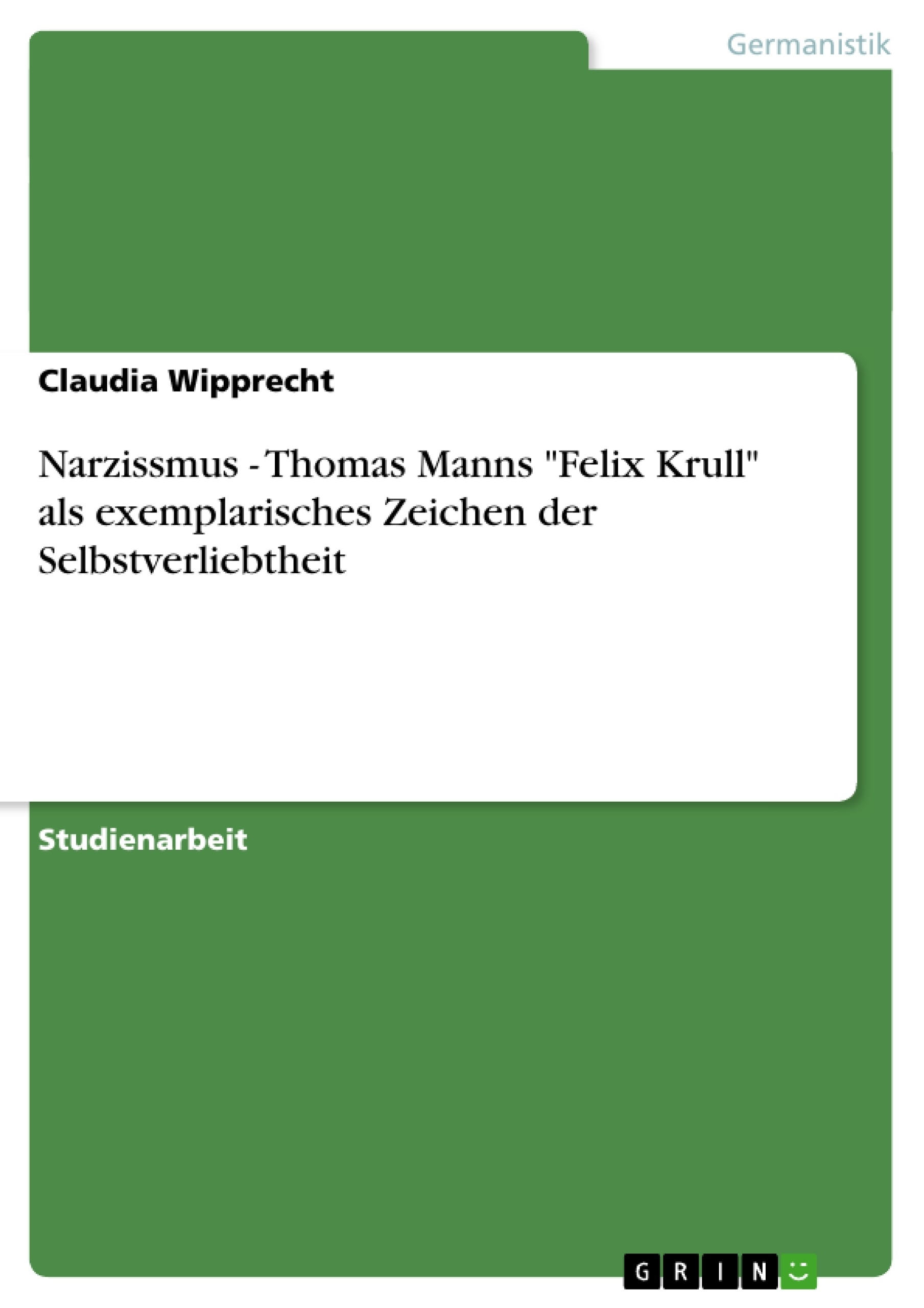Der Narziss (griechisch Narkissos, lateinisch Narcissus) war in der griechischen Mythologie ein schöner Jüngling, der als Produkt einer Vergewaltigung des argivischen Flussgottes Kephissos an der Nymphe Leiriope entstand. Er war ein sehr schöner Jüngling, der die Liebe der Frauen als auch der Männer allesamt verschmähte. Der Seher Teiresias hatte ihm vorausgesagt, dass er so lange leben wird, bis er sich selbst kennen gelernt hätte (nach OVID, Metamorphosen 3.339-356). Ab hier gibt es unterschiedliche Geschichten, das Ableben des Narziss’ betreffend.
Nach einer Überlieferung verliebte sich die Nymphe Echo in ihn. Er aber erwiderte auch ihre Liebe nicht, und sie verging aus Liebe zu ihm zur bloßen Stimme. Daraufhin bestrafte Nemesis Narziss damit, dass er sich in sein eigenes Spiegelbild verlieben sollte. Dies geschieht an einer Quelle bei Thespiae, wo er sein eigenes Spiegelbild erblickt und sich unsterblich verliebt. Da ihm aber das Objekt seiner Liebe, sein eigenes Spiegelbild unerreichbar bleibt, verzehrt er sich vor Sehnsucht danach und verwandelt sich letztendlich in die nach ihm benannte Narzisse.
Einer anderen Überlieferung zufolge soll Narziss eine ihm völlig gleichende Schwester gehabt haben. Die beiden liebten sich innig und begleiteten sich überall hin. Als die Schwester starb, versuchte Narziss, sie ihn seinem eigenen Spiegelbild wiederzufinden. Da ihm dies nicht gelang, erstach er sich und aus seinem Blut entspross die Narzisse.
Nach dem mythologischen Vorbild sind also Narzissten jene Menschen, die mit außerordentlicher Schönheit ‚geschlagen’ sind, die sich aber aus eitler Angst vor der Öffentlichkeit nur mit Menschen umgeben, die ihnen nach dem Mund reden, wie ein Echo. Diese Menschen ‚blühen’ nur in ihrer Jugend, wie die Narzisse im Frühling, und verblühen schnell, ohne auch nur den Anschein zu erwecken, jemals da gewesen zu sein.
Literarisch ist der Stoff des Narziss eine relativ späte Erscheinung. Die erste literarische Gestaltung nahm Ovid in seinen „Metamorphosen“ vor. Oscar Wilde benutzte ihn als Grundlage für sein Werk „The picture of Dorian Gray“. Auch Rilke beschäftigte sich in drei seiner zahlreichen Gedichte ausführlich mit dem Mythos des Narziss. In Thomas Manns „Felix Krull“ wird nach Hans Wysling durch Verknüpfung mit dem Hermes – Mythos der „Triumph des Narziss“ erreicht.
Inhaltsverzeichnis
- Mythologischer Hintergrund - der Narkissos
- Begriffsdefinition des Narzissmus bei Sigmund Freud
- Künstlertypus bei Thomas Mann
- Analyse der Sekundärliteratur
- Hans Wysling „Narzissmus und illusionäre Existenzform“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Narzissmus, insbesondere anhand Thomas Manns "Felix Krull", und beleuchtet den mythologischen Hintergrund des Narziss sowie die psychoanalytische Begriffsdefinition nach Freud. Die Arbeit analysiert, wie sich der Narzissmus im Roman manifestiert und setzt dies in Bezug zu Sekundärliteratur.
- Der Mythos des Narziss und seine literarische Rezeption
- Freuds psychoanalytische Theorie des Narzissmus
- Die Darstellung des Narzissmus in Thomas Manns "Felix Krull"
- Analyse der Sekundärliteratur zum Thema Narzissmus
- Verknüpfung von Mythos, Psychoanalyse und Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Mythologischer Hintergrund – der Narkissos: Dieser Abschnitt beleuchtet den griechischen Mythos des Narziss, eines wunderschönen Jünglings, der die Liebe anderer verschmähte und letztendlich in sein eigenes Spiegelbild verliebt war, sich verzehrte und in eine Narzisse verwandelte. Es werden verschiedene Versionen des Mythos präsentiert, die alle auf die Selbstverliebtheit und die Unfähigkeit zur echten Liebe hinweisen. Die literarische Rezeption des Mythos, von Ovid bis zu Rilke und seine Bedeutung für die Interpretation von Thomas Manns "Felix Krull" werden angedeutet.
Begriffsdefinition des Narzissmus bei Sigmund Freud: Hier wird Freuds psychoanalytische Definition des Narzissmus erläutert. Freud beschreibt den Narzissten als unfähig zur Liebe, da er die Machtübernahme durch andere fürchtet. Der Fokus liegt auf der libidinösen Besetzung des Selbst und der Unterscheidung zwischen primärem und sekundärem Narzissmus. Es werden verschiedene Interpretationen diskutiert, einschließlich der Ansicht des Narzissmus als Konzentration seelischen Interesses auf das Selbst und der Rolle des Selbstbildes in der Entwicklung von narzisstischen Persönlichkeitsstrukturen. Die unterschiedlichen Facetten des narzisstischen Charakters – übersteigerte Selbstliebe und verborgene Minderwertigkeitskomplexe – werden ebenfalls beleuchtet. Die Bedeutung von frühen Kindheitserfahrungen für die Entwicklung des Narzissmus nach Alice Miller wird ebenfalls einbezogen, wobei der Fokus auf dem Missbrauch von Kindern für die Befriedigung elterlicher Bedürfnisse liegt. Die Arbeit fokussiert sich besonders auf Freuds "Einführung des Narzissmus" von 1914 aufgrund der Relevanz für die Analyse von "Felix Krull".
Schlüsselwörter
Narzissmus, Thomas Mann, Felix Krull, Mythos, Narkissos, Sigmund Freud, Psychoanalyse, Selbstverliebtheit, Sekundärliteratur, Künstlertypus, illusionäre Existenzform, Minderwertigkeitskomplex, Selbstbild.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des Narzissmus in Thomas Manns "Felix Krull"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert den Narzissmus anhand von Thomas Manns Roman "Felix Krull". Sie untersucht den mythologischen Hintergrund des Narziss, Freuds psychoanalytische Definition des Narzissmus und die Manifestation des Narzissmus in "Felix Krull". Zusätzlich wird Sekundärliteratur zum Thema herangezogen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Mythos des Narziss und seine literarische Rezeption, Freuds psychoanalytische Theorie des Narzissmus, die Darstellung des Narzissmus in "Felix Krull", die Analyse relevanter Sekundärliteratur und die Verknüpfung von Mythos, Psychoanalyse und Literatur. Insbesondere wird die Bedeutung früher Kindheitserfahrungen für die Entwicklung des Narzissmus nach Alice Miller betrachtet.
Wie wird der mythologische Hintergrund des Narziss behandelt?
Der Abschnitt zum mythologischen Hintergrund beschreibt den griechischen Mythos des Narziss, seine verschiedenen Versionen und seine literarische Rezeption von Ovid bis Rilke. Der Fokus liegt auf der Selbstverliebtheit und Unfähigkeit zur echten Liebe des Narziss und dessen Relevanz für die Interpretation von "Felix Krull".
Wie wird Freuds psychoanalytische Definition des Narzissmus dargestellt?
Die Arbeit erläutert Freuds psychoanalytische Definition des Narzissmus, insbesondere die Unterscheidung zwischen primärem und sekundärem Narzissmus. Sie diskutiert die Unfähigkeit zur Liebe beim Narzissten aufgrund der Angst vor Machtübernahme durch andere, die libidinöse Besetzung des Selbst und die Rolle des Selbstbildes. Die Arbeit bezieht auch die Bedeutung früher Kindheitserfahrungen und den möglichen Missbrauch von Kindern für die Befriedigung elterlicher Bedürfnisse nach Alice Miller mit ein. Besonderes Augenmerk liegt auf Freuds "Einführung des Narzissmus" von 1914.
Welche Sekundärliteratur wird analysiert?
Die Hausarbeit bezieht sich explizit auf Hans Wyslings Werk „Narzissmus und illusionäre Existenzform“. Weitere Quellen werden implizit durch die Auseinandersetzung mit Freuds psychoanalytischer Theorie und der Interpretation des Mythos des Narziss genannt.
Wie wird der Narzissmus in "Felix Krull" dargestellt?
Die Arbeit analysiert, wie sich der Narzissmus in Thomas Manns Roman "Felix Krull" manifestiert, indem sie die oben genannten Aspekte (Mythos, Psychoanalyse, Sekundärliteratur) in Bezug zum Roman setzt. Konkrete Beispiele aus dem Roman werden jedoch nicht im Inhaltsverzeichnis oder der Zusammenfassung genannt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Narzissmus, Thomas Mann, Felix Krull, Mythos, Narkissos, Sigmund Freud, Psychoanalyse, Selbstverliebtheit, Sekundärliteratur, Künstlertypus, illusionäre Existenzform, Minderwertigkeitskomplex, Selbstbild.
- Quote paper
- Claudia Wipprecht (Author), 2004, Narzissmus - Thomas Manns "Felix Krull" als exemplarisches Zeichen der Selbstverliebtheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31673