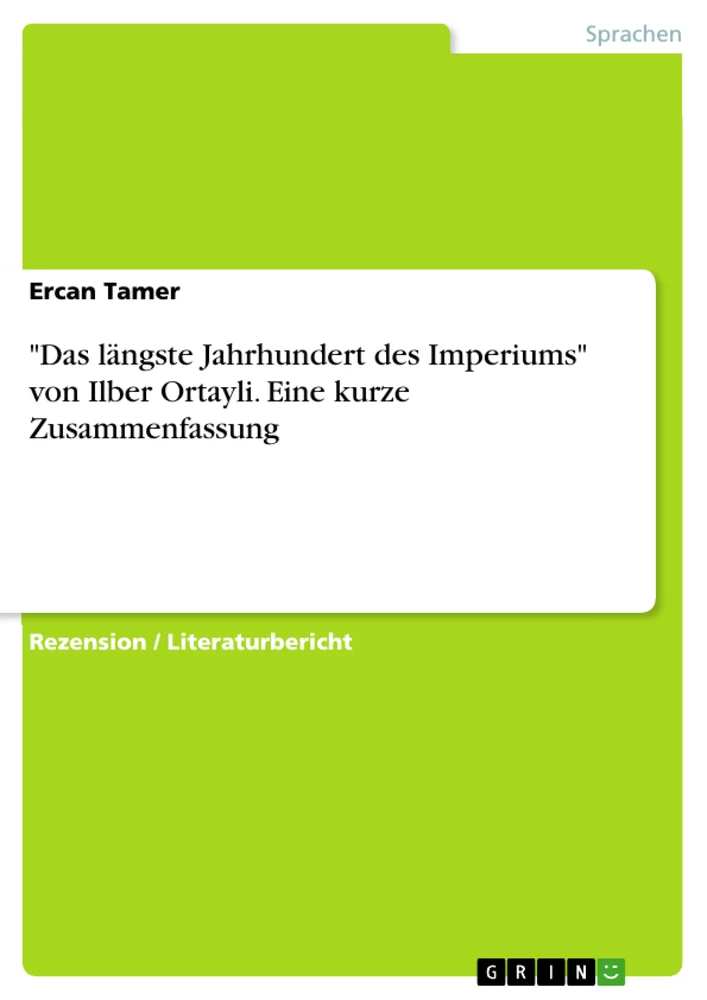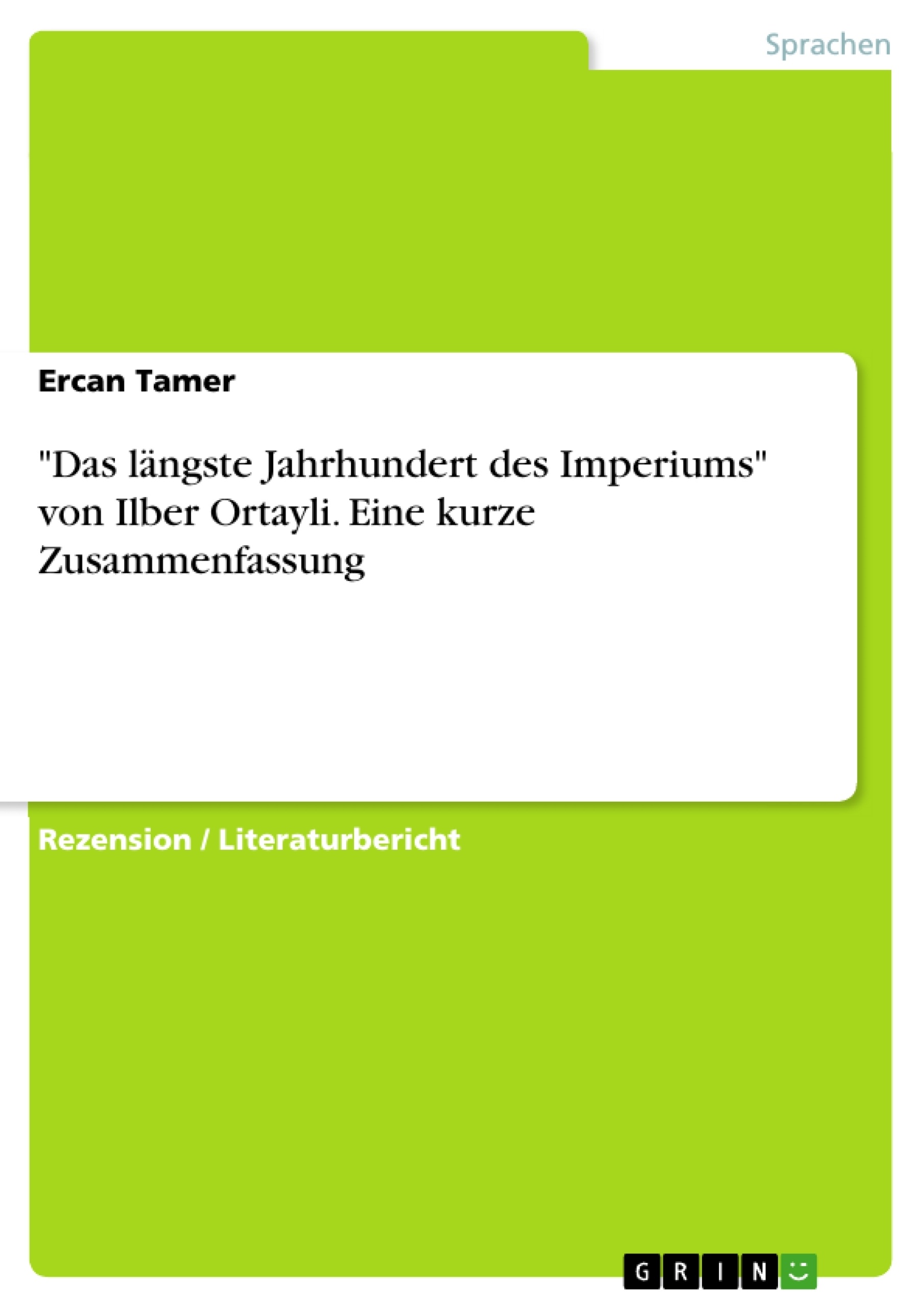Der türkische Historiker Prof. Dr. Ilber Ortayli beschreibt in seinem türkischsprachigen Werk "Imparatorlugun En Uzun Yüzyili" die letzten "atemzüge" eines Weltreiches, die des Osmanischen Reiches, das über 600 Jahre existiert hat.
Trotz des republikanischen Reformeifers haben einige osmanische Institutionen den Untergang des Imperiums überlebt und leben, wenn auch in anderer Form, in der jungen türkischen Republik weiter.
Die radikalsten Reformen waren mit Sicherheit die Abschaffung des weltlichen Sultanats und des religiösen Kalifats.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Beweggründe und Anfänge der Modernisierung
- III. Die Bab-i ali-Bürokraten der Tanzimat-Periode
- IV. Religion und Laizismus
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Ilber Ortaylıs Buch „Das längste Jahrhundert des Imperiums“ und untersucht verschiedene Phasen der osmanischen Modernisierung im 19. Jahrhundert. Das Ziel ist es, einen zusammenfassenden Überblick über die politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Transformationsprozesse zu geben und diese aus einer objektiven Perspektive zu betrachten.
- Osmanische Modernisierung im 19. Jahrhundert
- Rolle der Bab-i ali-Bürokraten
- Spannungsfeld zwischen Religion und Laizismus
- Autokratische Modernisierung im Osmanischen Reich
- Vergleich mit anderen autokratischen Systemen (z.B. Russland)
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein, das auf Ilber Ortaylıs Buch „Das längste Jahrhundert des Imperiums“ basiert. Sie skizziert den Ansatz der Arbeit, einen umfassenden Überblick über die osmanische Modernisierung im letzten Jahrhundert des Imperiums zu bieten, und beschreibt die Herausforderungen der Übersetzung des türkischen Originaltextes. Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel, deren Inhalte kurz vorgestellt werden.
II. Beweggründe und Anfänge der Modernisierung: Dieses Kapitel argumentiert gegen die Reduzierung der osmanischen Modernisierung auf die Tanzimat-Periode. Es betont die frühen Anfänge des Modernisierungsprozesses und dessen Auswirkungen auf die Religion, Institutionen und gesellschaftliche Strukturen. Der Einfluss europäischer Sprachen und wissenschaftlicher Ideen wird hervorgehoben, ebenso wie der Vergleich mit ähnlichen Entwicklungen unter Muslimen im zaristischen Russland. Das Kapitel analysiert die Gründe für die Modernisierung, die nicht allein auf externen Zwängen, sondern auch auf internen Entscheidungen beruhen. Der Begriff "Verwestlichung" (Batililasma) und seine Bedeutung im Kontext der osmanischen Geschichte wird diskutiert, wobei der Fokus über die Bab-i ali und die anatolische Halbinsel hinausgeht. Die osmanische Modernisierung wird als autokratisch charakterisiert und ihre Konsequenzen für die spätere türkische Republik werden angedeutet.
Schlüsselwörter
Osmanische Modernisierung, Tanzimat, Bab-i ali, Religion, Laizismus, Autokratie, Verwestlichung (Batililasma), Sened-i Ittifak, Selim III., Mahmud II., Alemdar Mustafa Pascha, Ayanlar, Usul-ü mesveret.
Häufig gestellte Fragen zu „Das längste Jahrhundert des Imperiums“ von Ilber Ortaylı
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text bietet eine umfassende Vorschau auf ein Werk, das Ilber Ortaylıs Buch „Das längste Jahrhundert des Imperiums“ analysiert. Er enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der osmanischen Modernisierung im 19. Jahrhundert.
Welche Themen werden im Buch behandelt?
Das Buch behandelt die osmanische Modernisierung im 19. Jahrhundert, die Rolle der Bab-i ali-Bürokraten, das Spannungsfeld zwischen Religion und Laizismus, die autokratische Natur der Modernisierung und Vergleiche mit anderen autokratischen Systemen (z.B. Russland). Es hinterfragt die gängige Reduzierung der Modernisierung auf die Tanzimat-Periode und beleuchtet frühere Anfänge und deren Auswirkungen.
Welche Kapitel umfasst die Analyse?
Die Analyse gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Beweggründe und Anfänge der Modernisierung, Die Bab-i ali-Bürokraten der Tanzimat-Periode, Religion und Laizismus und Fazit. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst. Die Einleitung beschreibt den Ansatz der Arbeit und die Herausforderungen der Übersetzung. Kapitel zwei widerlegt die Reduktion der osmanischen Modernisierung auf die Tanzimat-Periode und beleuchtet frühe Anfänge und deren Auswirkungen. Die weiteren Kapitel analysieren die Rolle der Bürokraten, das Spannungsfeld zwischen Religion und Laizismus und ziehen ein Fazit.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Osmanische Modernisierung, Tanzimat, Bab-i ali, Religion, Laizismus, Autokratie, Verwestlichung (Batililasma), Sened-i Ittifak, Selim III., Mahmud II., Alemdar Mustafa Pascha, Ayanlar und Usul-ü mesveret.
Was ist die Zielsetzung der Analyse?
Die Analyse zielt darauf ab, einen zusammenfassenden Überblick über die politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Transformationsprozesse der osmanischen Modernisierung im 19. Jahrhundert zu geben und diese aus einer objektiven Perspektive zu betrachten.
Wie wird die osmanische Modernisierung charakterisiert?
Die osmanische Modernisierung wird als autokratisch charakterisiert und ihre Konsequenzen für die spätere türkische Republik werden angedeutet. Der Text betont, dass die Modernisierung nicht allein auf externen Zwängen, sondern auch auf internen Entscheidungen beruhte. Der Begriff "Verwestlichung" (Batililasma) und seine Bedeutung im Kontext der osmanischen Geschichte wird kritisch diskutiert.
- Quote paper
- Ercan Tamer (Author), 1998, "Das längste Jahrhundert des Imperiums" von Ilber Ortayli. Eine kurze Zusammenfassung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3164