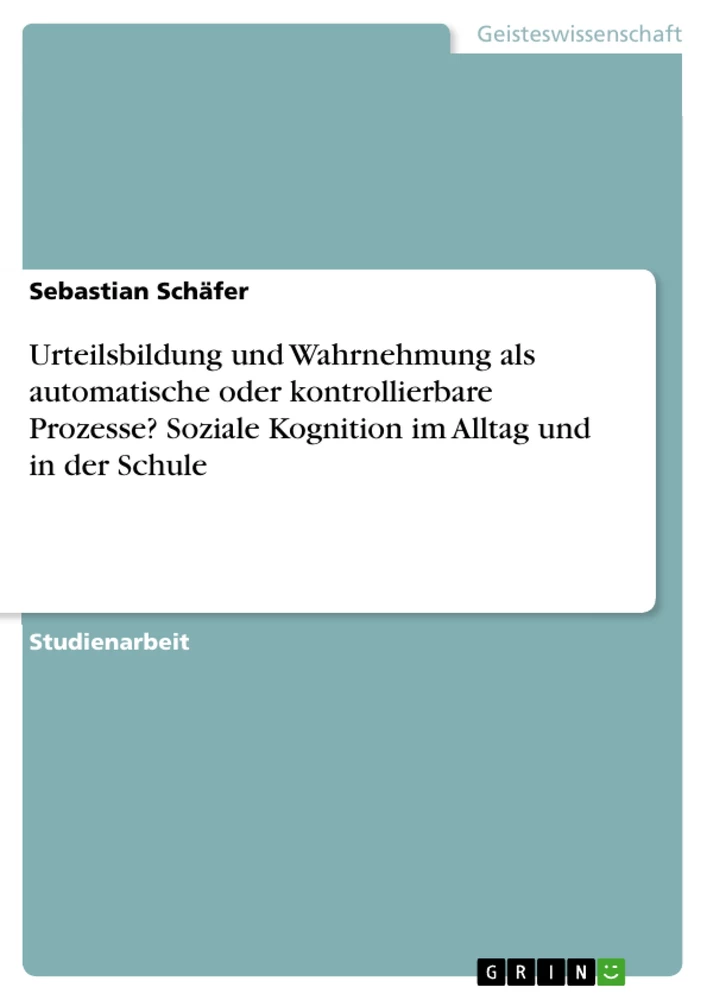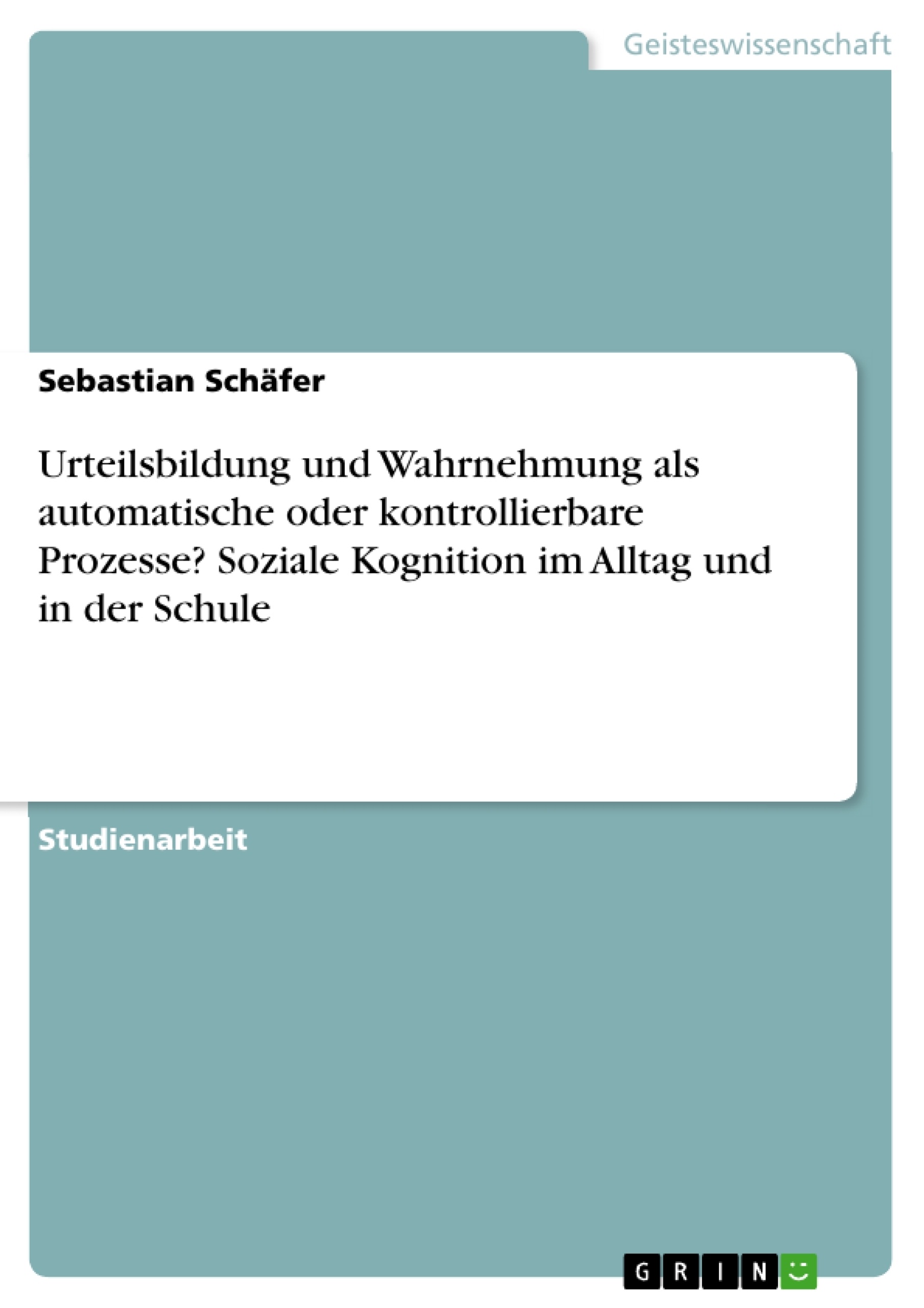Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Frage, ob wir unseren kognitiven Verarbeitungsschwächen gänzlich ausgeliefert sind oder ob wir unter bestimmten Umständen – durch mehr Aufwand und Überlegung – Kontrolle über unsere Urteilsbildung und Wahrnehmung erlangen können.
Die Art, wie wir denken, wirkt sich auf unser Sozialleben aus. Genauso beeinflusst auch die soziale Welt unser Denken. Soziale Kognitionen, die gewissermaßen als Schemata für unsere Wahrnehmung fungieren, helfen uns bei der schnellen Einordnung der unzähligen Umweltreize. Sie können uns aber auch zu Fehlinterpretationen verleiten. Denn Prozesse und Urteile laufen oft sehr schnell und automatisiert ab.
Zunächst werden einige Begriffsbestimmungen vorgenommen, grundlegende Prozesse der Wahrnehmung beschrieben und soziale Kognition aus genetischer und kultureller Perspektive betrachtet. Der Hauptteil beschäftigt sich dann zunächst mit sozialer Kognition als automatischer Prozess, wobei hier insbesondere auf die Begriffe Kategorisierung, Schemata und Stereotype eingegangen wird, die wiederum die Grundlage für die nachfolgenden Ausführungen sind. Abschließend rückt der kontrollierte Verarbeitungsprozess in den Fokus.
Bemerkenswert ist, dass sich nicht nur die Sozialpsychologie mit dem Phänomen der sozialen Kognition beschäftigt, sondern auch die moderne kognitive Neurowissenschaft. Insbesondere in klinischer Hinsicht lassen sich hierbei psychische Erkrankungen als Störungen sozial kognitiver Fähigkeiten besser verstehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen der Kognition
- 2.1 Definitionsansätze
- 2.2 Informationsverarbeitung
- 2.3 Grundlegende Prozesse der Wahrnehmung
- 3. Soziale Kognition
- 3.1 Begriffsbestimmung
- 3.2 Soziale Kognition - eine Grundausstattung des Menschen?
- 3.3 Kulturelle Unterschiede bezüglich sozialer Kognition
- 3.4 Begriffe im Kontext sozialer Kognition
- 4. Soziale Kognition als automatischer Prozess unser innerer Autopilot
- 4.1 Attributionsverzerrung
- 4.2 Funktionen von Schemata bzw. Stereotypen
- 4.3 Schema-Aktivierung und Verhalten
- 4.4 Sich selbst erfüllende Prophezeiung
- 4.5 Bedrohung durch Stereotype
- 5. Soziale Kognition – kontrollierter Prozess
- 5.1 Ist die Stereotypenaktivierung vermeidbar?
- 5.2 Möglichkeiten nach der Aktivierung eines Stereotyps
- 5.3 Sind Schemata bzw. Stereotypen veränderbar?
- 6. Zusammenfassung
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die soziale Kognition im Alltag und in der Schule. Sie beleuchtet die Frage, inwieweit wir unseren kognitiven Verarbeitungsschwächen ausgeliefert sind oder ob wir durch bewussten Aufwand Kontrolle erlangen können.
- Definition und Prozesse der sozialen Kognition
- Soziale Kognition als automatischer Prozess (inkl. Schemata, Stereotype und deren Auswirkungen)
- Soziale Kognition als kontrollierter Prozess und Möglichkeiten der Einflussnahme
- Kulturelle und genetische Aspekte der sozialen Kognition
- Bedeutung der sozialen Kognition für das Verständnis psychischer Erkrankungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema soziale Kognition ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Kontrollierbarkeit kognitiver Verarbeitungsschwächen im Kontext des täglichen Lebens und schulischer Situationen. Sie benennt exemplarische Alltagssituationen, die die schnelle und automatisierte Natur sozialer Kognitionsprozesse verdeutlichen. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und hebt die Bedeutung interdisziplinärer Perspektiven (Sozialpsychologie und kognitive Neurowissenschaft) hervor.
2. Grundlagen der Kognition: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen zum Verständnis von Kognition. Es präsentiert verschiedene Definitionsansätze von Kognition aus unterschiedlichen psychologischen Perspektiven, beschreibt das Modell der Informationsverarbeitung mit seinen einzelnen Stufen, und geht auf grundlegende Prozesse der Wahrnehmung, insbesondere die Unterscheidung zwischen konzeptgesteuerter („top-down“) und datengesteuerter („bottom-up“) Wahrnehmung ein. Diese Ausführungen bilden die Basis für das Verständnis der komplexeren Prozesse der sozialen Kognition in den folgenden Kapiteln.
3. Soziale Kognition: Dieses Kapitel definiert den Begriff der sozialen Kognition und beleuchtet verschiedene Aspekte dieses Prozesses. Es werden unterschiedliche Begriffsbestimmungen präsentiert und der Prozess der sozialen Kognition detailliert beschrieben. Zusätzlich werden die genetischen und kulturellen Einflüsse auf die Entwicklung und Ausprägung sozialer Kognition beleuchtet. Der Kapitel baut auf den Grundlagen der Kognition auf und bereitet den Weg zum Verständnis der automatischen und kontrollierten Prozesse der sozialen Kognition in den nachfolgenden Kapiteln.
Schlüsselwörter
Soziale Kognition, Wahrnehmung, Informationsverarbeitung, Schemata, Stereotype, automatische Prozesse, kontrollierte Prozesse, Attributionsverzerrung, kulturelle Unterschiede, kognitive Neurowissenschaft, psychische Erkrankungen.
Häufig gestellte Fragen zum Text über Soziale Kognition
Was ist der allgemeine Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet eine umfassende Übersicht über soziale Kognition. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung, Kapitelzusammenfassungen, Schlüsselbegriffe und behandelt die sozialen Kognitionsprozesse als automatische und kontrollierte Prozesse. Der Fokus liegt auf der Frage, inwieweit wir unsere kognitiven Verarbeitungsschwächen kontrollieren können, mit besonderer Berücksichtigung von Alltagssituationen und schulischen Kontexten.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themen: Definition und Prozesse der sozialen Kognition; Soziale Kognition als automatischer Prozess (inkl. Schemata, Stereotype und deren Auswirkungen); Soziale Kognition als kontrollierter Prozess und Möglichkeiten der Einflussnahme; kulturelle und genetische Aspekte der sozialen Kognition; Bedeutung der sozialen Kognition für das Verständnis psychischer Erkrankungen; Grundlagen der Kognition (Informationsverarbeitung, Wahrnehmung).
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und endend mit einem Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst. Der Text enthält außerdem ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte sowie eine Liste der Schlüsselbegriffe.
Was sind die zentralen Forschungsfragen des Textes?
Die zentrale Forschungsfrage ist, inwieweit wir die Kontrolle über unsere kognitiven Verarbeitungsschwächen im Alltag und in der Schule erlangen können. Der Text untersucht, ob wir unseren kognitiven Verarbeitungsschwächen ausgeliefert sind oder ob bewusster Aufwand zu mehr Kontrolle führt.
Welche Rolle spielen Schemata und Stereotype im Text?
Schemata und Stereotype werden im Kontext der automatischen Prozesse der sozialen Kognition behandelt. Der Text untersucht deren Funktionen, Aktivierung und Auswirkungen auf das Verhalten, einschließlich der „sich selbst erfüllenden Prophezeiung“ und der Stereotype Bedrohung. Es wird auch die Frage behandelt, ob und wie Schemata und Stereotype veränderbar sind.
Wie werden automatische und kontrollierte Prozesse der sozialen Kognition unterschieden?
Der Text unterscheidet zwischen automatischen und kontrollierten Prozessen der sozialen Kognition. Automatische Prozesse laufen schnell und unbewusst ab (z.B. Stereotypenaktivierung), während kontrollierte Prozesse bewusst und mit kognitivem Aufwand verbunden sind (z.B. bewusste Korrektur von Stereotypenurteilen). Der Text untersucht die Möglichkeiten, die Kontrolle über die automatischen Prozesse zu erhöhen.
Welche Rolle spielen kulturelle und genetische Aspekte?
Der Text beleuchtet den Einfluss kultureller und genetischer Faktoren auf die Entwicklung und Ausprägung sozialer Kognition. Es wird untersucht, ob und wie kulturelle Unterschiede die sozialen Kognitionsprozesse beeinflussen.
Welche Bedeutung hat der Text für das Verständnis psychischer Erkrankungen?
Der Text deutet die Bedeutung der sozialen Kognition für das Verständnis psychischer Erkrankungen an, ohne jedoch detailliert auf spezifische Erkrankungen einzugehen. Die Berücksichtigung sozialer Kognitionsprozesse kann zu einem besseren Verständnis von psychischen Problemen beitragen.
Welche Begriffe sind im Text besonders wichtig?
Schlüsselbegriffe des Textes sind: Soziale Kognition, Wahrnehmung, Informationsverarbeitung, Schemata, Stereotype, automatische Prozesse, kontrollierte Prozesse, Attributionsverzerrung, kulturelle Unterschiede, kognitive Neurowissenschaft und psychische Erkrankungen.
Wo finde ich weitere Informationen zu diesem Thema?
Der Text enthält ein Literaturverzeichnis, welches weitere Informationen und Quellen zum Thema Soziale Kognition bereitstellt.
- Quote paper
- Dipl. Sebastian Schäfer (Author), 2015, Urteilsbildung und Wahrnehmung als automatische oder kontrollierbare Prozesse? Soziale Kognition im Alltag und in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316432