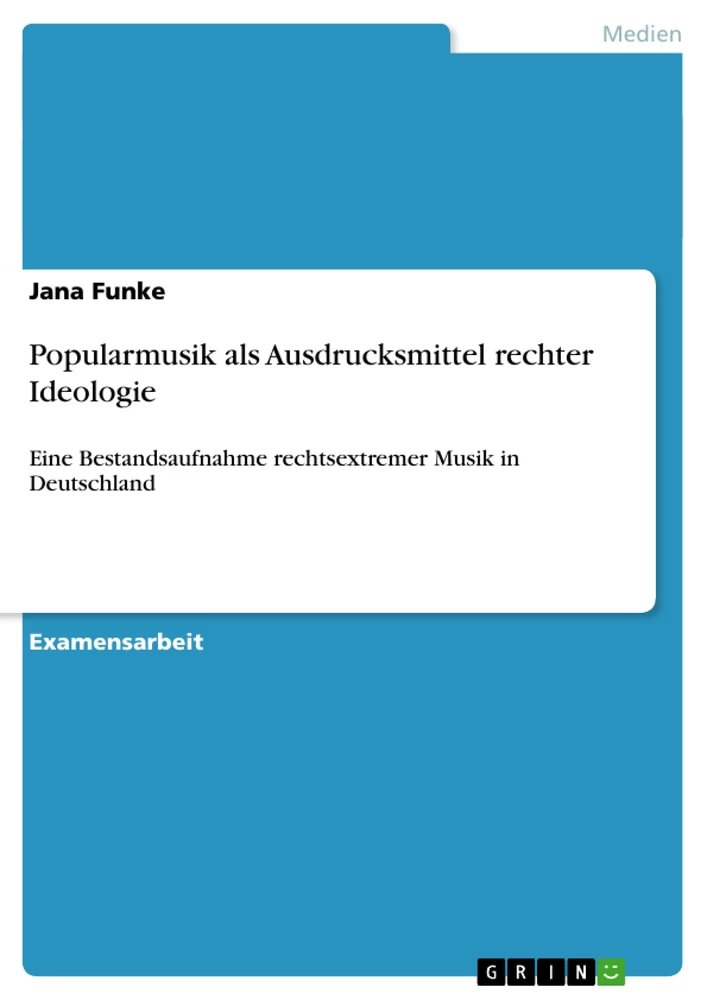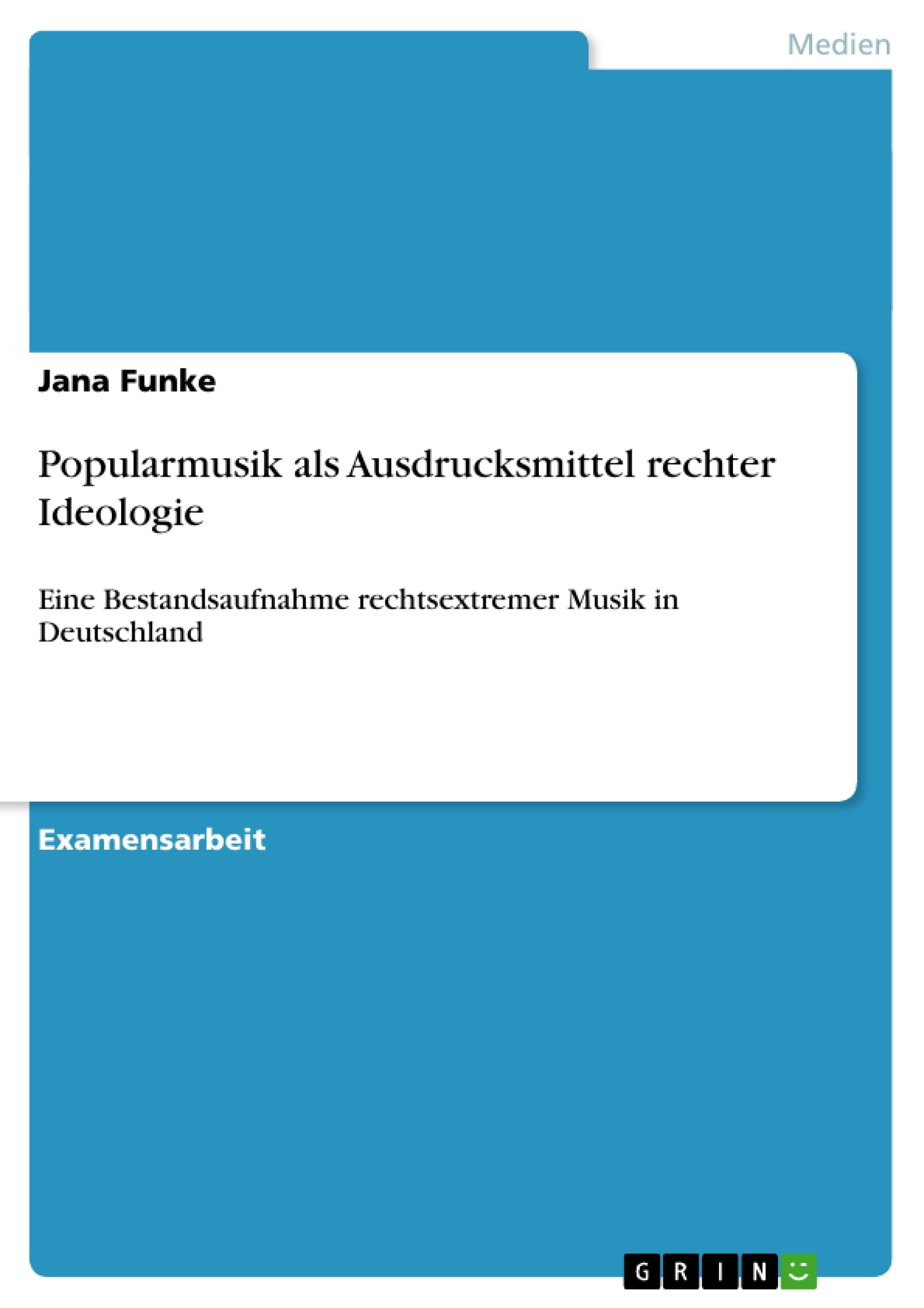Zur Zeit des Nationalsozialismus wurde Musik vorrangig als Ausdrucksmittel einer Ideologie genutzt. Über Lieder wurden nationalsozialistische Vorstellungen – formuliert in den Liedtexten – vermittelt. „Die Musik diente nicht dem Menschen, sondern der Staatsideologie und dem Führer.“ Christian Dornbusch und Jan Raabe urteilen über die Funktion von Musik in dieser Zeit: „Gemeinsames Musizieren, vor allem als kollektives Singen, wurde zu einem wichtigen Moment bei der Konstituierung nationalsozialistischer Volksgemeinschaft.“ Längst beschränkt sich der Bereich „rechtsextreme“ Musik nicht mehr auf alte NS-Lieder, Märsche oder Liedgut, das dem der NS-Zeit in musikalischer Gestaltung nachempfunden wurde und wird – vor allem in der mittlerweile verbotenen »Wiking-Jugend«, rechtsextremen Parteien und neonazistischen Organisationen verbreitet. Seit Ende der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts wird auch „moderne“ Popularmusik zum Ausdrucksmittel rechter Ideologie; erst Anfang der neunziger Jahre wurde dieses Phänomen in Deutschland einerseits verstärkt in der Öffentlichkeit wahrgenommen und andererseits zu einem der wichtigsten Instrumente zur Rekrutierung rechtsextremer und neonazistischer Sympathisanten. Im Zentrum steht auch heute noch eine rechtsextreme Skinhead-Szene, in deren Umfeld zahlreiche Bands entstanden sind. Dementsprechend halten Produktion und Verbreitung dieser Musik an.
Die vorliegende Arbeit soll gleichermaßen Analyse wie auch Bestandsaufnahme sein. Einerseits werden grundlegende Aspekte der Thematik „Rechtsextreme Popularmusik“ beleuchtet. Da es sich bei dieser Musik sowohl um ein politisches Phänomen als auch ein jugendkulturell-kommerzielles Medium handelt, gilt es Zusammenhänge mit politisch-ideologischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Gesichtspunkten herzustellen und demnach das Thema interdisziplinär zu bearbeiten. Diese Arbeit zielt zudem auf eine Differenzierung der verwendeten Musikgenres ab; des Weiteren wird im Schwerpunkt der Betrachtung auf inhaltlicher Ebene darzustellen sein, auf welche Weise diese Musik zum Ausdrucksmittel rechter Ideologie wird. Denn vielmehr als die musikalische Substanz ist es der ideologische Charakter, der „rechtsextreme“ Popularmusik primär kennzeichnet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsklärung
- 2.1 Rechtsextremismus und Neonazismus
- 2.2 Rechtsextreme Ideologie
- 2.3 „Rechtsextreme“ Musik?
- 3 Grundzüge der Geschichte des Rechtsrock
- 3.1 Wurzeln in Großbritannien: Skinheads und ihre Musik
- 3.1.1 Arbeiterklasse und Ska
- 3.1.2 Vom Punk zur Oi!-Musik
- 3.1.3 »Skrewdriver«: Beginn des Rechtsrock
- 3.2 Entwicklung des Rechtsrock in Deutschland
- 3.2.1 1979 bis 1989: Beginn des Rechtsrock in der BRD
- 3.2.2 1989 bis 1993: Radikalisierung
- 3.2.3 1994 bis heute: Zwischen Anpassung und Underground
- 3.1 Wurzeln in Großbritannien: Skinheads und ihre Musik
- Exkurs: Staatliche Maßnahmen
- 4 Zu den Strukturen der rechten Musikszene
- 4.1 Konzerte und Fanzines
- 4.1.1 Konzerte und ihre Funktionen
- 4.1.2 Zur Bedeutung von Fanzines
- 4.2 Netzwerkorganisationen
- 4.2.1 »Blood & Honour«
- 4.2.2 »Hammerskins«
- 4.3 Ökonomische Vernetzungen: Bands, Labels, Vertiriebe, Fanzines
- Fallbeispiel: Torsten Lemmer
- 4.4 Zur Bedeutung des Internets
- 4.1 Konzerte und Fanzines
- 5 Popularmusik als Ausdrucksmittel rechter Ideologie
- 5.1 Rechte Tendenzen in verschiedenen Musikgenres
- 5.1.1 Liedermacher
- 5.1.2 Dark Wave
- 5.1.3 Black Metal
- 5.1.4 HipHop
- 5.1.5 Techno
- 5.1.6 „Partymusik“: Schlager und NDW-Hits
- 5.2 Ideologische Fragmente in den Texten des Rechtsrock
- 5.2.1 „Liebe“
- 5.2.1.1 Zur Thematisierung von Frauen
- 5.2.1.2 Deutschland
- 5.2.2 Helden
- 5.2.2.1 Adolf Hitler, Rudolf Heß, Ian Stuart
- 5.2.2.2 Wehrmacht, SA, SS
- 5.2.2.3 Wikinger und nordische Götter
- 5.2.3 Feinde
- 5.2.3.1 „Ausländer“
- 5.2.3.2 Juden
- 5.2.3.3 „Linke“
- 5.2.3.4 Der Staat BRD und seine Vertreter
- 5.2.1 „Liebe“
- 5.1 Rechte Tendenzen in verschiedenen Musikgenres
- 6 Zu Funktion und Wirkung rechtsextremer Musik
- 6.1 Rechtsextreme Musik als Mittel für Propaganda und Rekrutierung
- 6.2 Zur Wirkung rechtsextremer Musik
- 6.2.1 Wirkung durch Emotionen und einfache Strukturen
- 6.2.2 Rechtsrock als Ursache von Gewalttaten und aggressivem Verhalten?
- 6.2.3 Rezipienten von Rechtsrock
- 6.2.4 Zum Stellenwert von Kontext und individueller Disposition
- 7 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwendung von Popularmusik als Vehikel rechtsextremer Ideologie in Deutschland. Ziel ist es, die Geschichte, Strukturen und Wirkungsweisen dieser Musik zu analysieren und deren Bedeutung für Propaganda und Rekrutierung zu beleuchten.
- Die Entwicklung des Rechtsrock von seinen britischen Wurzeln bis in die Gegenwart.
- Die Strukturen der rechten Musikszene, einschließlich Konzerte, Fanzines und Netzwerke.
- Die ideologischen Botschaften in den Texten rechtsextremer Musik.
- Die Wirkung rechtsextremer Musik auf das Publikum und ihr Potenzial zur Radikalisierung.
- Die Rolle des Internets in der Verbreitung rechtsextremer Musik.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass Popularmusik seit Ende der 1970er Jahre verstärkt als Mittel zur Verbreitung rechtsextremer Ideologie genutzt wird. Sie verweist auf den historischen Kontext des Nationalsozialismus und die Verwendung von Musik zur Propaganda und betont die zunehmende Bedeutung dieses Phänomens seit den 1990er Jahren. Der Fokus liegt auf der Analyse der "modernen" Popularmusik im Kontext des Rechtsextremismus, im Gegensatz zu traditionellen NS-Liedgut.
2 Begriffsklärung: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe Rechtsextremismus, Neonazismus und "rechtsextreme" Musik. Es differenziert zwischen verschiedenen Ausprägungen des Rechtsextremismus und definiert den Untersuchungsgegenstand, indem es die Einordnung von Musik in diesen Kontext präzisiert. Es legt den Grundstein für die anschließende Analyse, indem es die theoretischen Grundlagen festlegt.
3 Grundzüge der Geschichte des Rechtsrock: Dieses Kapitel zeichnet die historische Entwicklung des Rechtsrock nach, beginnend mit seinen Wurzeln in der britischen Skinhead-Szene und seiner Ausbreitung in Deutschland. Es beleuchtet die verschiedenen Phasen der Entwicklung, von den Anfängen bis zur heutigen Situation, die sich durch Anpassung und Underground-Aktivitäten kennzeichnet. Der Einfluss von Bands wie »Skrewdriver« und die Radikalisierung der Szene werden detailliert untersucht. Der Exkurs zu staatlichen Maßnahmen skizziert die Reaktionen der Behörden auf die rechtsextreme Musikszene.
4 Zu den Strukturen der rechten Musikszene: Das Kapitel beschreibt die Strukturen der rechten Musikszene. Es analysiert die Bedeutung von Konzerten als zentrale Treffpunkte und die Rolle von Fanzines als Kommunikationsmittel. Es konzentriert sich auf die Netzwerkorganisationen wie »Blood & Honour« und »Hammerskins«, um die Vernetzung und Verbreitung rechtsextremer Musik zu verdeutlichen. Die ökonomischen Aspekte, wie die Verflechtung von Bands, Labels und Vertriebswegen werden ebenso beleuchtet wie die Bedeutung des Internets für die Szene.
5 Popularmusik als Ausdrucksmittel rechter Ideologie: Dieses Kapitel untersucht, wie rechtsextreme Ideologie in verschiedenen Musikgenres zum Ausdruck kommt, von Liedermachern bis hin zu elektronischer Musik. Es analysiert die ideologischen Botschaften im Rechtsrock, indem es Themen wie "Liebe" (mit Fokus auf Frauenbild), "Helden" (mit Bezug auf historische Figuren und Mythen) und "Feinde" (mit der Darstellung von Ausländern, Juden und Linken) detailliert untersucht. Die Kapitel untersucht die vielschichtigen Ausdrucksformen rechter Ideologie in Musik und nicht nur den offensichtlichen Rechtsrock.
6 Zu Funktion und Wirkung rechtsextremer Musik: Dieses Kapitel befasst sich mit der Funktion rechtsextremer Musik als Propagandamittel und Rekrutierungsinstrument. Es analysiert die Wirkung der Musik auf das Publikum, unter Berücksichtigung von emotionalen und strukturellen Aspekten. Die potenzielle Verbindung zwischen Rechtsrock, Gewalt und aggressivem Verhalten wird ebenso diskutiert wie die Rolle von Kontextfaktoren und der individuellen Disposition des Rezipienten.
Schlüsselwörter
Rechtsextremismus, Neonazismus, Rechtsrock, Popularmusik, Propaganda, Rekrutierung, Ideologie, Musikgenres, Gewalt, Radikalisierung, Netzwerkstrukturen, Internet, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Rechtsrock und Rechtsextremismus in der Popularmusik"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Verwendung von Popularmusik als Vehikel rechtsextremer Ideologie in Deutschland. Der Fokus liegt auf der Geschichte, den Strukturen, den Wirkungsweisen und der Bedeutung dieser Musik für Propaganda und Rekrutierung. Im Gegensatz zu traditionellem NS-Liedgut konzentriert sich die Analyse auf "moderne" Popularmusik im Kontext des Rechtsextremismus.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Rechtsrock von seinen britischen Wurzeln bis heute, die Strukturen der rechten Musikszene (Konzerte, Fanzines, Netzwerke), die ideologischen Botschaften in rechtsextremer Musik, die Wirkung dieser Musik auf das Publikum und deren Radikalisierungspotenzial sowie die Rolle des Internets bei der Verbreitung rechtsextremer Musik. Es werden verschiedene Musikgenres untersucht, in denen rechtsextreme Tendenzen auftreten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Begriffsklärung, Geschichte des Rechtsrock, Strukturen der rechten Musikszene, Popularmusik als Ausdrucksmittel rechter Ideologie, Funktion und Wirkung rechtsextremer Musik und Fazit/Ausblick. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas und baut auf den vorherigen Kapiteln auf.
Welche Begriffe werden definiert?
Die Arbeit klärt zentrale Begriffe wie Rechtsextremismus, Neonazismus und "rechtsextreme" Musik. Es werden verschiedene Ausprägungen des Rechtsextremismus differenziert und der Untersuchungsgegenstand, die Einordnung von Musik in diesen Kontext, präzisiert.
Wie wird die Geschichte des Rechtsrock dargestellt?
Die historische Entwicklung des Rechtsrock wird von seinen Wurzeln in der britischen Skinhead-Szene und seiner Ausbreitung in Deutschland nachgezeichnet. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Entwicklungsphasen, den Einfluss von Bands wie "Skrewdriver" und die Radikalisierung der Szene. Staatliche Maßnahmen gegen die rechtsextreme Musikszene werden ebenfalls betrachtet.
Welche Strukturen der rechten Musikszene werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Bedeutung von Konzerten als zentrale Treffpunkte, die Rolle von Fanzines als Kommunikationsmittel und die Netzwerkorganisationen wie "Blood & Honour" und "Hammerskins". Die ökonomischen Aspekte (Bands, Labels, Vertrieb) und die Bedeutung des Internets werden ebenfalls beleuchtet.
Wie werden die ideologischen Botschaften in rechtsextremer Musik untersucht?
Die Arbeit untersucht, wie rechtsextreme Ideologie in verschiedenen Musikgenres zum Ausdruck kommt. Im Fokus steht die Analyse der ideologischen Botschaften im Rechtsrock, insbesondere die Themen "Liebe" (Frauenbild), "Helden" (historische Figuren, Mythen) und "Feinde" (Ausländer, Juden, Linke).
Welche Wirkung wird rechtsextremer Musik zugeschrieben?
Die Arbeit untersucht die Funktion rechtsextremer Musik als Propagandamittel und Rekrutierungsinstrument. Die Wirkung auf das Publikum wird unter Berücksichtigung emotionaler und struktureller Aspekte analysiert. Der potenzielle Zusammenhang zwischen Rechtsrock, Gewalt und aggressivem Verhalten sowie die Rolle von Kontextfaktoren und der individuellen Disposition des Rezipienten werden diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rechtsextremismus, Neonazismus, Rechtsrock, Popularmusik, Propaganda, Rekrutierung, Ideologie, Musikgenres, Gewalt, Radikalisierung, Netzwerkstrukturen, Internet, Deutschland.
Wo finde ich weitere Informationen?
(Hier könnte ein Hinweis auf weiterführende Literatur oder Webseiten eingefügt werden.)
- Quote paper
- Jana Funke (Author), 2004, Popularmusik als Ausdrucksmittel rechter Ideologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31639