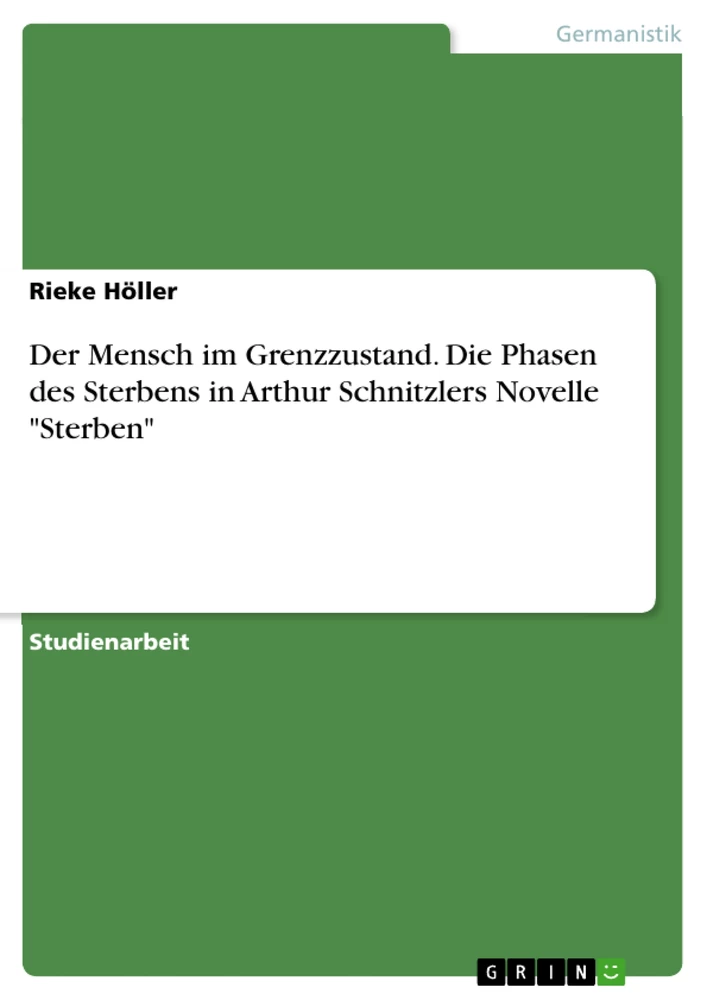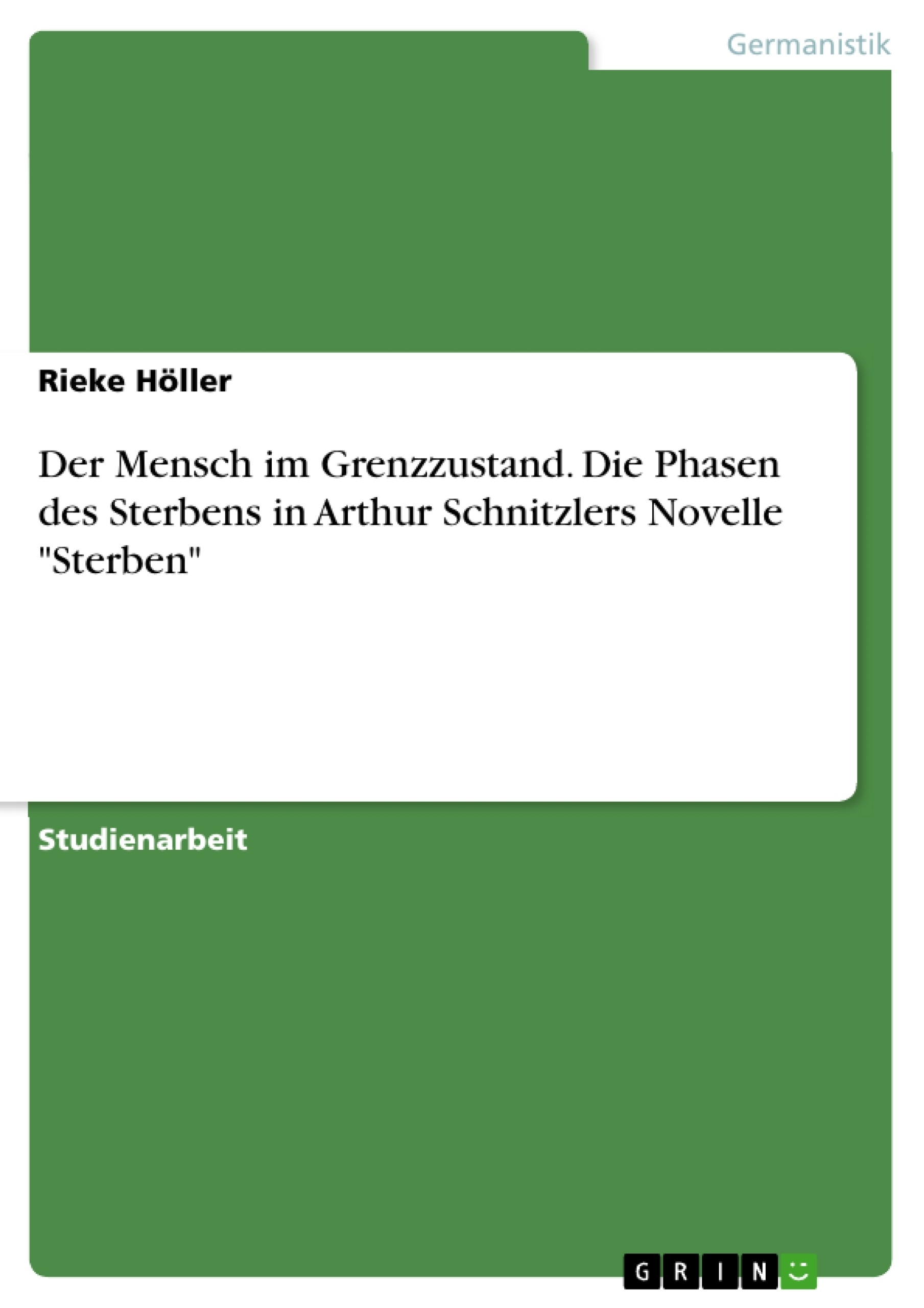„Das rein pathologische [!] ist nun einmal für die Kunst verloren, so rett ich [...] den Helden in einen Grenzzustand, einen Kampf, indem er unterliegt.“ Von dieser Prämisse ausgehend – notiert von Arthur Schnitzler in seinem Tagebuch - erfolgt meine literaturwissenschaftliche Analyse der Novelle "Sterben". Anhand ausgewählter Textbeispiele soll der „Grenzzustand“ skizziert werden, in dem sich sein Protagonist Felix von dem Moment an befindet, in dem er mit der Botschaft, die seine zukünftige Lebenszeit auf ein Jahr begrenzt, konfrontiert wird. Als „Beförderungsvehikel“ dient dem Autor Tuberkulose, die im Kontext der damaligen Zeit besprochen wird. Der Hauptfokus liegt auf dem Umgang des Todgeweihten und seiner Umwelt in Anbetracht der infausten Erkrankung.
Die eingesetzten literarischen Mittel des Autors werden kurz erörtert und da Felix’ Sterben an den Untergang einer Liebe geknüpft ist, werden auch die Auswirkungen seines Sterbensprozessen auf die Liebesbeziehung Gegenstand dieser Seminararbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Grausame Experiment
- Tuberkulose - eine todbringende Erkrankung
- Novellenarchitektur nach Pietzker
- Der „Mordversuch“
- Erzählstrategien in Sterben
- Prädisposition zum Pathologischen
- Else in Fräulein Else
- Felix in Sterben
- Prädisposition zum Pathologischen
- Liebe im Wandel der Jahreszeiten...
- Die Grenze
- Frühling
- Sommer
- Herbst
- Phasen des Sterben - Kübler-Ross
- Verschwörung des Schweigens
- Wut und Zorn
- Waffenstillstand durch Verhandlung
- Depression
- Frieden
- Regression in kindliche Abhängigkeit nach Bräutigam und Christian
- Literarisierung des therapeutischen Nihilismus
- Ärztliches Verhalten zwischen Aufklärung und Hoffnung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert Arthur Schnitzlers Novelle „Sterben“ und untersucht den „Grenzzustand“, in dem sich der Protagonist Felix befindet, nachdem er von seiner tödlichen Krankheit erfährt. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Sterbeprozesses, dem Umgang mit der Krankheit und den Auswirkungen auf die Liebesbeziehung zwischen Felix und Marie.
- Darstellung des Sterbeprozesses und der damit verbundenen Emotionen
- Analyse der literarischen Mittel, die Schnitzler einsetzt
- Die Rolle der Tuberkulose als „Beförderungsvehikel“ für den „Grenzzustand“
- Die Auswirkungen des Sterbeprozesses auf die Liebesbeziehung
- Schnitzlers literarische Auseinandersetzung mit dem Thema Tod und Krankheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Thematik der Seminararbeit und stellt die zentralen Fragestellungen vor. Das Kapitel „Das Grausame Experiment“ analysiert die literarische Gestaltung der Novelle und die Rolle der Tuberkulose als Krankheit und Metapher. Das Kapitel „Erzählstrategien in Sterben“ beleuchtet die literarischen Mittel, die Schnitzler zur Darstellung des Sterbeprozesses und der damit verbundenen Emotionen einsetzt. Das Kapitel „Liebe im Wandel der Jahreszeiten“ untersucht die Auswirkungen des Sterbeprozesses auf die Liebesbeziehung zwischen Felix und Marie. Das Kapitel „Phasen des Sterben - Kübler-Ross“ befasst sich mit den verschiedenen Phasen des Sterbens, die Schnitzler in seiner Novelle darstellt. Das Kapitel „Regression in kindliche Abhängigkeit nach Bräutigam und Christian“ untersucht die psychischen Auswirkungen des Sterbeprozesses auf Felix. Das Kapitel „Literarisierung des therapeutischen Nihilismus“ analysiert die Rolle des Arztes Alfred im Sterbeprozess und die Frage nach Hoffnung und Aufklärung.
Schlüsselwörter
Arthur Schnitzler, Sterben, Novelle, Tuberkulose, Krankheit, Tod, Liebe, Beziehung, Sterbeprozess, Erzählstrategien, Literaturwissenschaft, Grenzzustand, Pathologie, Nihilismus, Hoffnung, Aufklärung.
- Citar trabajo
- Rieke Höller (Autor), 2015, Der Mensch im Grenzzustand. Die Phasen des Sterbens in Arthur Schnitzlers Novelle "Sterben", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316332