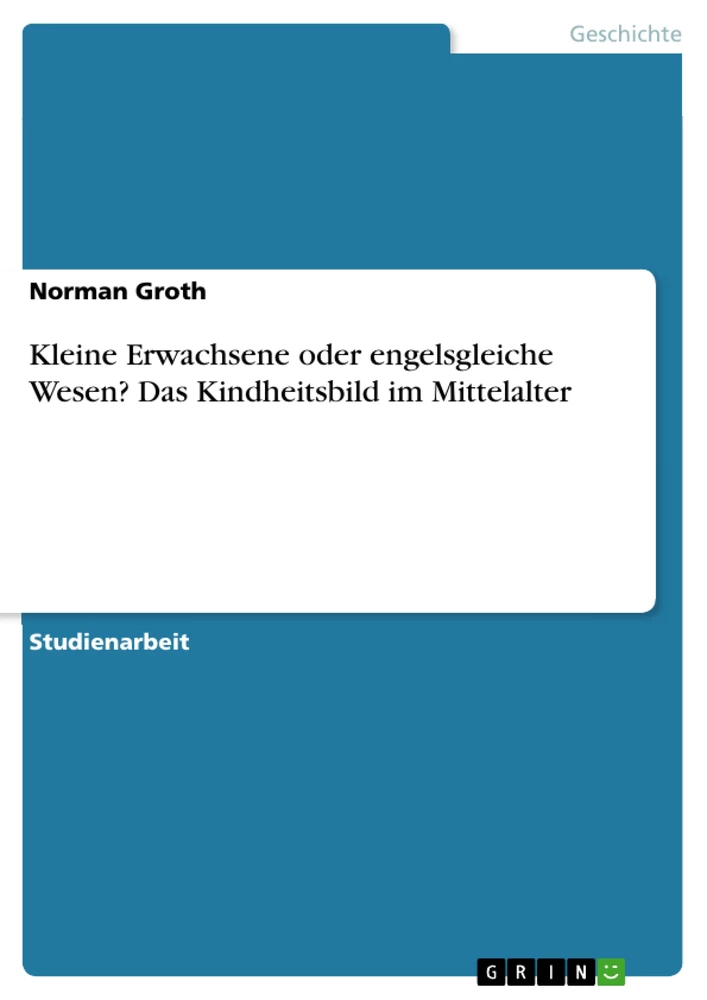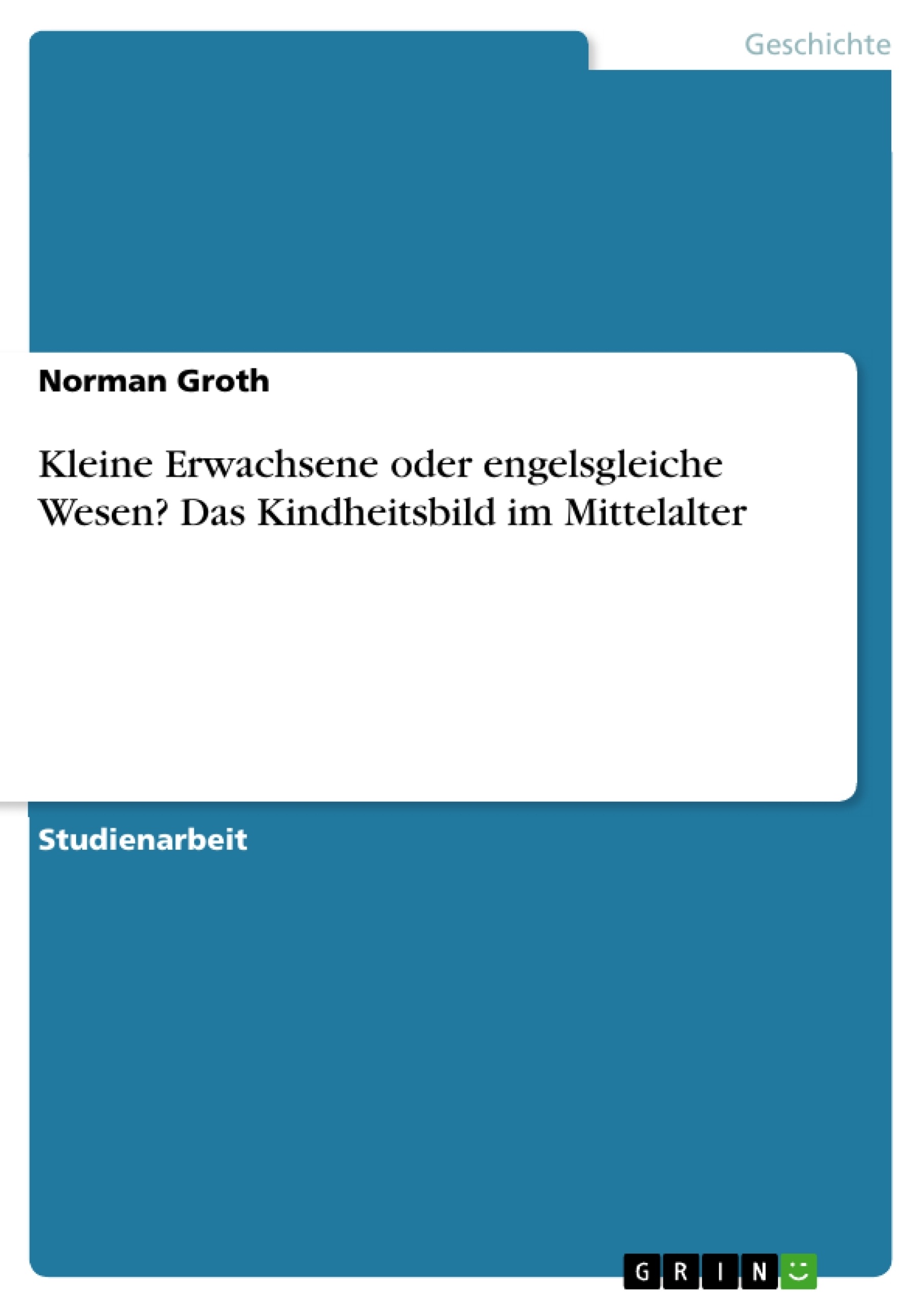In der Forschung über die mittelalterliche Betrachtungsweise des Verhältnisses von Kindern und Erwachsenen gibt es kontroverse Meinungen, was die Existenz von Erziehung und Bildung von Kindern betrifft. Wissenschaftler wie Philippe Ariès stellten die These auf, dass Kinder als „kleine Erwachsene“ wahrgenommen wurden, denen keine besondere Bedeutung zukam. Nach Koller sei Kindheit eine Errungenschaft der Neuzeit, die in Europa seit etwa 1500 allmählich aufkam. Erst im neunzehnten Jahrhundert hätte sie sich in allen Bevölkerungsschichten endgültig durchgesetzt. Roth beschreibt, dass es im Mittelalter kein Bild von Kindern gibt, an welchen erziehungstheoretische Inhalte angewendet worden wären.
Epochale Quellen aus dem Mittelalter zeigen durchaus ein mittelalterliches Verständnis von Kindheit und Erziehung, wie die Regel des Benedikt. Das Kloster nimmt hierbei eine zentrale Rolle der Bildung und Erziehung im Mittelalter ein, da die Gesellschaft sehr religiös war und das Kloster somit als zentrale Machtinstitution gesehen wurde. In dieser Hausarbeit geht es um den Zeitraum des Frühmittelalters bis zum Ende des Hochmittelalters. Diese Betrachtungsweise beschränkt sich dabei auf das 4. Jahrhundert bis zum 12. Jahrhundert.
Der Begriff der pueri oblati, also der Opferung des Kindes in die monastische Gemeinschaft des Klosters, ist hier Gegenstand des Verständnisses eines Bildes über Kindheit im Mittelalter. Die Kinder wurden standesunabhängig in die klösterliche Gemeinschaft aufgenommen und dies war durchaus üblich. Die Kinder besaßen für die monastische Gemeinschaft eine ‚engelsgleiche Reinheit‘ und hatten daher einen besonderen Stellenwert im Kloster.
In den nächsten Kapiteln werde ich mich zunächst mit der Auffassung des Wissenschaftlers Ariès beschäftigen, bezüglich der Einstellung des Verhältnisses von Kindern und Erwachsenen im Mittelalter, um so zunächst eine Grundbasis der Gegenseite im Diskurs darzustellen. Danach gehe ich auf die ambivalente Einstellung zur Kindheit ein, welche der Wissenschaftler Shahar aufzeigt, um so die Grundbasis der Befürworter eines Kindheitsbildes im Mittelalter darzustellen. Darüber hinaus wird eine Unterteilungen in verschiedene kindheitliche Entwicklungsphasen nach Shahar erfolgen und dargestellt. Im letzten Teil wird es dann darum gehen, welche Bedeutung die Erziehung im Kloster hatte, um so die These Ariès zu revidieren. Im Schlussteil fasse ich dann die Meinungen des Diskurses zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Einstellungen zur Kindheit nach Ariès
- Die Einstellung zur Zeugung und das Bild des Kindes- Eine Ambivalenz
- infantia, pueritia: Die ersten beiden Entwicklungsphasen des Kindes
- infantia
- pueritia
- Das Verständnis von Erziehung und Bildung für das mittelalterliche Kloster
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die kontroversen Sichtweisen auf das Verhältnis von Kindern und Erwachsenen im Mittelalter. Sie analysiert die unterschiedlichen Interpretationen des Kindheitsbildes und der Erziehungspraktiken dieser Epoche, mit besonderem Fokus auf die Rolle des Klosters als Bildungseinrichtung. Die Arbeit hinterfragt die These, dass Kinder als "kleine Erwachsene" betrachtet wurden und beleuchtet alternative Perspektiven.
- Das Kindheitsbild im Mittelalter: Kontroverse Interpretationen
- Die Rolle von Ariès' These der "kleinen Erwachsenen"
- Ambivalenzen in der Wahrnehmung von Zeugung und Kindheit
- Entwicklungsphasen der Kindheit (infantia und pueritia)
- Erziehung und Bildung im mittelalterlichen Kloster
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die kontroverse Debatte um das Verständnis von Kindheit und Erziehung im Mittelalter vor. Sie erwähnt verschiedene Wissenschaftler wie Ariès, der die These der „kleinen Erwachsenen“ vertritt, und Koller, der die Kindheit als Errungenschaft der Neuzeit sieht. Die Arbeit konzentriert sich auf das Früh- und Hochmittelalter (4. bis 12. Jahrhundert) und untersucht die Rolle des Klosters als zentrale Institution für Bildung und Erziehung, insbesondere im Kontext des Begriffs der „pueri oblati“. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und kündigt die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Positionen im Diskurs an.
Die Einstellungen zur Kindheit nach Ariès: Dieses Kapitel analysiert Ariès' These, dass es im Mittelalter kein eigenständiges Kindheitsbild gab. Ariès argumentiert anhand von ikonografischen Beispielen aus der mittelalterlichen Kunst, dass Kinder als verkleinerte Erwachsene dargestellt wurden und keine spezifischen kindlichen Merkmale aufwiesen. Er interpretiert dies als Indiz für eine gesellschaftliche Gleichgültigkeit gegenüber Kindheit, die er mit der Vorstellung einer „traditionellen Gleichgültigkeit“ beschreibt, wo Kinder als Quelle der Erheiterung gesehen wurden. Ariès' Interpretation wird kritisch hinterfragt und im weiteren Verlauf der Arbeit relativiert.
Schlüsselwörter
Kindheit, Mittelalter, Erziehung, Bildung, Kloster, Ariès, pueri oblati, Kindheitsbild, ikonografie, Ambivalenz, Entwicklungsphasen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mittelalterliche Kindheit – Eine Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die kontroversen Sichtweisen auf das Verhältnis von Kindern und Erwachsenen im Mittelalter. Sie analysiert unterschiedliche Interpretationen des Kindheitsbildes und der Erziehungspraktiken dieser Epoche, mit besonderem Fokus auf die Rolle des Klosters als Bildungseinrichtung. Ein zentrales Thema ist die Hinterfragung der These, dass Kinder als "kleine Erwachsene" betrachtet wurden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Das Kindheitsbild im Mittelalter und dessen kontroverse Interpretationen; die Rolle von Ariès' These der "kleinen Erwachsenen"; Ambivalenzen in der Wahrnehmung von Zeugung und Kindheit; Entwicklungsphasen der Kindheit (infantia und pueritia); und Erziehung und Bildung im mittelalterlichen Kloster.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Die Einstellungen zur Kindheit nach Ariès, Die Einstellung zur Zeugung und das Bild des Kindes – Eine Ambivalenz, infantia, pueritia: Die ersten beiden Entwicklungsphasen des Kindes, Das Verständnis von Erziehung und Bildung für das mittelalterliche Kloster, und Schlussbetrachtung.
Wie wird Ariès' These behandelt?
Die Arbeit analysiert kritisch Ariès' These, dass es im Mittelalter kein eigenständiges Kindheitsbild gab und Kinder als verkleinerte Erwachsene dargestellt wurden. Ariès' Interpretation wird anhand ikonografischer Beispiele aus der mittelalterlichen Kunst erläutert und im weiteren Verlauf der Arbeit relativiert.
Welche Rolle spielt das Kloster in der Arbeit?
Das Kloster wird als zentrale Institution für Bildung und Erziehung im Mittelalter untersucht, insbesondere im Kontext des Begriffs der „pueri oblati“. Die Arbeit beleuchtet das Verständnis von Erziehung und Bildung innerhalb des klösterlichen Rahmens.
Welche Zeitperiode wird untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf das Früh- und Hochmittelalter (4. bis 12. Jahrhundert).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kindheit, Mittelalter, Erziehung, Bildung, Kloster, Ariès, pueri oblati, Kindheitsbild, ikonografie, Ambivalenz, Entwicklungsphasen.
Welche weiteren Wissenschaftler werden erwähnt?
Neben Ariès wird Koller erwähnt, der die Kindheit als Errungenschaft der Neuzeit sieht.
- Quote paper
- Norman Groth (Author), 2013, Kleine Erwachsene oder engelsgleiche Wesen? Das Kindheitsbild im Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315736