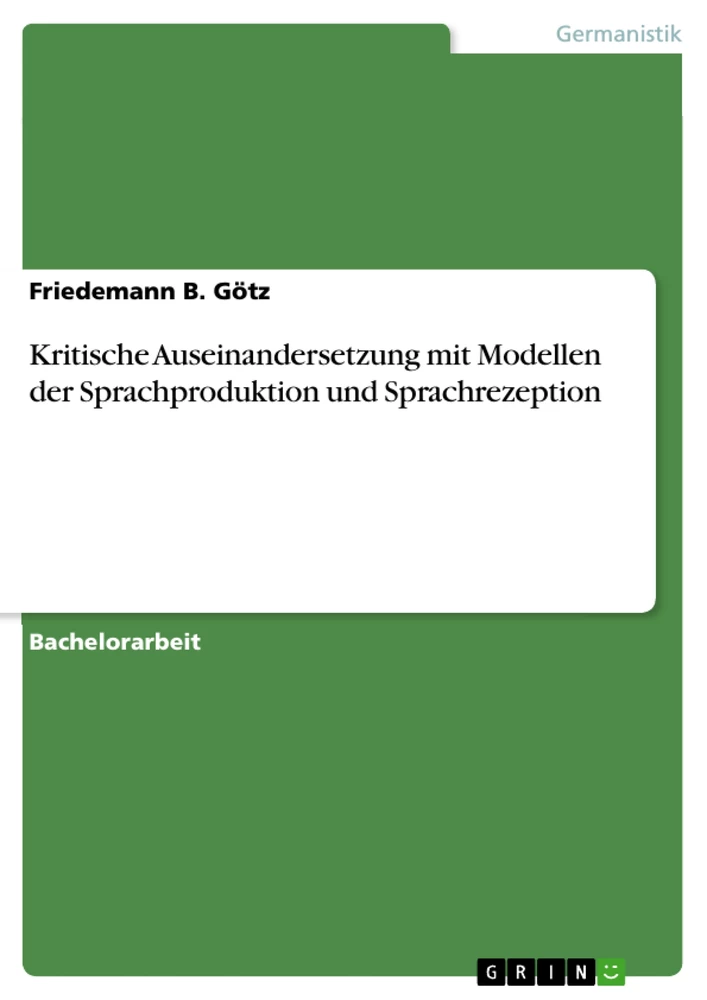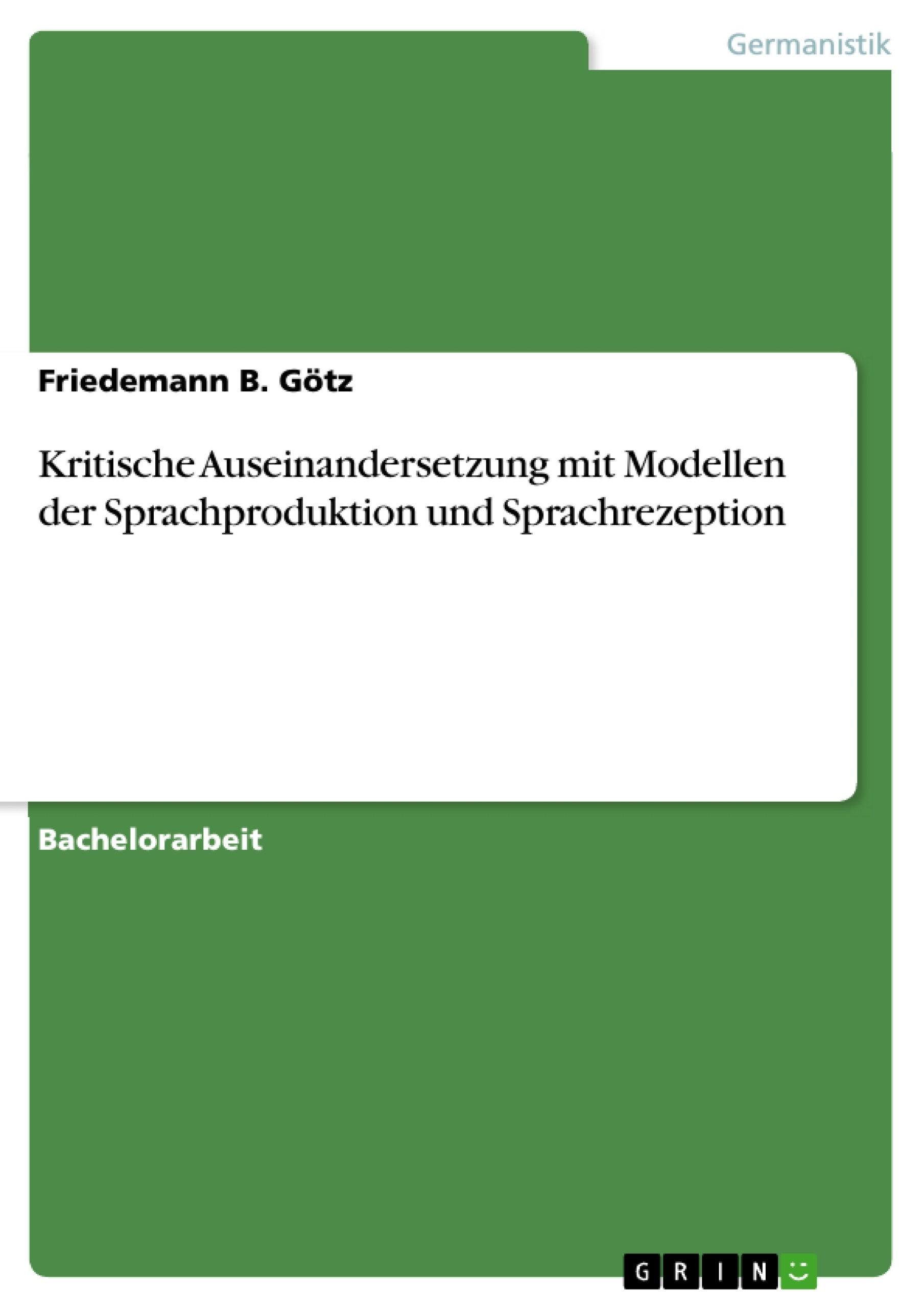Menschliche Sprache ist von zentraler Wichtigkeit im Alltag und eine außerordentliche Fähigkeit, die den Menschen von allen anderen Lebewesen unseres Planeten unterscheidet. Das Thema dieser Bachelorarbeit ist die kritische Auseinandersetzung mit eben den Prozessen, die hinter der Sprachrezeption und der Sprachproduktion stehen. Da man zwar die physiologischen Aktivitäten unseres Gehirns betrachten kann, jedoch nicht dessen genaue Funktionsweise, werden Theorien und Modelle zu dessen Ergründung angefertigt, wovon hier eine Auswahl vorgestellt wird.
Wodurch ist die Entwicklung der Sprachfähigkeit bedingt? Nicht nur haben sich der Kehlkopf, der Rachenraum, die Zunge und die Lippen stark weiterentwickelt, was sie zu geeigneten Instrumenten der Artikulation menschlicher Sprache macht, sondern stehen sie auch unter der Kontrolle besser entwickelter Gehirnregionen. Tierische Laute spiegeln direkt die Emotionen des Tieres wieder und stehen unter der Kontrolle des anterioren Gyrus cinguli, welcher zum limbischen System gehört. Die Artikulationsorgane des Menschen werden jedoch vom Neocortex kontrolliert, was eine Neuheit in der Evolution darstellt. Das alte Äußerungssystem wurde jedoch nicht vollständig abgelegt. So drückt der Mensch auch heute noch Emotionen, welche vom limbischen System ausgehen, durch die Sprachmelodie, die Prosodie, aus. Die Kreationen durch das Zusammenspiel der nun kontrollierbaren Organe bilden Silben, die mit einer gewissen Bedeutung angereichert werden. Diese Beziehung wird anschließend festgehalten und zur Reproduktion gespeichert. Dies ist der erste große Entwicklungsschritt zur menschlichen Sprache.
Der zweite Schritt ist bedingt durch die Entwicklung neuer sozialer Kompetenzen. Wie schon angesprochen hat der Mensch das zwischenmenschliche Fellpflegeverhalten weitgehend abgelegt und die Sprache an dessen Stelle für sich entdeckt. Der verhältnismäßig große Neocortex des Homo sapiens, welcher der Erkennung von Personen durch Gesicht und Stimme, der Erkennung von Gesichtsausdrücken und den Sprachprozessen dient, unterstützt die Theorie von Dunbar (1992), wonach die Größe dieser speziellen Gehirnregion stark von der durchschnittlichen Gruppengröße eines Lebewesens abhängig ist. Mit der stetig wachsenden Komplexität der sozialen Beziehungen in menschlichen Gruppen, ist diese Entwicklung leicht nachvollziehbar.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- I. Einführung
- 1. Erster Überblick über die Sprachproduktion und die Sprachrezeption
- 2. Definition „Modell“
- 3. Praktischer Aspekt
- II. Methodisches Vorgehen
- 1. Auseinandersetzung mit Versprechern
- 2. Analyse von Sprechpausen
- 3. Rückschlüsse durch Aphasien
- 4. Beobachtung zerebraler Vorgänge
- 5. Experimentelle Methoden
- 6. Simulative Methodik
- 7. Kritik an Methoden
- III. Sprachrezeption
- 1. Klassifizierung der Theorien
- 2. Theorien zur Worterkennung
- 3. Theorien des Satzverständnisses
- 4. Theorien der Diskursrezeption
- IV. Sprachproduktion
- 1. Klassifizierung der Theorien
- 2. Sprachproduktionsmodell nach Garrett
- 3. Sprachproduktionsmodell nach Dell
- 4. Zusammenfassende und vergleichende Kommentare I
- 5. Sprachproduktionsmodell nach Levelt
- A. Prämissen
- B. Einzelne Module und Teilprozesse
- 1. Die Konzeptualisierung
- 2. Die Formulierung
- 3. Die Artikulation
- 4. Monitoring und Reparatur
- 6. Zusammenfassende und vergleichende Kommentare II
- V. Fokus auf die Lexikalisierung
- 1. Das mentale Lexikon
- 2. Lexikalisierung
- 3. Eine eigene Theorie zur Lexikalisierung
- A. Struktur
- 1. die konzeptuelle Ebene
- 2. die Meta-Ebene
- 3. die Lexem-Ebene
- 4. Nach der Lexem-Ebene
- B. Generelle Anmerkungen
- C. Schlussbemerkung zum eigenen Lexikalisierungsmodell
- VI. Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Ziel dieser Bachelorarbeit ist eine kritische Auseinandersetzung mit den Modellen und Theorien zur Sprachproduktion und Sprachrezeption. Sie bietet einen Überblick über verschiedene Ansätze und untersucht deren Stärken und Schwächen. Dabei wird ein Fokus auf die Lexikalisierung gelegt, wobei eine eigene Theorie zur Lexikalisierung entwickelt wird.
- Analyse von Sprachproduktion und Sprachrezeption als kognitive Prozesse
- Bewertung verschiedener Modelle und Theorien zur Sprachproduktion und Sprachrezeption
- Untersuchung der Rolle der Lexikalisierung in der Sprachproduktion
- Entwicklung eines eigenen Modells zur Lexikalisierung
- Kritische Reflexion über die Grenzen und Möglichkeiten der Modellierung kognitiver Prozesse
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einführung beleuchtet die Besonderheiten der menschlichen Sprache und die Relevanz der Sprachproduktion und Sprachrezeption. Es wird eine grundlegende Definition des Begriffs "Modell" gegeben und der praktische Aspekt der Modellierung von Sprachprozessen erläutert. Das zweite Kapitel widmet sich methodischen Ansätzen, um Sprachproduktion und Sprachrezeption zu erforschen. Hier werden verschiedene Methoden, wie die Analyse von Versprechern, Sprechpausen, Aphasien und experimentelle Verfahren vorgestellt. Im dritten Kapitel wird die Sprachrezeption im Fokus stehen. Es erfolgt eine Klassifizierung der Theorien zur Worterkennung, zum Satzverständnis und zur Diskursrezeption. Das vierte Kapitel widmet sich der Sprachproduktion. Es erfolgt eine Klassifizierung der Theorien und eine detaillierte Analyse verschiedener Sprachproduktionsmodelle, darunter das Modell nach Garrett, Dell und Levelt. Das fünfte Kapitel konzentriert sich auf die Lexikalisierung und erörtert das mentale Lexikon, den Prozess der Lexikalisierung und entwirft eine eigene Theorie zu diesem Thema. Der Schlussteil fasst die Ergebnisse zusammen und reflektiert die Bedeutung der vorgestellten Modelle und Theorien für das Verständnis von Sprachproduktion und Sprachrezeption.
Schlüsselwörter (Keywords)
Sprachproduktion, Sprachrezeption, Modelle, Theorien, Lexikalisierung, mentales Lexikon, Sprachproduktionsprozesse, Sprachrezeptionsprozesse, kognitive Prozesse, Psycholinguistik, Versprecher, Aphasien, Worterkennung, Satzverständnis, Diskursrezeption, kritische Auseinandersetzung.
- Quote paper
- Friedemann B. Götz (Author), 2013, Kritische Auseinandersetzung mit Modellen der Sprachproduktion und Sprachrezeption, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315707