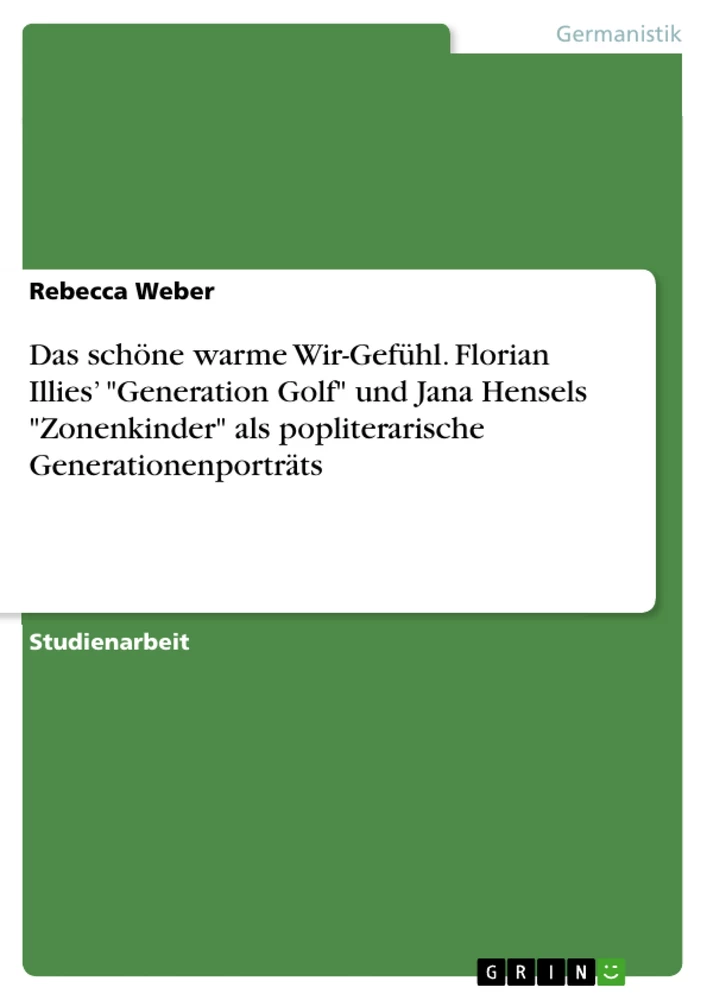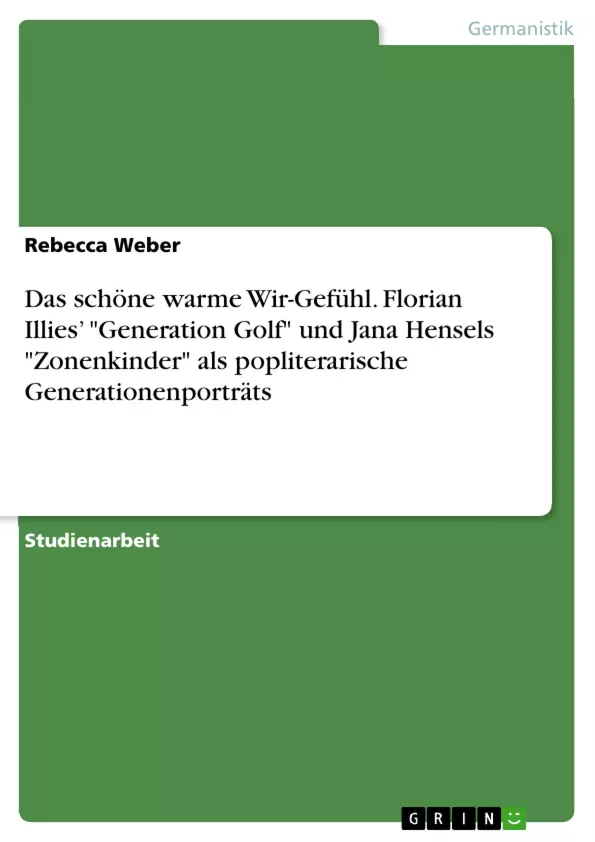Zunächst scheinen Welten zu liegen zwischen einer Kindheit in der DDR, wie sie Jana Hensel in „Zonenkinder“ beschreibt mit exotisch anmutenden Bezeichnungen und Bräuchen, die den westdeutschen Leser irritieren oder auch der Belustigung dienen, und der westdeutschen Kindheitswelt, wie sie Florian Illies in „Generation Golf“ darstellt. Einer Generation von „Zonenkindern“, die in ihrem verhältnismäßig kurzen Leben gleich drei Stationen durchlaufen haben - DDR-Kindheit, Wende-Jugend und als junge Erwachsene den endgültigen Schritt in den Westen - steht eine westdeutsche Generation gegenüber, die Playmobil als die prägendste Lebenserfahrung ihrer Kindheit und Jugend bezeichnet und den Wechsel von Raider zu Twix als eine der wenigen harmlosen Veränderungen erinnert (G.19).
Kontinuität und Bruch als die beiden entgegengesetzten Pole, auf die Hensels und Illies’ Werke bezogen bleiben, bestimmen die literarischen Techniken und die Zugriffsmöglichkeiten, die die Autoren zur Porträtierung ihrer Generationen nutzen. Wenn die vertraute Alltagswelt, die Welt der Kindheit zusammen mit dem System DDR auf einen Schlag verschwindet und jahrelange Versuche der Assimilation an den Westen den Blick auf die rekonstruierte „Heimat“ zunehmend verklären, hat dies Einfluss auf die Mechanismen beim schreibenden Erinnern.
Kann man angesichts dieser so völlig unterschiedlichen Ausgangssituationen überhaupt Vergleichsmomente zwischen beiden Werken finden? Oder ist Zonenkinder sogar das „ostdeutsche Pendant“ zu Generation Golf, wie einige Rezensionen behaupten? Beide Werke sind in nahezu allen bedeutenden Feuilletons kontrovers diskutiert worden und haben eine breite Leserschaft erreicht. Zahlreiche Leserbriefe und nicht zuletzt eine intensive Onlineleserdiskussion beim Internetbuchhändler Amazon zeugen davon, dass sich Zonenkinder zu einem Phänomen entwickelt hat, dessen Rezeption und öffentliche Diskussion bereits in einem eigens erstellten Dokumentationsband vorliegen. Den hohen Auflagezahlen nach – „Generation Golf“ wurde mehr als eine halbe Million Mal verkauft, „Zonenkinder“ bereits im ersten Jahr nach dem Erscheinen 160.000 Mal - muss es also eine gesellschaftliche Gruppe geben, die sich mit den Werten und Lebenseinstellungen der dargestellten Generationen identifizieren kann und sich als Teil des „Wir“ sieht, das Hensel und Illies konstruieren.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Der Begriff,,Generation“
- Etikett und Stilisierung - der Begriff,,Generation“ im Trend
- Der Generationenbegriff nach Karl Mannheim
- Eckdaten der porträtierten Generationen
- Beobachtungen zum Aufbau beider Werke
- Die Zonenkinder im Spiegel der Generation Golf und umgekehrt
- Zwischen Fiktion und Faktizität
- Erzählerische Verfahren
- Kontinuität und Bruch als Ausgangssituationen
- Die Zonenkinder im Spannungsfeld von Erinnern und Vergessen
- Verklärung und (N)ostalgie - Erinnerungen an ein Märchenland
- Ausschluss und Integration
- Das verbindende,,Wir“
- Katalogisieren und Archivieren als Gestaltungsmittel
- Elemente der Pop-Literatur in Generation Golf und Zonenkinder
- Vorbemerkungen zum Begriff der „Pop-Literatur“
- Verwischung der Grenzen zwischen Literatur und Journalismus
- Eine,,Literatur der zweiten Worte“
- Popkulturelle Lebenswelten und Stilabgrenzung
- Indifferenz und Affirmation
- Ausblick: Hat der popkulturelle Generationenbegriff eine Zukunft?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit untersucht die beiden Werke „Generation Golf“ von Florian Illies und „Zonenkinder“ von Jana Hensel, um die literarischen Verfahren und die charakteristischen Merkmale der Generationen zu analysieren, die in beiden Werken porträtiert werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie der popkulturelle Generationenbegriff in beiden Texten konstruiert wird und welche Bedeutung er für die Interpretation der Texte hat. Die Arbeit analysiert sowohl die formale Gestaltung der Texte als auch die Inhalte, die in Bezug auf die Generationen, die Lebenswelten und die historischen Ereignisse der jeweiligen Zeit untersucht werden.
- Der Begriff „Generation“ als literarisches Konstrukt
- Die Bedeutung der Pop-Kultur für die Gestaltung und Interpretation der Texte
- Das Spannungsverhältnis zwischen Erinnerung und Vergessen
- Die Konstruktion von Identität in der postmodernen Gesellschaft
- Die Rolle der literarischen Verfahren und Erzähltechniken
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die beiden Werke „Generation Golf“ von Florian Illies und „Zonenkinder“ von Jana Hensel vor und skizziert das Spannungsfeld, in dem sich beide Werke bewegen: Die unterschiedlichen Lebenswelten der West- und Ostdeutschen nach dem Mauerfall. Die Einleitung diskutiert auch die Schwierigkeiten, die sich bei der Vergleichbarkeit der beiden Werke ergeben, da die Erzählperspektiven und die historischen Hintergründe stark variieren. Anschließend wird der Generationenbegriff in seiner historischen und soziologischen Entwicklung beleuchtet, wobei der Fokus auf den soziologischen Generationenbegriff nach Karl Mannheim und dessen Bedeutung für die heutige Gesellschaft liegt. Der Fokus liegt dabei auf dem Generationenbegriff als Konstrukt, das die soziale Wirklichkeit nicht einfach spiegelt, sondern aktiv gestaltet und interpretiert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Pop-Literatur, dem Generationenbegriff, der Konstruktion von Identität und der Rolle der Erinnerung in der postmodernen Gesellschaft. Die Analyse der beiden Werke „Generation Golf“ von Florian Illies und „Zonenkinder“ von Jana Hensel zeigt, wie der popkulturelle Generationenbegriff verwendet wird, um Lebenswelten und Erfahrungen zu beschreiben und zu interpretieren. Zentrale Begriffe der Arbeit sind: Generationenbegriff, Pop-Literatur, Erinnerungskultur, Identitätskonstruktion, Ost-West-Verhältnis, Literatur und Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was charakterisiert die "Generation Golf" nach Florian Illies?
Die "Generation Golf" beschreibt die westdeutsche Jugend der 80er Jahre, deren Identität stark durch Markenprodukte wie Playmobil, Commodore 64 und den VW Golf sowie eine weitgehende politische Indifferenz geprägt war.
Wer sind die "Zonenkinder" in Jana Hensels Werk?
"Zonenkinder" sind junge Ostdeutsche, die ihre Kindheit in der DDR erlebten und nach der Wende einen radikalen Bruch ihrer Alltagswelt sowie eine schnelle Assimilation an den Westen erfuhren.
Was sind Gemeinsamkeiten zwischen "Generation Golf" und "Zonenkinder"?
Beide Werke nutzen popliterarische Techniken wie das Katalogisieren von Alltagsgegenständen, um ein kollektives „Wir-Gefühl“ zu erzeugen und eine spezifische Generationenidentität zu konstruieren.
Welche Rolle spielt die Erinnerung in diesen Büchern?
Während Illies eher nostalgisch-ironisch auf eine stabile Kindheit blickt, thematisiert Hensel den schmerzhaften Verlust der vertrauten Umgebung und das Spannungsfeld zwischen Erinnern und Vergessen.
Warum werden diese Werke der Pop-Literatur zugeordnet?
Wegen der engen Verknüpfung von Literatur und Journalismus, der Fokussierung auf popkulturelle Lebenswelten und der Verwendung von Markennamen als Identitätsstifter.
- Quote paper
- Rebecca Weber (Author), 2008, Das schöne warme Wir-Gefühl. Florian Illies’ "Generation Golf" und Jana Hensels "Zonenkinder" als popliterarische Generationenporträts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315602