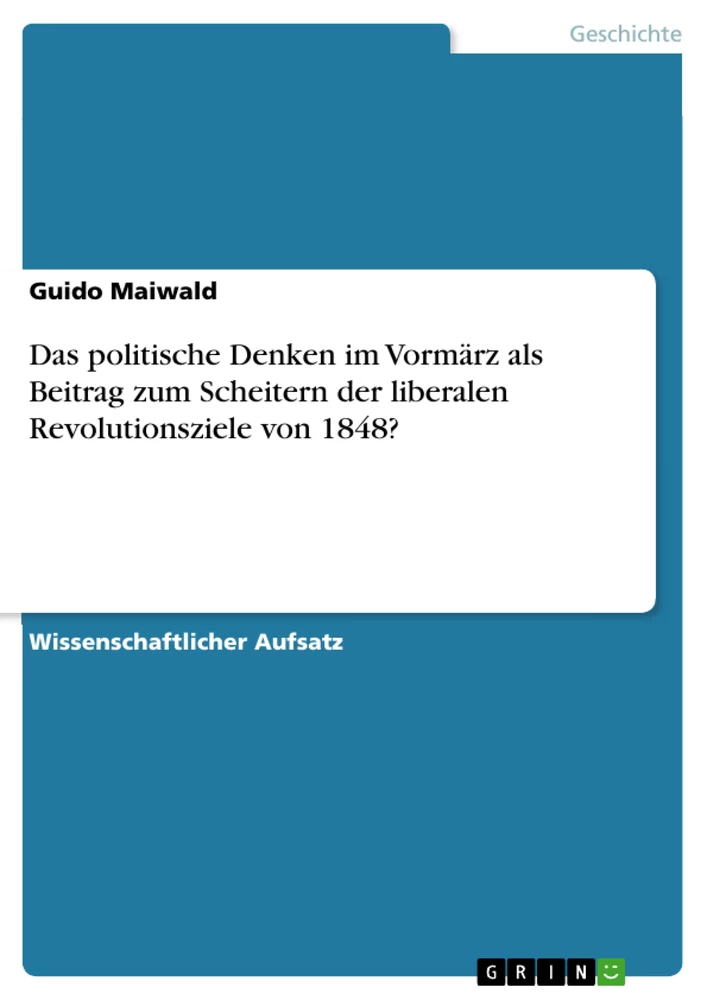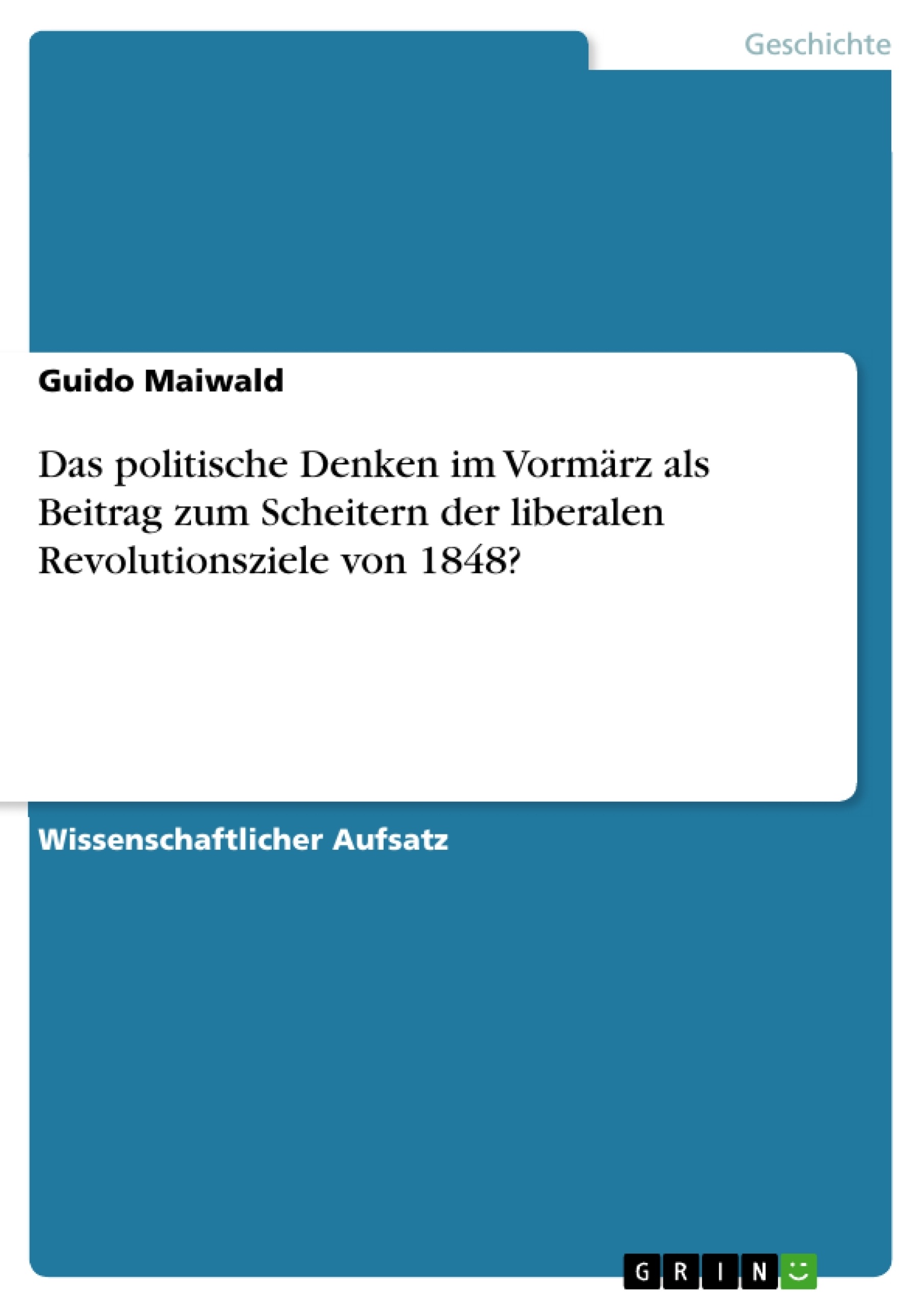Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Scheitern des Liberalismus und der demokratischen Verfassung nach der deutschen Revolution von 1848. Dabei sollen insbesondere die geistigen Strömungen der Zeit zwischen dem Wiener Kongress (1914) und der Revolution vom 1848 untersucht werden. Inwieweit zeigten schon die Ereignisse und Ergebnisse des Vormärz, dass die Zeit für eine demokratische Gesellschaftsordnung lange nicht gekommen war? Das erste Kapitel fokussiert die politische Ausgangssituation in Europa nach der Absetzung Napoleons im Jahre 1814. Dabei werden insbesondere die Schaffung des Deutschen Bundes und die liberalen Zugeständnisse der landständischen Verfassungen thematisiert. Im Unterkapitel des ersten Kapitels werden die Verfechter des Liberalismus vorgestellt. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Zeit des Vormärz. Hier werden sowohl die Aktivitäten der liberalen Bewegung und deren wichtigste Vertreter vorgestellt, wie auch die Versuche des Staates und der Länder die Verbreitung der neuen Ideen zu verhindern. Das Unterkapitel des zweiten Kapitels schildert die wirtschaftliche und politische Situation in Deutschland kurz vor dem Ausbruch der Revolution. An dieser Stelle werden auch die unterschiedlichen Forderungen von Demokraten und Liberalen sowie die Veränderungen im politischen Denken dargestellt. Im dritten Kapitel werden die Ereignisse der Märzrevolution von 1848 dargestellt, insbesondere ihre Zerschlagung und die Wiederherstellung der alten Verhältnisse.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- 1. Politische Ausgangssituation
- 1.1 Verfechter des Liberalismus
- 2. Der,,Vormärz“
- 2.1 Im Vorfeld der Revolution
- 3. Die Märzrevolution 1848
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit analysiert das Scheitern des Liberalismus und der demokratischen Verfassung nach der deutschen Revolution von 1848. Insbesondere werden die geistigen Strömungen der Zeit zwischen dem Wiener Kongress (1814) und der Revolution von 1848 untersucht. Ziel ist es, die Frage zu beleuchten, inwieweit die Ereignisse und Ergebnisse des Vormärz bereits deutlich machten, dass eine demokratische Gesellschaftsordnung zu diesem Zeitpunkt noch nicht realistisch war.
- Die politische Ausgangssituation in Europa nach der Absetzung Napoleons im Jahre 1814, einschließlich der Schaffung des Deutschen Bundes und der liberalen Zugeständnisse in den landständischen Verfassungen.
- Die Aktivitäten der liberalen Bewegung und ihre Vertreter im Vormärz sowie die Versuche des Staates, die Verbreitung neuer Ideen zu verhindern.
- Die wirtschaftliche und politische Situation in Deutschland kurz vor der Revolution, einschließlich der unterschiedlichen Forderungen von Demokraten und Liberalen sowie der Veränderungen im politischen Denken.
- Die Ereignisse der Märzrevolution von 1848, insbesondere ihre Zerschlagung und die Wiederherstellung der alten Verhältnisse.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 1: Politische Ausgangssituation
Das erste Kapitel beleuchtet die politische Situation in Europa nach der Absetzung Napoleons. Es beschreibt die territoriale Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress, wobei Preußen die Rheinprovinz und Westfalen erlangte, während Sachsen geteilt wurde. Die europäischen Fürsten strebten in erster Linie ein internationales Gleichgewicht an, um die Hegemonie eines einzelnen Staates zu verhindern und den Frieden zu sichern. Die konstitutionelle Monarchie hatte sich als zukunftsweisende Staatsform etabliert. Der im Jahr 1815 gegründete Deutsche Bund vereinte 35 deutsche Fürsten, darunter auch Mitglieder europäischer Herrscherhäuser. Viele Landtage waren aufgrund immenser Staatsschulden gezwungen, Teile der Bevölkerung an der Macht zu beteiligen, um diese zur Übernahme von Schuldenlasten zu bewegen. Liberale Zugeständnisse waren daher in dieser politischen Konstellation unausweichlich. Die Bundesakte versprach die Einführung von landständischen Verfassungen, die Verbesserung der Rechtsstellung der Juden und die Pressefreiheit. Bereits vor der Bundesakte begannen die Einzelstaaten, sich neue Verfassungen zu geben. Die Verfassungen der süddeutschen Staaten Bayern, Baden und Württemberg verkörperten den Typus der frühkonstitutionellen deutschen Monarchie. Andere Staaten wie Hannover und Braunschweig erhielten Verfassungen mit altständischen Elementen. Die „landständischen“ Verfassungen führten zu Konflikten zwischen den altständischen Fraktionen des Adels und städtischen Patriziats und der neuständischen Elite des Besitz- und Bildungsbürgertums. Die Karlsbader Konferenzen von 1919 zeigten die unterschiedlichen Interpretationen des Begriffs der „landständischen Verfassung“. Botzenhart argumentiert, dass die Verfassungen nicht auf Forderungen der Bevölkerung zurückzuführen waren, sondern das Werk einer modernisierungswilligen Beamtenschaft. Im Jahr 1819/20 wurden innere Reformen ausgesetzt, die ländliche Selbstverwaltung nicht verwirklicht und die Befreiung der Bauern gehemmt. Ab 1822 wurden Provinzialstände eingerichtet, die von Offizieren, Beamten und Grundadel dominiert wurden. Ab 1823 wurden „neuständische Verfassungen“ eingeführt, die separate Interessenvertretungen von Adel, Städten und Landgemeinden einführten und die Wählbarkeit an Grundbesitz banden. Die Gewählten hatten jedoch meist nur beratende Funktion. Botzenhart argumentiert, dass die Voraussetzungen für das Funktionieren oder Weiterentwickeln dieser Verfassungen noch nicht gegeben waren. Es fehlte an einer politisch interessierten Öffentlichkeit und einem politisch selbstbewussten Großbürgertum. Bürgerliche Mitbestimmung war noch kaum präsent, und der Monarch hatte die Macht, den Landtag aufzulösen, wenn er seinen Forderungen widersprach.
Kapitel 1.1: Verfechter des Liberalismus
Im Jahr 1815 entstand die „Deutsche Burschenschaft“. 1817 trafen sich Studenten und Nicht-Studenten beim Wartburgfest, verbrannten die Bundesakte und reaktionäre Schriften. Am Jahrestag des Festes schlossen sich 14 Burschenschaften zur „allgemeinen Deutschen Burschenschaft“ zusammen. Im März 1819 ermordete ein Theologiestudent aus dem Umfeld der Burschenschaften den reaktionären August von Kotzebue. Ein ähnlicher politischer Anschlag nur kurze Zeit später misslang. Der Staat reagierte mit den Karlsbader Beschlüssen im Jahre 1919 und verbot die Burschenschaften. Das Universitätsgesetz verfügte die politische Überwachung von Studenten und Dozenten, das Pressgesetz die bundesweite Vorzensur von Zeitschriften und Drucksachen und das Untersuchungsgesetz die Einrichtung einer Bundesbehörde zur Verfolgung politischer „Demagogen“. Insbesondere Friedrich Wilhelm III von Preußen verfolgte Liberale wie Stein, Gneisenau und Schleiermacher mit allen Mitteln des Obrigkeitsstaates. Die liberale Opposition, mehrheitlich organisiert von Studenten, konnte im Gegensatz zum liberalen Besitz- und Bildungsbürgertum finanziell wenig dem Staat entgegensetzen. Erst im Juli 1830 konnte sie wieder auf Reformen hoffen.
Kapitel 2: Der,,Vormärz“
Nachdem der reaktionäre französische Monarch Karl X 1830 nach gewalttätigen Bürgerprotesten abdankte, wurde Louis Philippe von Orleans zum neuen Herrscher ernannt und eine parlamentarische Monarchie etabliert. Im September 1830 griffen in Sachsen Handwerksgesellen die Obrigkeit und das Besitzbürgertum an. Der Aufstand des „Proletariats“ wurde niedergeknüppelt, nachdem die Bewaffnung von „Bürgerwehren“ vom Landtag erfüllt worden war. In Kurhessen stürmte die Landbevölkerung Schlösser und misshandelte Juden und Staatsbeamte. Feuilletonisten wie Heine verbreiteten liberale Ideen, die von der Bewegung „Junges Deutschland“ begeistert aufgenommen wurden. In der zweiten bayerischen Kammer wurde Innenminister Schenk zum Rücktritt aufgefordert, da ihm eine Verfassungsverletzung aufgrund von restriktiven Pressegesetzen drohte. In Baden gelang es der zweiten Kammer, ein liberales Pressegesetz zu erzwingen, das jedoch aufgrund der Bundesgesetze bald wieder zurückgezogen wurde. 1831 folgten diverse Verfassungsinitiativen in Ländern des Bundes, die nur wenige liberale Forderungen erfüllten. Berding und Ullmann argumentieren, dass die bürgerlichen Schichten, die demokratische Veränderungen forderten, noch zu schwach waren, während die alten Eliten ihre Macht bewahrten. Der „bürokratische Absolutismus“ der Rheinbundzeit erließ Reformen lediglich, um „die feudale Ordnung in eine bürgerliche Eigentümergesellschaft zu überführen“. Der Staat wollte durch eine „Revolution von oben“ die Gesellschaft umgestalten. Trotz des Verbots von Parteien durch die Gesetzgebung des Bundes bildeten sich in den Landtagen oppositionelle Koalitionen, die gemeinsam um Stimmen warben. Die Opposition verlagerte ihre Arbeit nach außen, gründete Vereine und organisierte politische Feste und Kundgebungen. Nach der Julirevolution entstand der „Deutsche Preß- und Vaterlandsverein“, der mehrheitlich aus bürgerlichen Honoratioren bestand, aber großen Zuspruch bei Handwerkern, Winzern und Bauern fand. Auf dem Hambacher Fest am 27. Mai 1832 forderten 20.000 Menschen nationale Einheit, Pressefreiheit und Zugang zur Demokratie für größere Teile der Bevölkerung. Die Ansichten über den Weg des politischen Wandels gingen jedoch deutlich auseinander, „sie reichten von konstitutionellen Reformen bis zum bewaffneten Aufstand“. Der Staat reagierte sofort: Das erste Bundesgesetz schränkte die Petitions-, Budget- und Gesetzgebungsrechte sowie die Rede- und Berichtsfreiheit der Landtage ein.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit fokussiert auf die Zeit des Vormärz und die deutsche Revolution von 1848. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Liberalismus, Demokratie, Verfassung, Deutscher Bund, landständische Verfassungen, Vormärz, Märzrevolution, Burschenschaft, politische Strömungen, gesellschaftliche Veränderungen, wirtschaftliche Lage, Pressefreiheit, politische Opposition, bürgerliche Mitbestimmung, nationale Einheit.
- Quote paper
- MA Guido Maiwald (Author), 2008, Das politische Denken im Vormärz als Beitrag zum Scheitern der liberalen Revolutionsziele von 1848?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315476