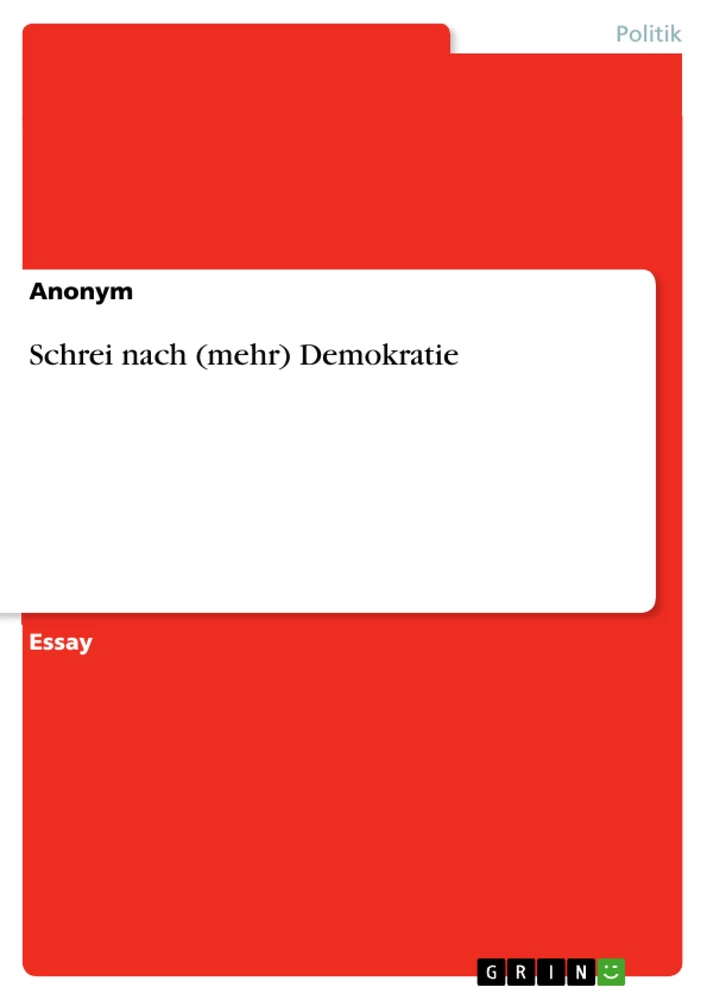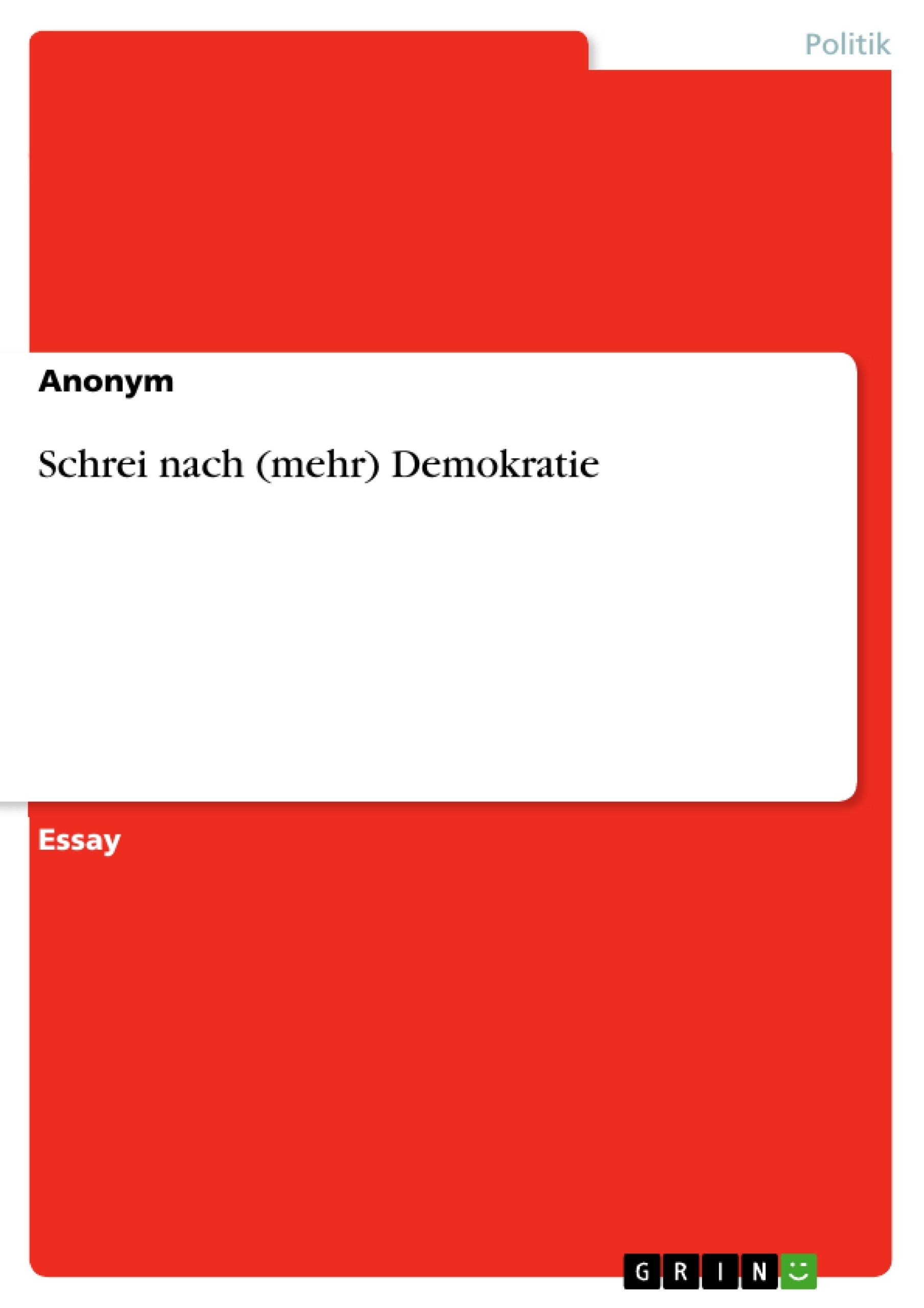Seit den Protesten gegen Stuttgart 21 geht ein Gespenst in Deutschland um. Die politisch Mächtigen der Republik haben sich gegen dieses Gespenst verschworen. Zweierlei
geht daraus hervor. Der Volksentscheid wird von der Politik bereits als mächtiges Instrument anerkannt. Es ist hohe Zeit, dass die Befürworter ihre Anschauungsweise und ihre Argumente darlegen und dem Gespenst eine Erklärung entgegenstellen.
Die Debatte um eine größere Bürgerteilung wird aufgrund der Demonstrationen gegen Stuttgart 21 und die Castor-Transporte wieder rege geführt. Ergebnis ist die Forderung von über 75 Prozent der Bevölkerung nach mehr Volksentscheiden (Infratest dimap) und die Ablehnung durch die Politik. Das Essays möchte zuerst aufzuzeigen, in welche Widersprüche sich die Politik durch eine Ablehnung verwickelt und anschließend erläutern weshalb nicht ein Mehr an Demokratie, sondern Demokratie an sich die eigentliche Forderung ist.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Schrei nach (mehr) Demokratie
- Die Paradoxe Situation
- Die Schweiz als Negativbeispiel?
- Irrationale Ängste?
- Der Volkswille an der Finanzstärke der Siegerseite gescheitert?
- Die "Dagegen-Republik"
- Entfremdung zwischen Bürger und Politik?
- Kritik der Demokratie?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Der Essay befasst sich mit der Forderung nach mehr Volksentscheiden und setzt sich kritisch mit den Argumenten der Politik gegen diese auseinander. Die Zielsetzung des Autors ist es, aufzuzeigen, dass die Ablehnung von Volksentscheiden eine Ablehnung der Demokratie an sich ist, da sie auf einem falschen Menschenbild beruht, das den Bürger als unfähig zur politischen Teilhabe darstellt.
- Kritik der Ablehnung von Volksentscheiden
- Das Menschenbild der politischen Elite
- Die Rolle der Medien und Politik in der Meinungsbildung
- Die Bedeutung der direkten Demokratie
- Die Scheindemokratie in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Der Essay beginnt mit einer Schilderung der aktuellen Debatte um Volksentscheide, die durch die Proteste gegen Stuttgart 21 und Castor-Transporte ausgelöst wurde. Der Autor stellt die Forderung nach mehr Volksentscheiden in den Kontext der politischen Machtverhältnisse und zeigt auf, wie die Politik die Forderung nach mehr direkter Demokratie ablehnt.
- Im zweiten Kapitel wird die paradoxe Situation analysiert, die entsteht, wenn der Bürger in der Lage ist, bei Wahlen seine Stimme abzugeben, aber nicht in der Lage ist, über einzelne Sachfragen zu entscheiden. Der Autor argumentiert, dass diese Situation entweder bedeutet, dass der Bürger nicht in der Lage ist, fundierte Entscheidungen zu treffen, oder dass die Demokratie an sich unnötig wäre. Er stellt die Frage, warum das eine Extrem (Volksentscheide) nicht praktiziert wird, während das andere (keine Demokratie) ebenfalls abgelehnt wird.
- Das dritte Kapitel beleuchtet die Kritik an Volksentscheiden, die häufig auf das Beispiel der Schweiz verwiesen wird. Der Autor argumentiert, dass diese Kritik nicht haltbar ist, da die Schweiz ein anderes politisches System hat und die Forderung nach mehr direkter Demokratie nicht das Grundgesetz umgehen soll.
- Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Gefahr der irrationalen Ängste, die durch Volksentscheide geschürt werden könnten. Der Autor stellt fest, dass diese Gefahr auch in anderen politischen Bereichen existiert und argumentiert, dass der Bürger in der Lage ist, Manipulationsversuchen zu widerstehen.
- Im fünften Kapitel wird das Beispiel Hamburgs betrachtet, wo der Volkswille an der Finanzstärke der Siegerseite gescheitert sein soll. Der Autor kritisiert dieses Argument, da es die politische Grundordnung in Frage stellt und stattdessen fordert, dass die grundgesetzwidrigen Umstände beseitigt werden sollen.
- Das sechste Kapitel behandelt die Angst vor einer "Dagegen-Republik", in der Volksentscheide destruktiv genutzt werden könnten. Der Autor widerlegt dieses Argument, indem er die Menschenbild der Politik kritisiert, das den Bürger als unfähig zur langfristigen Entscheidungsfindung darstellt.
- Das siebte Kapitel thematisiert die Sorge um eine Entfremdung zwischen Bürger und Politik. Der Autor räumt ein, dass das Parlament an Bedeutung verlieren könnte, betont aber, dass nicht über jedes Gesetz ein Volksentscheid stattfinden würde.
Schlüsselwörter (Keywords)
Volksentscheid, direkte Demokratie, politische Partizipation, Bürgerbeteiligung, Menschenbild, Demokratiekritik, Scheindemokratie, politische Elite, politische Machtverhältnisse.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2010, Schrei nach (mehr) Demokratie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315178