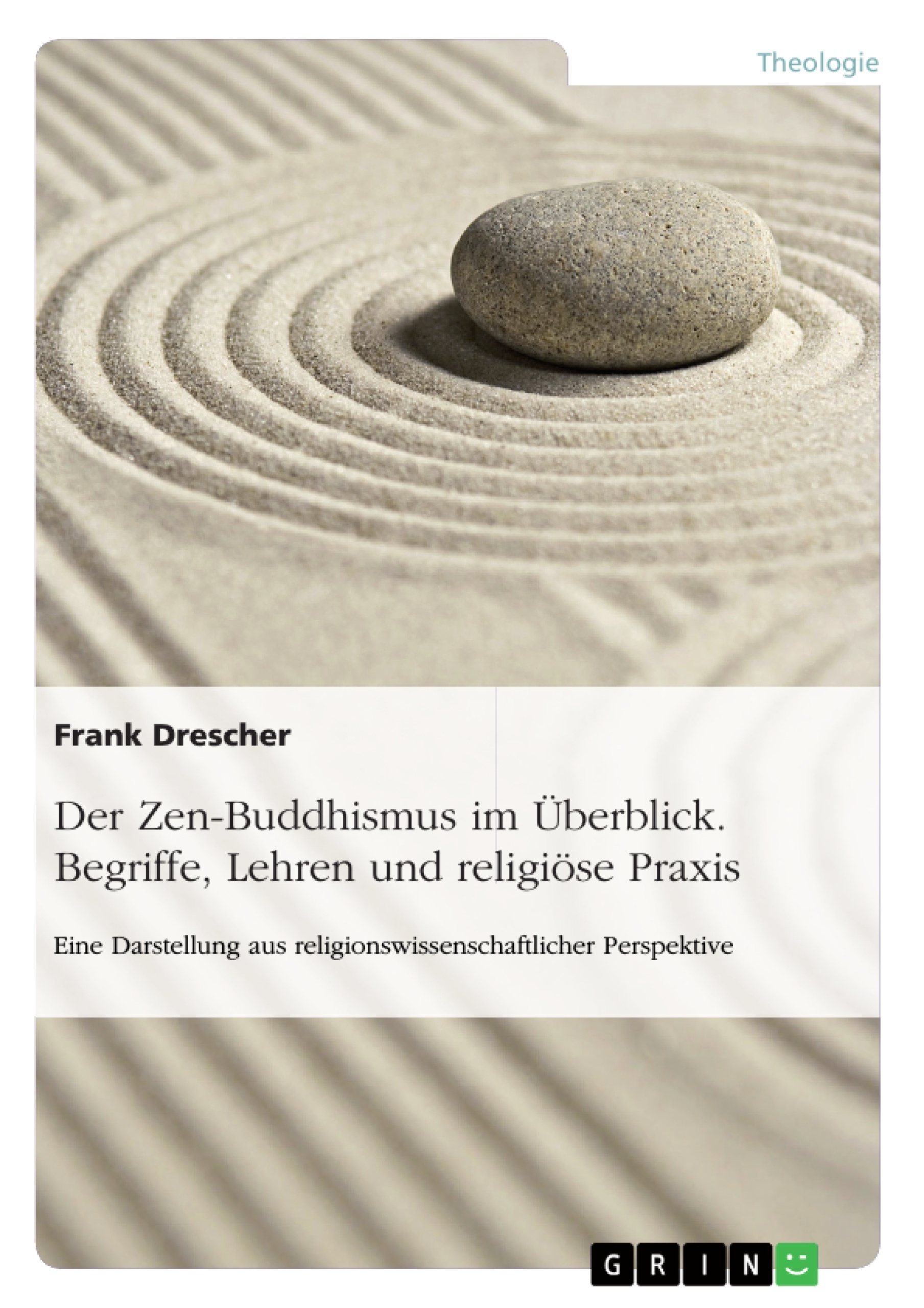Der japanische Begriff „Zen“ lässt sich sinngemäß mit „Praxis der meditativen Versenkung“ übersetzen. Diese Eigenbezeichnung ist Anspruch und Programm zugleich, nämlich vor allem ein „Meditationsbuddhismus“ zu sein, der wie keine andere buddhistische Strömung nach der persönlichen Erleuchtung seiner Anhänger strebt. Aus diesem Selbstverständnis heraus gibt er der religiösen Praxis einen unbedingten Vorrang gegenüber jeder Form weltanschaulicher Spekulation.
Trotz gewisser antiintellektualistischer Tendenzen baut er dennoch auf einem komplexen philosophischen System auf, welches im Laufe seiner Entstehung und Entwicklung seine eigenen Begriffe, Lehren und Methoden hervorgebracht hat. Diese in Form einer Kurzeinführung darzustellen und zu erläutern, ist Gegenstand dieses Beitrages.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Begriffsgeschichte: „Dhyāna“ – „Chán“ – „Zen“.
- Stiftungsmythen des Meditationsbuddhismus: Die Blumenpredigt Buddhas, und Warum Bodhidharma aus dem Westen kam
- Mahāyānistisch-philosophische Grundlagen des Chán bzw. Zen
- Das Bodhisattva-Ideal...
- Der Ineinsfall von Samsāra und Nirvāna im chinesischen Mahāyāna.….......
- Praktische Elemente des Meditationsbuddhismus...
- Die Sitzmeditation.
- Achtsames Tätigsein: Samu und die Zen-Künste.
- „Der Klang der einen klatschenden Hand“ - Die Kōan-Praxis..
- Die zwei Hauptschulen des Chán- bzw. Zen-Buddhismus
- Rinzai-Zen
- Sōtō-Zen........
- Prägende Einflüsse aus der Mādhyamaka-Lehre, dem Taoismus und dem Konfuzianismus auf den Meditationsbuddhismus
- Madhyamaka-philosophische Elemente des Chán-Buddhismus
- Taoistische Elemente im Chán bzw. Zen
- Konfuzianisierung des Chán-Buddhismus.
- Abschließende Bemerkungen..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit der Geschichte und den zentralen Inhalten des Meditationsbuddhismus, der in seinen verschiedenen Ausprägungen als Chán, Zen, Thiền und Seon bekannt ist. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Meditationsbuddhismus vom Ursprung im indischen Buddhismus bis zu seiner Etablierung in Ostasien. Dabei werden die zentralen Lehren und Praktiken dieser Tradition beleuchtet, einschließlich der Rolle von Bodhidharma, der Sitzmeditation und der Kōan-Praxis.
- Begriffsgeschichte und Entwicklung des Meditationsbuddhismus
- Stiftungsmythen und zentrale Figuren des Meditationsbuddhismus
- Mahāyāna-Philosophie und ihre Relevanz für den Chán-Buddhismus
- Praktische Elemente des Meditationsbuddhismus: Sitzmeditation, Achtsamkeit und Kōan-Praxis
- Einflüsse aus anderen Philosophien und Religionen auf den Meditationsbuddhismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Zur Begriffsgeschichte: „Dhyāna“ – „Chán“ – „Zen“. Dieses Kapitel beleuchtet die etymologische Entwicklung des Begriffs „Zen“ von seinen indischen Wurzeln („Dhyāna“) über die chinesische Ausprägung („Chán“) bis zu seiner Verbreitung in anderen ostasiatischen Ländern.
- Kapitel 2: Stiftungsmythen des Meditationsbuddhismus: Die Blumenpredigt Buddhas, und Warum Bodhidharma aus dem Westen kam. Dieses Kapitel analysiert die beiden zentralen Stiftungsmythen des Meditationsbuddhismus, die Blumenpredigt des Buddha und die Ankunft Bodhidharmas in China. Es werden die historischen Hintergründe dieser Mythen sowie ihre Bedeutung für die Entwicklung der Chán-Tradition erörtert.
- Kapitel 3: Mahāyānistisch-philosophische Grundlagen des Chán bzw. Zen. Dieses Kapitel befasst sich mit den philosophischen Grundlagen des Chán-Buddhismus, insbesondere mit dem Bodhisattva-Ideal und dem Konzept des Ineinsfalls von Samsāra und Nirvāna. Es werden die zentralen Konzepte des Mahāyāna-Buddhismus erläutert und ihre Relevanz für die Praxis des Chán-Buddhismus dargestellt.
- Kapitel 4: Praktische Elemente des Meditationsbuddhismus... Dieses Kapitel stellt die verschiedenen praktischen Elemente des Meditationsbuddhismus vor, darunter die Sitzmeditation, achtsames Tätigsein (Samu) und die Kōan-Praxis. Es werden die Techniken und Ziele dieser Praktiken erläutert und ihre Rolle im Rahmen der spirituellen Entwicklung hervorgehoben.
- Kapitel 5: Die zwei Hauptschulen des Chán- bzw. Zen-Buddhismus. Dieses Kapitel behandelt die beiden wichtigsten Schulen des Chán-Buddhismus, den Rinzai-Zen und den Sōtō-Zen. Es werden die Unterschiede in ihren Lehren, Praktiken und historischen Entwicklungen dargestellt.
- Kapitel 6: Prägende Einflüsse aus der Mādhyamaka-Lehre, dem Taoismus und dem Konfuzianismus auf den Meditationsbuddhismus. Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Einflüssen, die den Meditationsbuddhismus in seiner Entwicklung geprägt haben. Es werden die Verbindungen zwischen Chán-Buddhismus und anderen Philosophien und Religionen wie dem Madhyamaka-Buddhismus, dem Taoismus und dem Konfuzianismus untersucht.
Schlüsselwörter
Meditationsbuddhismus, Chán, Zen, Dhyāna, Bodhidharma, Sitzmeditation, Achtsamkeit, Kōan-Praxis, Mahāyāna, Samsāra, Nirvāna, Bodhisattva-Ideal, Rinzai-Zen, Sōtō-Zen, Madhyamaka-Lehre, Taoismus, Konfuzianismus, Ostasien, Geschichte, Philosophie, Praxis.
- Quote paper
- Frank Drescher (Author), 2009, Der Zen-Buddhismus im Überblick. Begriffe, Lehren und religiöse Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314865