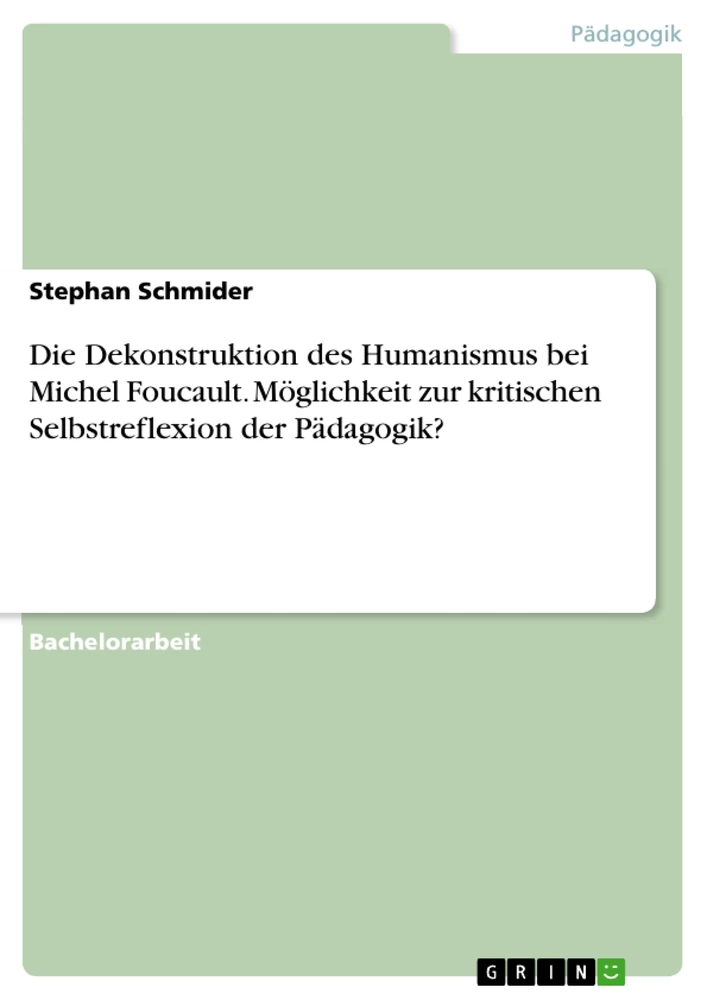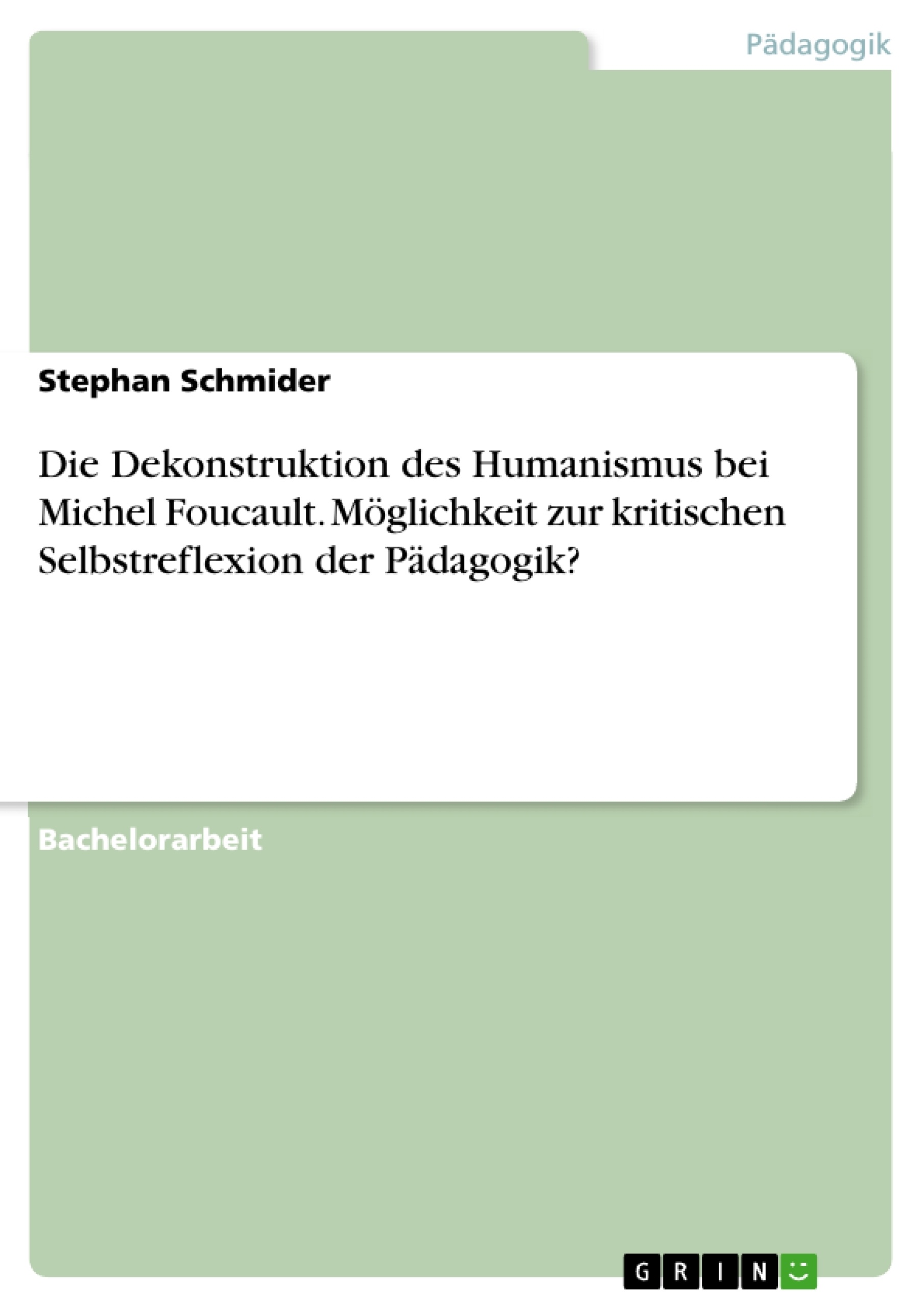Die vorliegenden Erörterungen sollen Foucaults Thesen in der „Ordnung der Dinge“ (Les mots et les choses) und „Überwachen und Strafen“(Surveiller et punir) genauer analysieren und die Frage beantworten, inwieweit Foucaults Dekonstruktion des Humanismus´ eine Möglichkeit zur kritischen Selbstreflexion der Pädagogik in Theorie und Praxis bietet. Ist es deshalb möglich oder sogar sinnvoll, Foucaults Thesen in einem Studiengang Erziehungswissenschaft zu thematisieren oder nimmt man damit späteren Pädagogen/innen die Hoffnung und ihren Idealismus für ihre Arbeit, den viele Pädagogen/innen mit ihrem Wissen um Erziehung verwirklichen wollen?
Im ersten Teil dieser Arbeit wird daher verstärkt auf Foucaults Thesen in „Die Ordnung der Dinge“ eingegangen. Zunächst soll gezeigt werden, welche Ziele Foucault mit seiner Arbeit verfolgte und welche Fragen er selbst beantworten wollte. Daraufhin werden die einzelnen Epochen (Renaissance, Klassik und Moderne) erläutert und ihr jeweiliger Wissenscode dargestellt, um somit die These vom Verschwinden des Menschen und die damit verbundene Dekonstruktion des Humanismus zu erklären. Welche Probleme sieht Foucault mit dem Aufkommen des „Menschen“ in der Moderne und welche Folgen hat dieser Humanismus für den Menschen?
Im zweiten Teil wird die Verbindung Macht und Wissen bei Foucault in den Blick genommen. Hierzu wird auf das Werk „Überwachen und Strafen“ eingegangen. Foucaults Sichtweise über das moderne Strafsystem wird erläutert und die erkenntnisleitende Frage welches Bild der Moderne Foucault hat und wie das Subjekt der Moderne konstituiert wird, soll beantwortet werden.
Im letzten Teil sollen die pädagogischen Probleme erläutert werden, die mit Foucaults Denkweise um den Menschen und um die Moderne entstehen. Gibt es einen Ausweg für Pädagogen/innen? Sind sie gezwungen, in einem pessimistischen Nihilismus zu verharren oder können Foucaults Thesen und Theorien zur kritischen Selbstreflexion der Pädagogik dienen? Was „lehrt“ somit Foucault der Pädagogik? Im letzten Kapitel wird deshalb ein Beispiel von Foucaults Rezeption in der praktischen Pädagogik dargestellt. Hierfür dient Angelika Magiros (2007) Forschungsarbeit über soziale Arbeit und Rassismus.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die Wörter, die Dinge und die Dezentrierung des Subjekts
- 1.1 Forschungsabsichten und Vorgehensweise Foucaults in „Die Ordnung der Dinge"
- 1.2 Das Zeitalter der Renaissance
- 1.3 Das Zeitalter der Klassik
- 1.4 Die Moderne oder die Moralisierung des Subjekts
- 2. Die Modernitätskritik
- 2.1 Der Betrug
- 2.2 Der Macht - Wissen Komplex und die Disziplinargesellschaft
- 3. Pädagogik und Modernitätskritik à la Foucault – (k)ein Einklang?
- 3.1 Pädagogische Probleme
- 3.2 Die kritische Selbstreflexion - eine Voraussetzung für Pädagogen/innen
- 3.3 Exkurs: Ziele der Erziehungswissenschaft für die zukünftigen Pädagogen/innen.
- 3.4. Foucaults Rezeption in der praktischen Pädagogik: „Foucaults Beitrag zur sozialen Arbeit gegen Rassismus“.
- Abschließende Bemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Michel Foucaults Thesen zur Dezentrierung des Subjekts und zur Kritik der Moderne, insbesondere im Kontext der Pädagogik. Ziel ist es, zu erforschen, inwieweit Foucaults Dekonstruktion des Humanismus eine Möglichkeit zur kritischen Selbstreflexion in der Pädagogik bietet.
- Foucaults Analyse des „Wissenscodes“ in verschiedenen Epochen (Renaissance, Klassik, Moderne)
- Die Verbindung von Macht und Wissen in der „Disziplinargesellschaft“
- Die Kritik an der „Moralisierung des Subjekts“ in der Moderne
- Die Herausforderungen und Chancen, die sich aus Foucaults Thesen für die pädagogische Praxis ergeben
- Die Rezeption Foucaults in der Erziehungswissenschaft und in der praktischen Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Michel Foucault als einen einflussreichen Denker des 20. Jahrhunderts vor, der neue Perspektiven auf Macht, Wissen und Sexualität eröffnete. Sie beleuchtet seine vielfältigen Einflüsse und die Kontroversen um seine Interpretation des Menschen.
Kapitel 1 fokussiert auf Foucaults Werk „Die Ordnung der Dinge“ und untersucht seine Forschungsabsichten und Vorgehensweise. Es analysiert die unterschiedlichen Epochen (Renaissance, Klassik, Moderne) und ihre jeweiligen Wissenscodes, um die These vom Verschwinden des Menschen und die damit verbundene Dekonstruktion des Humanismus zu verdeutlichen.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit Foucaults These vom „Macht-Wissen-Komplex“ und der „Disziplinargesellschaft“, die er in seinem Werk „Überwachen und Strafen“ entwickelt. Es analysiert seine Sichtweise auf das moderne Strafsystem und untersucht, wie das Subjekt in der Moderne konstituiert wird.
Kapitel 3 beleuchtet die pädagogischen Probleme, die sich aus Foucaults Thesen zum Menschen und zur Moderne ergeben. Es diskutiert die Frage, ob es einen Ausweg für Pädagogen/innen gibt und inwieweit Foucaults Thesen zur kritischen Selbstreflexion der Pädagogik dienen können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen aus Foucaults Werk wie „Ordnung der Dinge“, „Wissenscode“, „Disziplinargesellschaft“, „Macht-Wissen-Komplex“, „Dekonstruktion des Humanismus“, „kritische Selbstreflexion“ und „pädagogische Praxis“. Es werden außerdem die Themen „Modernitätskritik“, „Selbstbestimmung“ und „Emanzipation“ in Bezug auf Foucaults Thesen beleuchtet.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Stephan Schmider (Author), 2012, Die Dekonstruktion des Humanismus bei Michel Foucault. Möglichkeit zur kritischen Selbstreflexion der Pädagogik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314563