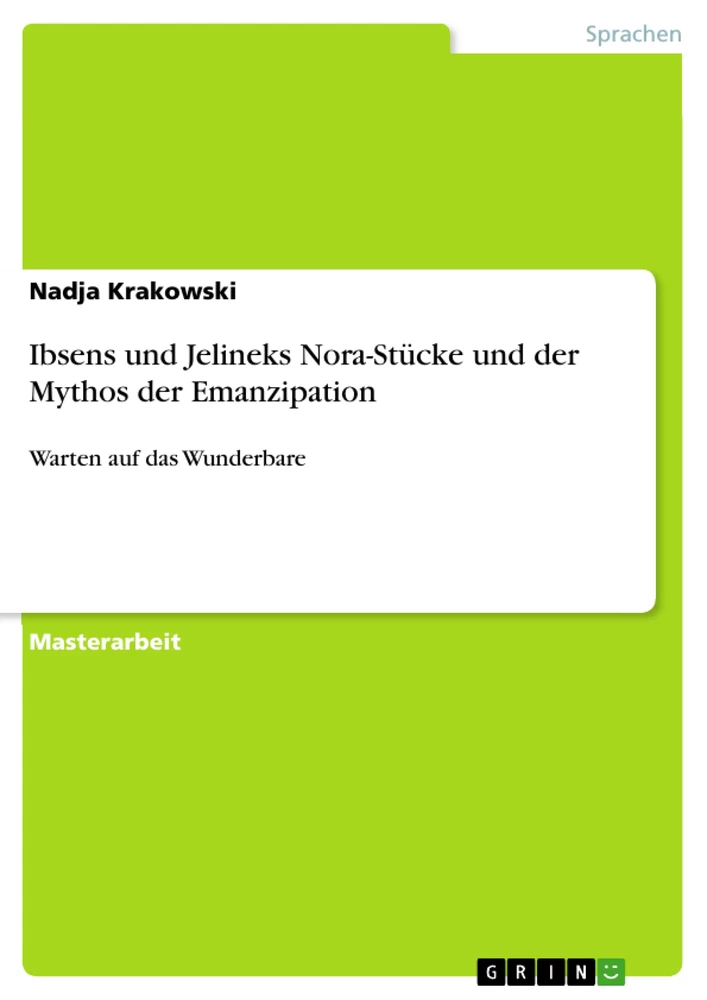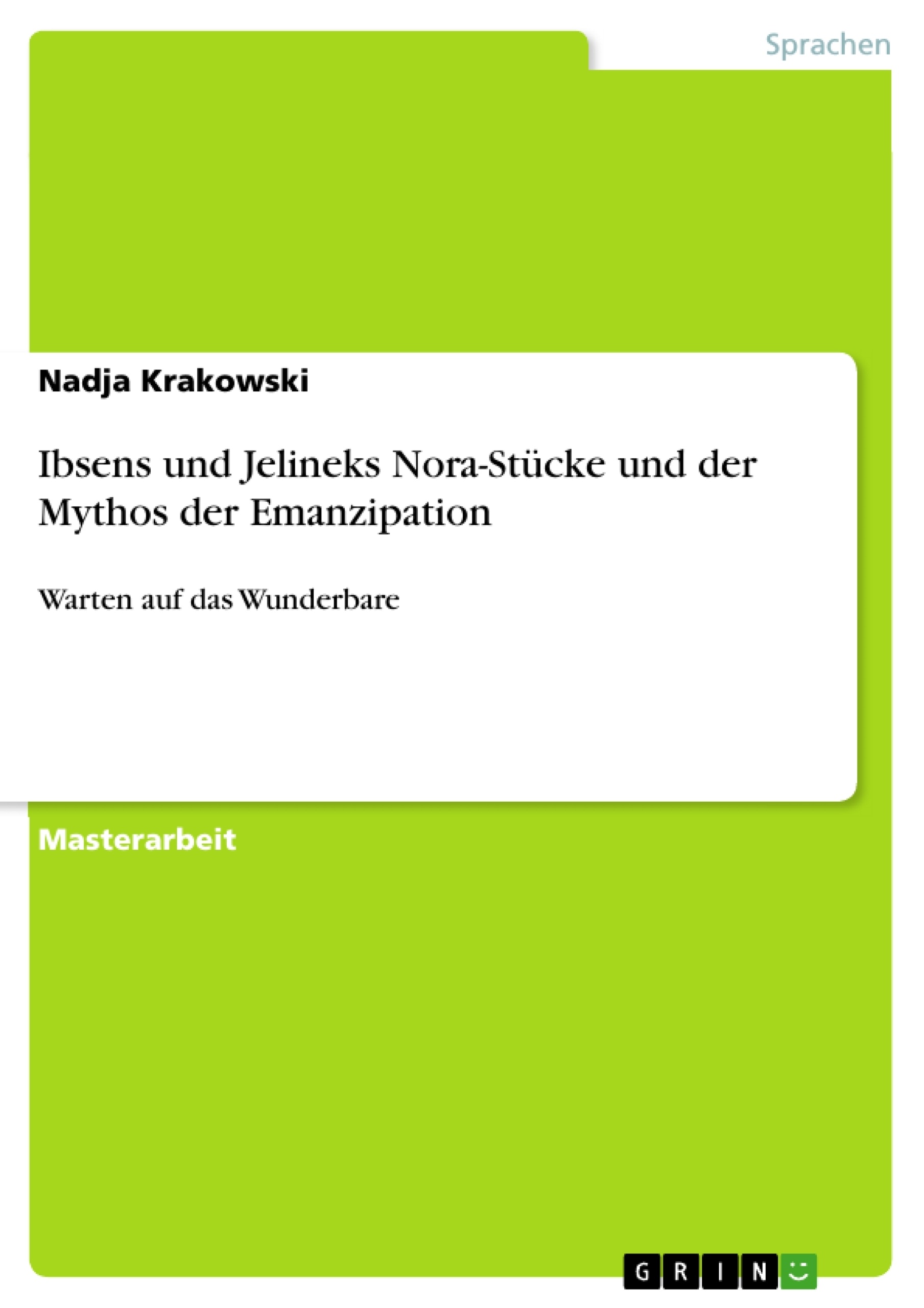Mit dem Theaterstück "Nora (Ein Puppenheim)" gelangte der bereits über 50jährige norwegische Autor Henrik Johan Ibsen im Jahr 1879 zu Weltruhm. Er verursachte mit seinem Schauspiel viel Aufruhr und Unmut und wurde doch kräftig gefeiert und vor allem für sein emanzipatorisches Engagement (auch wenn Ibsen dies stets leugnete) von der damaligen Frauenbewegung geschätzt. Ähnlich erging es knapp hundert Jahre später der österreichischen Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek mit ihrem Theaterdebut "Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften". Mit ihrer Fortsetzung von Ibsens Stück, welches direkt an dessen Ende anknüpft, gelang sie zwar auch zu hohem Ansehen, vermehrt von Frauen der dritten Welle der Frauenbewegung in den 70er Jahren, aber die Autorin machte sich mit ihrer Ästhetik und ihrer politischen Kernaussage nicht nur Freunde.
Ibsens Nora wartet auf das Wunderbare, sie wartet darauf, dass sich etwas in ihrem Leben zum Positiven ändert und schafft es zum Schluss, diese Veränderung aus eigener Kraft heraufzuführen, sich von ihren Fesseln in ihrem Puppenheim, der Männerherrschaft, zu befreien und in ein selbstbestimmtes Leben aufzubrechen. [...]
Zunächst muss dafür die Grundlage für Jelineks Stück, also Ibsens Nora (Ein Puppenheim) genauer betrachtet werden. Um herauszufinden, wieso das Schauspiel des Norwegers überhaupt als Emanzipationsstück berühmt geworden ist, bietet der historische Kontext, in dem Ibsen gestaltete, und die Rezeptionsgeschichte näheren Aufschluss. Danach soll sein ästhetisches Verfahren, also die Art und Weise der Schauspiel-Konzeption, unter dem Aspekt, ob hier auch ein Hinweis auf die Mythos Entstehung gegeben ist, genauer untersucht werden. Anschließend findet eine detailliertere Analyse des Inhalts statt. Den Schwerpunkt bildet dabei die Betrachtung der Figurenentwürfe, es soll gezeigt werden, wie die Männer- und die Frauenfiguren des Stückes, insbesondere Nora und Helmer, angelegt sind. Die sorgfältige Untersuchung des Stückes von Ibsen soll vor allem die Voraussetzung für ein profunderes Verständnis der Stoffumsetzung bei Elfriede Jelinek schaffen.
Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit Jelineks "Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften", welches zunächst unabhängig von Ibsens Original betrachtet werden soll. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Henrik Ibsen: Nora (Ein Puppenheim)
- 2.1. Ibsens Stück, der historische Kontext und die Rezeption
- 2.2. Ibsens ästhetisches Verfahren
- 2.3. Männlichkeit und Weiblichkeit bei Ibsen
- 2.3.1. Die Konstruktion von Geschlecht
- 2.3.2. Figurenkonzeption
- 3. Elfriede Jelinek: „Was geschah nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften“
- 3.1. Jelineks gesellschaftskritische Position
- 3.2. Jelineks ästhetisches Verfahren
- 3.2.1. Intertextualität und Struktur
- 3.2.2. Sprache und Körper
- 3.2.3. Die Dekonstruktion von Alltagsmythen
- 3.3. Männlichkeit und Weiblichkeit bei Jelinek
- 4. Warum Nora in ihr Puppenheim zurückkehren musste
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Dramen "Nora (Ein Puppenheim)" von Henrik Ibsen und "Was geschah nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften" von Elfriede Jelinek. Ziel ist es, die Darstellung von Weiblichkeit und Männlichkeit in beiden Stücken zu analysieren und den Kontrast zwischen Ibsens vermeintlich emanzipatorischer Botschaft und Jelineks pessimistischer Deutung des Themas zu beleuchten. Die Arbeit untersucht die historischen Kontexte, die ästhetischen Verfahren der Autorinnen und die Rezeption der Stücke.
- Darstellung von Weiblichkeit und Männlichkeit im späten 19. und späten 20. Jahrhundert
- Der Mythos der weiblichen Emanzipation und seine Dekonstruktion
- Vergleich der ästhetischen Verfahren von Ibsen und Jelinek
- Der Einfluss des historischen und gesellschaftlichen Kontextes auf die Dramen
- Die Rezeption der beiden Stücke und deren Bedeutung für die Frauenbewegung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt den Vergleich zwischen Ibsens "Nora" und Jelineks Fortsetzung des Stoffes in den Mittelpunkt. Sie hebt den Kontrast zwischen dem scheinbaren Optimismus Ibsens und dem Pessimismus Jelineks hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Henrik Ibsen: Nora (Ein Puppenheim): Dieses Kapitel widmet sich Ibsens "Nora". Es beleuchtet den historischen Kontext der Entstehung des Stücks und seine Rezeption, die stark von der damals aufkommenden Frauenbewegung beeinflusst war. Es analysiert Ibsens ästhetisches Verfahren und die Figurenkonzeption, insbesondere die Charaktere Nora und Helmer, um zu verstehen, warum das Stück als emanzipatorisch gilt. Die Analyse untersucht, ob Ibsens Darstellung der weiblichen Emanzipation eher verklärend oder realistisch ist, eine Frage, die in Kapitel 3 mit Jelineks Werk weiterverfolgt wird.
2.1. Ibsens Stück, der historische Kontext und die Rezeption: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die unmittelbare Rezeption von Ibsens "Nora" nach der Uraufführung. Es wird der immense Erfolg, aber auch die heftigen Kontroversen um das Stück hervorgehoben. Der Abschnitt betont die Bedeutung des historischen Kontextes – der frühen Frauenbewegung – für das Verständnis der Wirkung des Stücks und führt in die Handlung ein, die im Zentrum der weiteren Analyse steht: Noras geheimes Darlehen und die daraus resultierende Krise.
3. Elfriede Jelinek: „Was geschah nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften“: Dieses Kapitel analysiert Jelineks Werk als Fortsetzung von Ibsens "Nora". Es untersucht Jelineks gesellschaftskritische Position und ihre ästhetischen Verfahren, wie Intertextualität und die Dekonstruktion von Alltagsmythen. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit und darauf, wie Jelinek Ibsens hoffnungsvollen Ausgang in pessimistischen Pessimismus umkehrt. Jelineks Dekonstruktion des Emanzipationsmythos wird anhand von Textbeispielen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Nora, Henrik Ibsen, Elfriede Jelinek, Weiblichkeit, Männlichkeit, Emanzipation, Gesellschaft, Kapitalismus, Intertextualität, Dekonstruktion, historischer Kontext, Rezeption, Frauenbewegung.
Häufig gestellte Fragen zu: Ibsen und Jelinek - Eine vergleichende Analyse von "Nora" und "Was geschah nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert vergleichend Henrik Ibsens Drama "Nora (Ein Puppenheim)" und Elfriede Jelineks "Was geschah nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften". Der Fokus liegt auf der Darstellung von Weiblichkeit und Männlichkeit in beiden Stücken und dem Kontrast zwischen Ibsens scheinbar emanzipatorischer Botschaft und Jelineks pessimistischer Sichtweise.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die historischen Kontexte, die ästhetischen Verfahren der Autorinnen, die Rezeption der Stücke und den Einfluss des gesellschaftlichen Kontextes auf die Dramen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Darstellung von Weiblichkeit und Männlichkeit im späten 19. und späten 20. Jahrhundert gewidmet, sowie dem Mythos der weiblichen Emanzipation und seiner Dekonstruktion durch Jelinek.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zu Ibsens "Nora", einschließlich Analyse des historischen Kontextes, der Rezeption und Ibsens ästhetischem Verfahren. Ein separates Kapitel widmet sich Jelineks Werk, ihrer gesellschaftskritischen Position und ihrer ästhetischen Vorgehensweise. Ein weiteres Kapitel befasst sich mit der Frage nach Noras Rückkehr und die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die unterschiedlichen Darstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit in beiden Dramen zu analysieren und den Kontrast zwischen Ibsens vermeintlich emanzipatorischer Botschaft und Jelineks pessimistischer Deutung zu beleuchten. Es wird untersucht, inwieweit die historischen und gesellschaftlichen Kontexte die Dramen beeinflusst haben und welche Bedeutung die Rezeption der Stücke für die Frauenbewegung hatte.
Wie werden Ibsen und Jelinek verglichen?
Der Vergleich konzentriert sich auf die Darstellung von Weiblichkeit und Männlichkeit, die ästhetischen Verfahren der beiden Autorinnen (z.B. Intertextualität bei Jelinek) und die unterschiedlichen Interpretationen des Themas Emanzipation. Die Arbeit untersucht, wie Jelinek Ibsens Werk aufgreift und dessen hoffnungsvollen Ausgang in einen pessimistischen Kontext stellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nora, Henrik Ibsen, Elfriede Jelinek, Weiblichkeit, Männlichkeit, Emanzipation, Gesellschaft, Kapitalismus, Intertextualität, Dekonstruktion, historischer Kontext, Rezeption, Frauenbewegung.
Welche Aspekte von Ibsens "Nora" werden analysiert?
Die Analyse von Ibsens "Nora" umfasst den historischen Kontext der Entstehung und Rezeption, Ibsens ästhetisches Verfahren, die Figurenkonzeption (insbesondere Nora und Helmer) und die Frage, ob Ibsens Darstellung der weiblichen Emanzipation eher verklärend oder realistisch ist.
Welche Aspekte von Jelineks Werk werden analysiert?
Die Analyse von Jelineks Werk konzentriert sich auf ihre gesellschaftskritische Position, ihre ästhetischen Verfahren (Intertextualität, Dekonstruktion von Alltagsmythen, Sprache und Körper), die Darstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit und ihre pessimistische Umkehrung von Ibsens hoffnungsvollem Ausgang.
- Quote paper
- Nadja Krakowski (Author), 2014, Ibsens und Jelineks Nora-Stücke und der Mythos der Emanzipation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314470