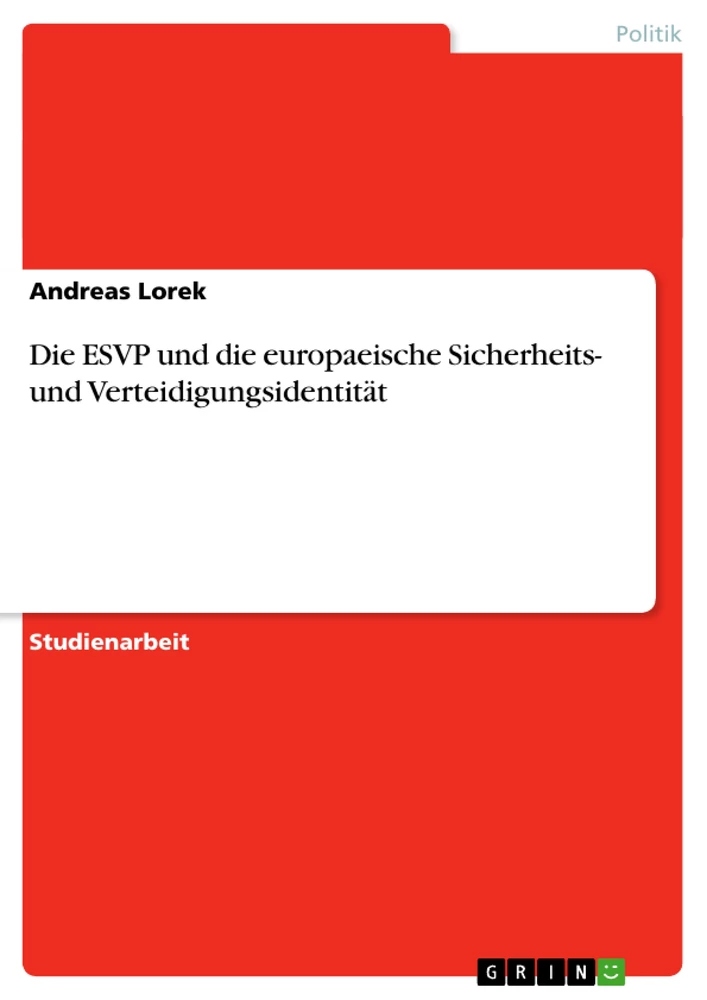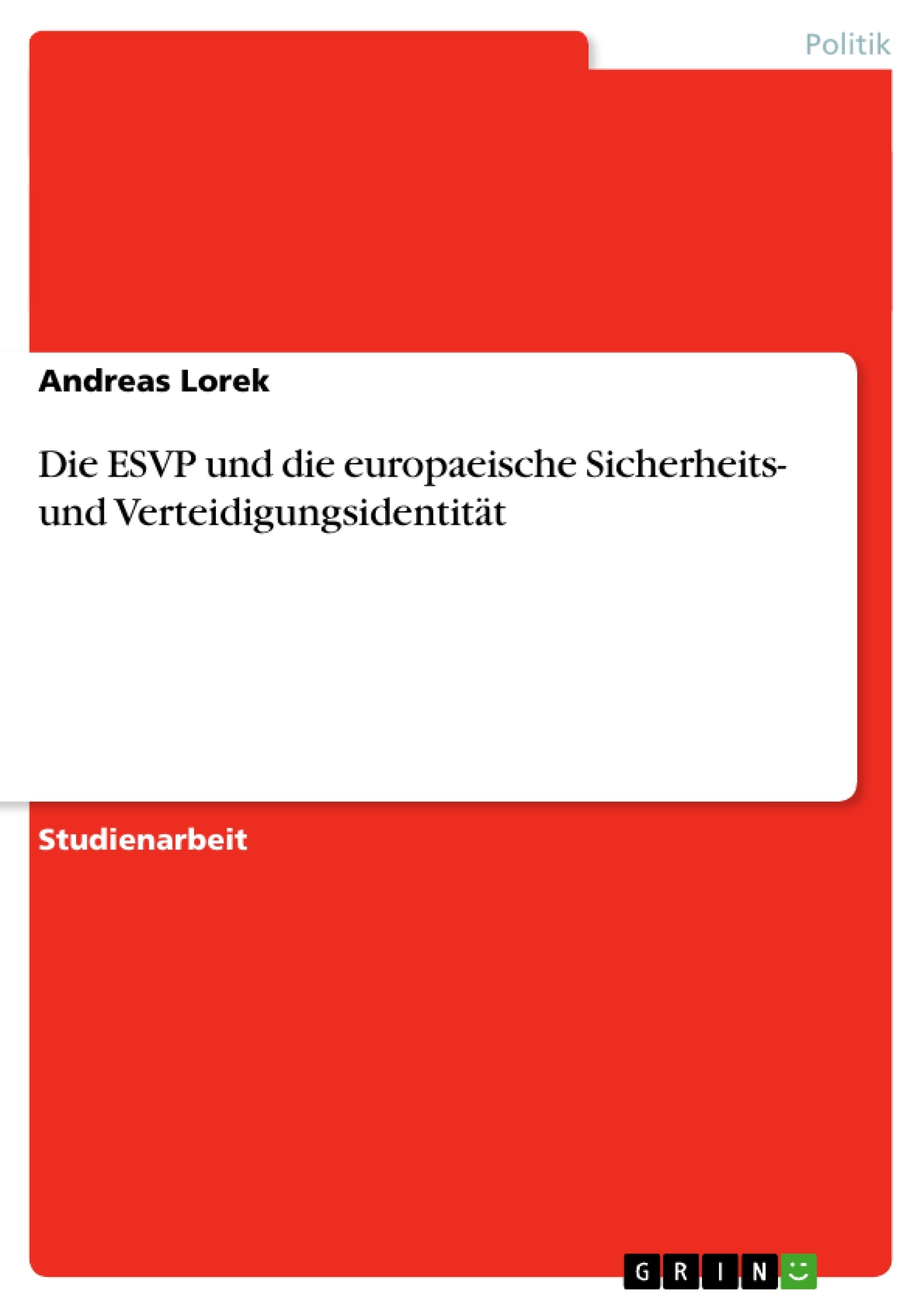Die Idee, sicherheits- und verteidigungspolitische Interessen der europäischen Staaten gemeinsam
zu regeln, entstand kurz nach der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
(EGKS). Im Jahr 1952 wurde ein Vertrag zur Einrichtung einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft
(EVG) ausgehandelt, der eine gemeinsame europäische Armee mit einem gemeinsamen
Verteidigungsminister vorsah. Dieses Vorhaben scheiterte aber 1954 durch die Ablehnung der
französischen Nationalversammlung (vgl. Weidenfeld, Wessels (Hrsg.), 2002, S. 15f.). Als Ersatzlösung
für die EVG wurde die Westeuropäische Union (WEU) gegründet, die allerdings keinen wirklichen
Beitrag zur europäischen Integration beisteuerte (vgl. Gasteyger, 2001, S. 114).
Im Jahre 1970 wurde die Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ) als inoffizielles Gremium
eingerichtet. Seit diesem Zeitpunkt trafen sich die Außenminister der Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaft (EG) mindestens zweimal im Jahr zu Konsultationen und gaben gemeinsame
Stellungnahmen ab (vgl. Gasteyger, 2001, S. 279). Jegliche Maßnahmen konnten nur einstimmig beschlossen
werden, konkrete Handlungen wurden daraus nicht abgeleitet.
In der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) von 1986 wurde die EPZ institutionalisiert. Darin
heißt es, dass sich die Mitglieder der EG bemühen „gemeinsam eine europäische Außenpolitik auszuarbeiten
und zu verwirklichen“ (EEA, Titel III, Art. 30, Abs. 1). Mit dem Vertrag von Maastricht
1993 wurde aus der EPZ die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), die als sogenannte
zweite Säule in der Europäischen Union (EU) verankert wurde. Die sicherheits- und verteidigungspolitische
Zusammenarbeit innerhalb der EU wurde nun deutlich weiter gefasst.
Die Regierungserklärung des Europäischen Rates von Köln im Jahr 1999 wird als „Geburtsstunde“
(Stinnertz, 2003) der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) bezeichnet. Darin
heißt es: „Wir, die Mitglieder des Europäischen Rates, wollen entschlossen dafür eintreten, dass die
Europäische Union ihre Rolle auf der internationalen Bühne uneingeschränkt wahrnimmt. Hierzu
beabsichtigen wir, der Europäischen Union die notwendigen Mittel und Fähigkeiten an die Hand zu
geben, damit sie ihrer Verantwortung im Zusammenhang mit einer gemeinsamen europäischen Sicherheits-
und Verteidigungspolitik gerecht werden kann.“ [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Chronologie der relevanten Ereignisse
- 3. GASP als Rahmen der ESVP
- 3.1. Hoher Vertreter der GASP
- 3.2. Außenminister der Union
- 3.3. Gremien im Rahmen der GASP
- 3.3.1. Politisches- und Sicherheitspolitisches Komitee (PSK)
- 3.3.2. Militärisches Komitee (EUMC)
- 3.3.3. Militärstab (EUMS)
- 3.3.4. Ausschuss für zivile Aspekte der Krisenbewältigung (CIVCOM)
- 4. ESVP im Verfassungsentwurf
- 4.1. Europäisches Amt für Rüstung, Forschung und militärische Fähigkeiten
- 4.2. Aufgaben der ESVP
- 4.2.1. Bewältigung militärischer Aufgaben
- 4.2.2. Bewältigung ziviler Aufgaben
- 4.2.3. Konfliktverhütung und Konfliktvermeidung (Konfliktprävention)
- 4.3. Einsätze im Rahmen der ESVP
- 4.3.1. Polizeimission in Bosnien-Herzegowina
- 4.3.2. Militärische Aktion „Concordia“ in Mazedonien
- 4.3.3. Polizeimission „Proxima“ in Mazedonien
- 4.3.4. Militärische Operation „Artemis“ im Kongo
- 5. Europäische Verteidigungsidentität
- 5.1. Verhältnis von ESVP und NATO
- 5.2. Europäische Sicherheitsstrategie
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit gibt einen Überblick über die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Neuerungen durch den Vertrag über eine Verfassung für Europa. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der ESVP von ihren Anfängen bis zum Verfassungsentwurf von 2004.
- Entwicklung der ESVP von der EGKS bis zum Verfassungsentwurf
- Die Rolle der GASP und ihrer Gremien
- Aufgaben und Einsätze der ESVP
- Das Verhältnis von ESVP und NATO
- Die Bedeutung der Europäischen Sicherheitsstrategie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert die historische Entwicklung der sicherheits- und verteidigungspolitischen Zusammenarbeit in Europa, von gescheiterten Versuchen wie der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft bis zur Entstehung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP). Sie beschreibt die Herausforderungen bei der Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Stimme in der Außen- und Sicherheitspolitik und hebt die Bedeutung des Vertrags über eine Verfassung für Europa für die ESVP hervor. Die Arbeit fokussiert sich auf die Analyse der ESVP im Kontext dieses Vertragsentwurfs.
3. GASP als Rahmen der ESVP: Dieses Kapitel beschreibt die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) als institutionellen Rahmen der ESVP. Es analysiert die Rolle des Hohen Vertreters, der Außenminister und verschiedener Gremien wie dem Politisch-Sicherheitspolitischen Komitee (PSK), dem Militärischen Komitee (EUMC), dem Militärstab (EUMS) und dem Ausschuss für zivile Aspekte der Krisenbewältigung (CIVCOM). Die Kapitel verdeutlicht die komplexe Struktur der GASP und ihre Bedeutung für die Koordinierung und Durchführung von ESVP-Maßnahmen. Die Darstellung der Gremien und ihrer Aufgaben zeigt die institutionelle Verankerung der ESVP innerhalb der EU.
4. ESVP im Verfassungsentwurf: Dieses Kapitel untersucht die Position der ESVP im Verfassungsentwurf der Europäischen Union. Es befasst sich detailliert mit den geplanten Aufgaben der ESVP, sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich, inklusive der Konfliktprävention. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Europäischen Amt für Rüstung, Forschung und militärische Fähigkeiten gewidmet. Weiterhin werden konkrete Beispiele für ESVP-Einsätze (z.B. in Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Kongo) analysiert um die praktische Anwendung der Politik zu verdeutlichen. Die Kapitel analysiert wie der Verfassungsentwurf die ESVP strukturiert und stärkt.
5. Europäische Verteidigungsidentität: Das Kapitel beleuchtet den Begriff der Europäischen Verteidigungsidentität und untersucht das komplexe Verhältnis zwischen der ESVP und der NATO. Die Analyse der Europäischen Sicherheitsstrategie (ESS) von 2003 zeigt, wie die EU versucht, ihre Sicherheitsinteressen zu definieren und ihre Rolle in der internationalen Sicherheitsarchitektur zu gestalten. Die Diskussion des Verhältnisses zu NATO betont die Herausforderungen und Chancen einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Schlüsselwörter
Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP), Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), Europäische Union (EU), NATO, Verfassungsentwurf, Europäische Sicherheitsstrategie (ESS), Konfliktprävention, militärische und zivile Aufgaben, Helsinki Headline Goals, Petersberg-Aufgaben.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP)
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) im Kontext der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselbegriffe. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Neuerungen durch den Vertrag über eine Verfassung für Europa und der Analyse der ESVP bis zum Verfassungsentwurf von 2004.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Entwicklung der ESVP von ihren Anfängen bis zum Verfassungsentwurf, die Rolle der GASP und ihrer Gremien (PSK, EUMC, EUMS, CIVCOM), die Aufgaben und Einsätze der ESVP (militärische und zivile), das Verhältnis zwischen ESVP und NATO sowie die Bedeutung der Europäischen Sicherheitsstrategie.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Chronologie der relevanten Ereignisse, GASP als Rahmen der ESVP, ESVP im Verfassungsentwurf, Europäische Verteidigungsidentität und Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel wird im Dokument kurz zusammengefasst.
Was ist die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)?
Die GASP wird im Dokument als institutioneller Rahmen der ESVP beschrieben. Sie umfasst verschiedene Gremien, die für die Koordinierung und Durchführung von ESVP-Maßnahmen zuständig sind. Das Dokument analysiert die Rolle des Hohen Vertreters, der Außenminister und die Aufgaben der einzelnen Gremien (PSK, EUMC, EUMS, CIVCOM).
Welche Rolle spielt der Verfassungsentwurf für die ESVP?
Der Vertrag über eine Verfassung für Europa spielt eine zentrale Rolle im Dokument. Es wird untersucht, wie der Verfassungsentwurf die ESVP strukturiert und stärkt, welche geplanten Aufgaben die ESVP im militärischen und zivilen Bereich übernehmen soll (inklusive Konfliktprävention) und welche Bedeutung dem Europäischen Amt für Rüstung, Forschung und militärische Fähigkeiten zukommt.
Wie steht die ESVP zur NATO?
Das Dokument beleuchtet das komplexe Verhältnis zwischen der ESVP und der NATO und untersucht die Herausforderungen und Chancen einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Kontext der Europäischen Sicherheitsstrategie (ESS).
Welche konkreten Beispiele für ESVP-Einsätze werden genannt?
Das Dokument nennt als Beispiele für ESVP-Einsätze unter anderem Polizeimissionen in Bosnien-Herzegowina und Mazedonien sowie militärische Operationen in Mazedonien und im Kongo.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Dokument verwendet?
Zu den Schlüsselbegriffen gehören Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP), Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), Europäische Union (EU), NATO, Verfassungsentwurf, Europäische Sicherheitsstrategie (ESS), Konfliktprävention, militärische und zivile Aufgaben, Helsinki Headline Goals und Petersberg-Aufgaben.
Wofür ist das Dokument gedacht?
Das Dokument ist als umfassende Übersicht über die ESVP gedacht und eignet sich für akademische Zwecke, um die Thematik strukturiert und professionell zu analysieren.
- Quote paper
- Andreas Lorek (Author), 2004, Die ESVP und die europaeische Sicherheits- und Verteidigungsidentität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31442