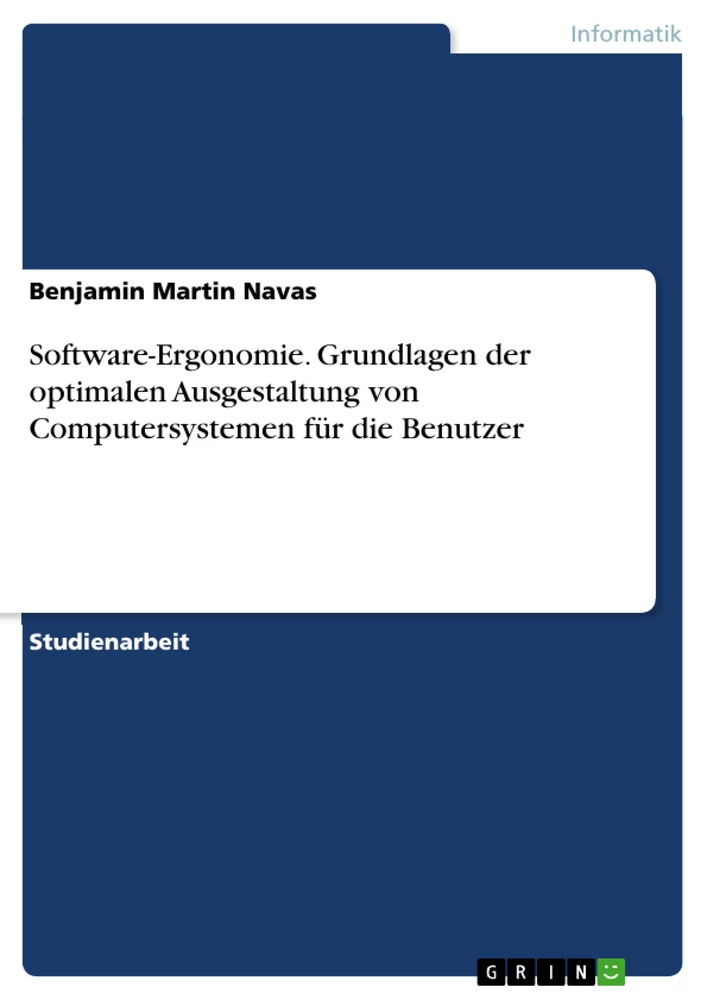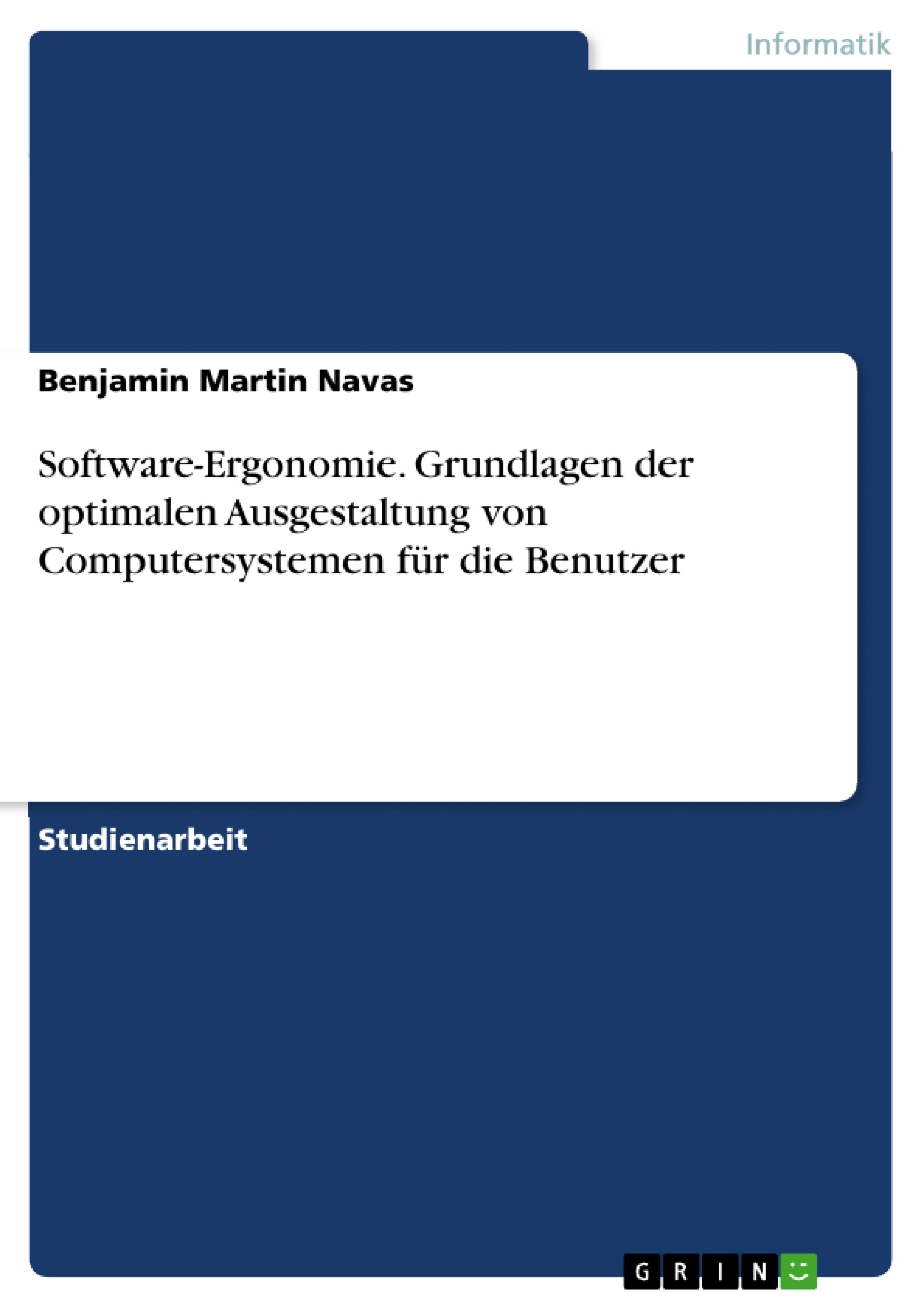Der Computer hat im alltäglichen Leben eine mittlerweile unersetzliche Rolle eingenommen. Im Rahmen der Lebensbereiche Arbeit, Bildung, und Freizeit begegnen Verbraucher bzw. Konsumenten einer Vielzahl und Vielfalt von Computersystemen und Computeranwendungen. Im Vordergrund steht dabei immer die Interaktion zwischen Mensch und Computer. Damit diese Kooperation gut funktionieren kann, ist es wichtig, dass die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine gut durchdacht und sauber gestaltet ist. Hier greift das Aufgabengebiet der Software-Ergonomie
In der nachfolgenden Ausarbeitung wird ein detaillierter Überblick von Software-Ergonomie dargestellt und die Mensch-Computer-Interaktion genau beleuchtet.
Dazu werden die psychologischen Grundlagen zu Usability Engineering und barrierefreier Software erklärt. Die Merkmale der Interaktionsgestaltung sowie die sieben Prinzipien der Dialoggestaltung werden nicht außer Acht gelassen. Denn gerade diese Richtlinien, insbesondere die Dialoggestaltung, die genauer präzisiert wird, sind sehr entscheidend für das Verhältnis zwischen Anwender und Software. Deshalb werden auch die Styleguides, u.a. in der analytisch-psychologischen Darstellung, präsentiert. Nach der Faktenbelegung der Software-Ergonomie und ihrem Konzept sollen zum Schluss noch Folgen von schlechter Software-Ergonomie und deren Fehlerbehebung konkretisiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffserklärungen
- 2.1 Software
- 2.2 Ergonomie
- 3 Definition der Software-Ergonomie
- 3.1 Psychologische Grundlagen
- 3.1.1 Usability Engineering
- 3.1.2 Barrierefreie Software sowie ihre Benutzerfreundlichkeit und Gebrauchstauglichkeit
- 3.2 Merkmale ergonomischer Software innerhalb der Grundsätze der Interaktionsgestaltung
- 3.2.1 Die sieben Prinzipien der Dialoggestaltung
- 3.2.2 Qualität ergonomischer Software für benutzergerechte Gestaltung
- 3.2.3 Analytisch-psychologisches Gestaltungskonzept von Styleguides
- 3.1 Psychologische Grundlagen
- 4 Folgen schlechter Software-Ergonomie
- 4.1 Fehlertaxonomie
- 4.2 Prozessführungssysteme und ihre Komplexität als Problemkern
- 5 Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Software-Ergonomie und untersucht die Mensch-Computer-Interaktion. Ziel ist es, einen detaillierten Überblick über die Software-Ergonomie zu geben und die Bedeutung einer benutzerfreundlichen Gestaltung von Software herauszustellen. Die Arbeit beleuchtet die psychologischen Grundlagen, die Prinzipien der Dialoggestaltung und die Folgen schlechter Software-Ergonomie.
- Definition und Bedeutung von Software-Ergonomie
- Psychologische Grundlagen des Usability Engineering und barrierefreier Software
- Prinzipien der Dialoggestaltung und deren Einfluss auf die Benutzerfreundlichkeit
- Folgen schlechter Software-Ergonomie und deren Auswirkungen
- Konzepte für eine benutzergerechte Softwaregestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung betont die allgegenwärtige Rolle von Computern im Alltag und die Bedeutung einer durchdachten Mensch-Computer-Interaktion. Sie führt das Problem mangelnder Software-Ergonomie ein und zeigt die schwerwiegenden Folgen – von gesundheitlichen Beeinträchtigungen bis hin zu wirtschaftlichen Schäden – auf, die durch fehlerhafte Software entstehen können. Die Arbeit kündigt einen detaillierten Überblick über Software-Ergonomie und die Analyse der Mensch-Computer-Interaktion an.
2 Begriffserklärungen: Dieses Kapitel definiert die Kernbegriffe "Software" und "Ergonomie". "Software" wird als die nicht-physischen Komponenten eines Computersystems beschrieben, während "Ergonomie" als die Wissenschaft der Anpassung von Arbeitsbedingungen an den Menschen erklärt wird. Der Fokus liegt auf der Bedeutung funktionaler Software und der Anpassung der Arbeitsumgebung an die menschlichen Bedürfnisse, um die Arbeit zu erleichtern.
3 Definition der Software-Ergonomie: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Definition von Software-Ergonomie. Es werden die psychologischen Grundlagen, wie Usability Engineering und barrierefreie Software, erläutert. Es werden die Merkmale ergonomischer Software im Kontext der Interaktionsgestaltung und die sieben Prinzipien der Dialoggestaltung detailliert beschrieben. Die Bedeutung von Styleguides für ein analytisch-psychologisches Gestaltungskonzept wird ebenfalls behandelt. Das Kapitel betont die Notwendigkeit benutzergerechter Gestaltung.
4 Folgen schlechter Software-Ergonomie: Dieses Kapitel untersucht die negativen Konsequenzen mangelnder Software-Ergonomie. Es analysiert die Fehlertaxonomie und beleuchtet die Komplexität von Prozessführungssystemen als zentralen Problemfaktor. Die Ausführungen verdeutlichen die weitreichenden Folgen fehlerhafter Software, sowohl für den einzelnen Benutzer als auch für das Gesamtsystem.
Schlüsselwörter
Software-Ergonomie, Mensch-Computer-Interaktion, Usability Engineering, Barrierefreiheit, Dialoggestaltung, Styleguides, Benutzerfreundlichkeit, Fehlertaxonomie, Prozessführungssysteme.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Software-Ergonomie
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Software-Ergonomie. Sie beinhaltet eine Einleitung, Begriffserklärungen (Software und Ergonomie), eine detaillierte Definition der Software-Ergonomie inklusive psychologischer Grundlagen (Usability Engineering, barrierefreie Software) und Prinzipien der Dialoggestaltung. Weiterhin werden die Folgen schlechter Software-Ergonomie (Fehlertaxonomie, komplexe Prozessführungssysteme) untersucht. Die Arbeit schließt mit einer Schlussbetrachtung und einem Ausblick ab. Ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Definition und Bedeutung von Software-Ergonomie, die psychologischen Grundlagen des Usability Engineering und barrierefreier Software, die Prinzipien der Dialoggestaltung und deren Einfluss auf die Benutzerfreundlichkeit, die Folgen schlechter Software-Ergonomie und Konzepte für eine benutzergerechte Softwaregestaltung.
Was wird unter Software-Ergonomie verstanden?
Die Seminararbeit definiert Software-Ergonomie als die Anpassung von Software an die Bedürfnisse und Fähigkeiten des Menschen. Sie berücksichtigt psychologische Grundlagen wie Usability Engineering und Barrierefreiheit, um eine benutzerfreundliche und effiziente Mensch-Computer-Interaktion zu gewährleisten.
Welche psychologischen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet Usability Engineering und die Bedeutung barrierefreier Software als zentrale psychologische Grundlagen der Software-Ergonomie. Es wird untersucht, wie die Gestaltung von Software die Benutzerfreundlichkeit und Gebrauchstauglichkeit beeinflusst.
Welche Prinzipien der Dialoggestaltung werden erläutert?
Die sieben Prinzipien der Dialoggestaltung werden detailliert beschrieben und ihre Bedeutung für die Benutzerfreundlichkeit hervorgehoben. Die Arbeit zeigt auf, wie diese Prinzipien zur Erstellung benutzergerechter Software beitragen.
Welche Folgen hat schlechte Software-Ergonomie?
Die negativen Folgen schlechter Software-Ergonomie werden umfassend analysiert. Dazu gehören Fehler, die durch eine mangelnde Benutzerfreundlichkeit entstehen (Fehlertaxonomie) sowie die Komplexität von Prozessführungssystemen als zentraler Problemfaktor. Die Auswirkungen reichen von gesundheitlichen Beeinträchtigungen bis hin zu wirtschaftlichen Schäden.
Welche Rolle spielen Styleguides?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung von Styleguides für ein analytisch-psychologisches Gestaltungskonzept. Styleguides unterstützen die Entwicklung benutzerfreundlicher und konsistenter Software.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Software-Ergonomie, Mensch-Computer-Interaktion, Usability Engineering, Barrierefreiheit, Dialoggestaltung, Styleguides, Benutzerfreundlichkeit, Fehlertaxonomie, Prozessführungssysteme.
- Quote paper
- Benjamin Martin Navas (Author), 2015, Software-Ergonomie. Grundlagen der optimalen Ausgestaltung von Computersystemen für die Benutzer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314287