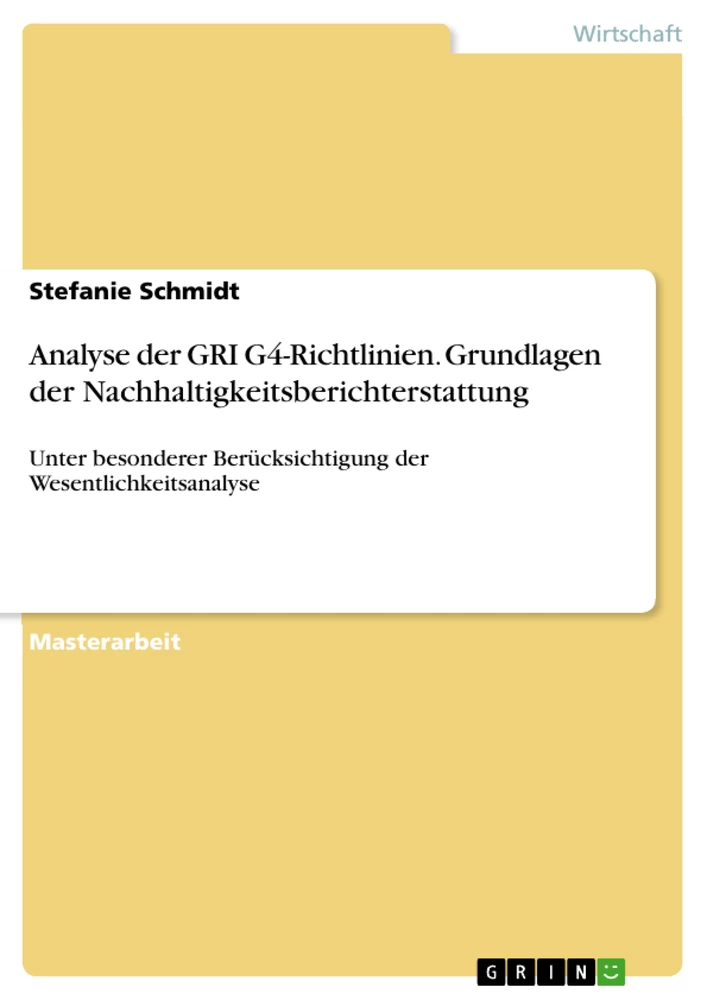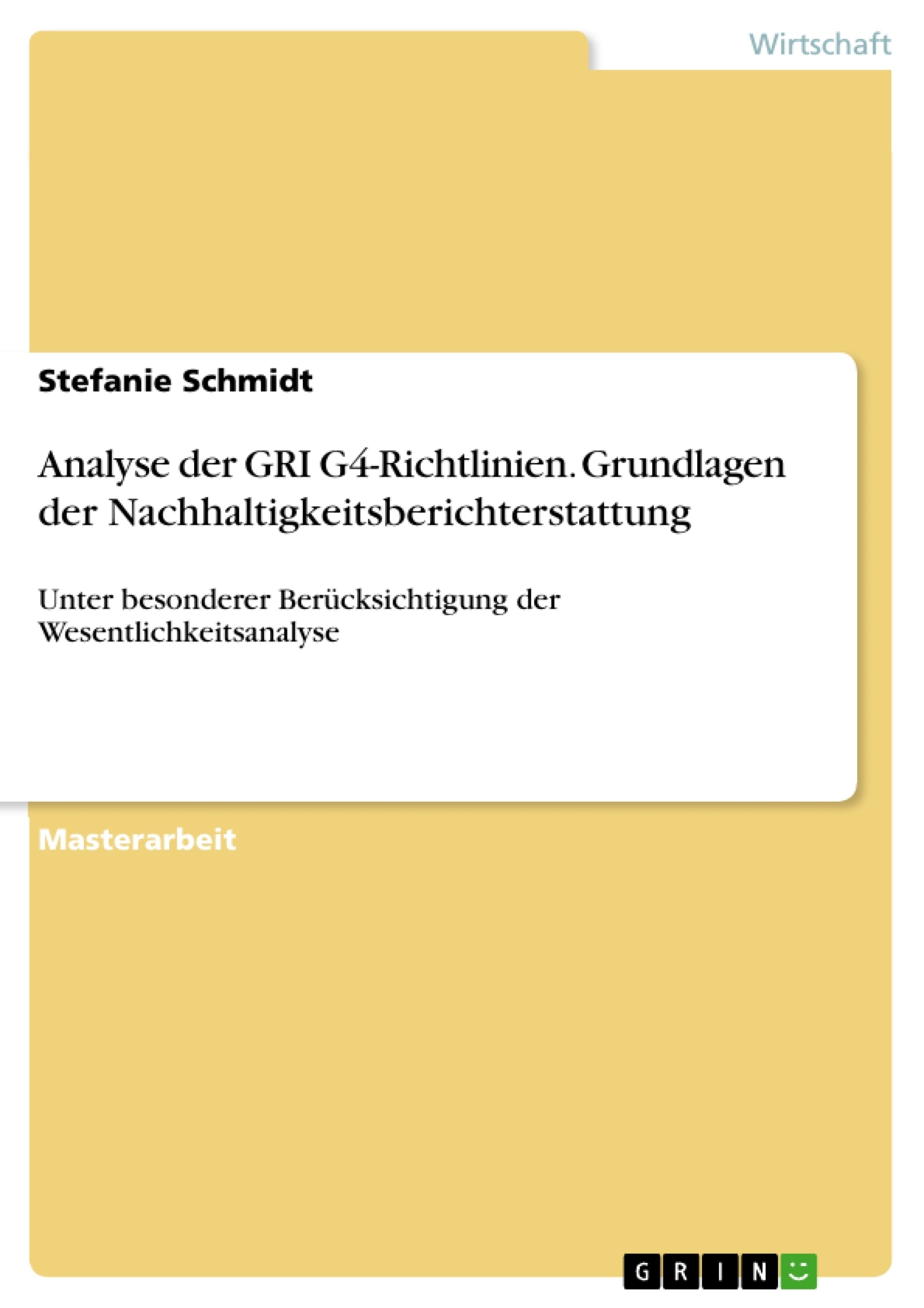Die vorliegende Arbeit behandelt die aktuellste Version (GRI G4) der Global Reporting Guidelines zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Nach einer ersten Auseinandersetzung mit der GRI, dem Herausgeber der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Leitfäden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, beschäftigt sich die Arbeit mit dem Aufbau eines Nachhaltigkeitsberichtes nach GRI G4 und der Vorgängerversion GRI G3 bzw. G3.1 sowie den Neuerungen im aktuellen G4-Leitfaden. Im Vordergrund liegt hier die Wesentlichkeitsanalyse, der im neuen G4-Leitfaden eine große Bedeutung zukommt. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Durchführung der Wesentlichkeitsanalyse, wie sie im G4-Leitfaden empfohlen wird, erläutert.
Als Schwerpunkt dieser Arbeit wird in Kapitel 5 eine Fallstudie durchgeführt, in der die G3/G3.1- und G4-Nachhaltigkeitsberichte von sechs Unternehmen analysiert werden, um die Änderungen zwischen diesen herauszustellen. Im Mittelpunkt der Fallstudie stehen die Durchführung der Wesentlichkeitsanalyse und die Umsetzung des Prinzips der Wesentlichkeit. Im Anschluss erfolgt die Darstellung und Beurteilung der Ergebnisse sowie eine kritische Reflektion derselben. Abschließend wird die Arbeit mit einem Fazit und einem Ausblick abgerundet.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einführung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Grundlagen der Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Definition und Entwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Motive für die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes
- Stakeholder und deren Informationsansprüche im Kontext der Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Die Global Reporting Initiative
- Über die GRI
- Von GRI G1 bis GRI G4
- Die Prinzipien der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach GRI
- Grundsätze zur Bestimmung der Berichtsinhalte
- Grundsätze zur Bestimmung der Berichtsqualität
- Aufbau eines Nachhaltigkeitsberichtes nach GRI
- Aufbau eines G3/3.1-Berichtes
- Aufbau eines G4-Berichtes
- Allgemeine Standardangaben
- Spezifische Standardangaben
- GRI G4 - Was ist neu?
- Fokus aus das Prinzip der Wesentlichkeit
- Abschaffung der Anwendungsebenen
- Größere Bedeutung der Wertschöpfungskette
- Erweiterte Offenlegung von Aspekten zur Unternehmensführung
- Beschreibung des Managementansatzes / DMA
- Änderung von Indikatoren
- Kritische Betrachtung von G4
- Die Wesentlichkeitsanalyse
- Ziel der Wesentlichkeitsanalyse
- Durchführung der Wesentlichkeitsanalyse
- Ermittlung
- Priorisierung
- Validierung
- Überprüfung
- Welche Chancen bietet die Wesentlichkeitsanalyse?
- Welche Probleme bringt die Wesentlichkeitsanalyse mit sich?
- Fallstudie Analyse von Nachhaltigkeitsberichten nach GRI G3/G3.1 und G4
- Berichtsmodell „Core“
- GRI
- G3.1-Bericht
- G4-Bericht
- ASML
- G3.1-Bericht
- G4-Bericht
- Ahlstrom Corporation
- G3-Bericht
- G4-Bericht
- Berichtsmodell „Comprehensive“
- Royal BAM Group
- G3.1-Bericht
- G4-Bericht
- Daimler
- G3.1-Bericht
- G4-Bericht
- Dialog Axiata
- G3.1-Bericht
- G4-Bericht
- Darstellung und Beurteilung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Masterarbeit analysiert die GRI G4-Richtlinien unter besonderer Berücksichtigung der Wesentlichkeitsanalyse. Das Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung der GRI-Richtlinien aufzuzeigen, insbesondere die Neuerungen von G4, und deren Auswirkungen auf die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten zu beleuchten. Dabei wird ein besonderer Fokus auf die Wesentlichkeitsanalyse gelegt, deren Bedeutung und Implementierung im Rahmen der GRI G4-Richtlinien untersucht wird.
- Entwicklung der GRI-Richtlinien und ihre Bedeutung für die Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Die Wesentlichkeitsanalyse als zentrales Element der GRI G4-Richtlinien
- Auswirkungen der GRI G4-Richtlinien auf die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten
- Vergleichende Analyse von Nachhaltigkeitsberichten nach GRI G3/G3.1 und G4
- Bewertung der Chancen und Herausforderungen der GRI G4-Richtlinien
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit darlegt und den Aufbau der Arbeit beschreibt. Kapitel 2 bietet eine grundlegende Einführung in die Nachhaltigkeitsberichterstattung, definiert den Begriff, beleuchtet die historische Entwicklung und analysiert die Motive für die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes. Zudem werden die Stakeholder und ihre Informationsansprüche im Kontext der Nachhaltigkeitsberichterstattung betrachtet. Kapitel 3 widmet sich der Global Reporting Initiative (GRI), erläutert die Geschichte und die Prinzipien der GRI sowie den Aufbau von Nachhaltigkeitsberichten nach den GRI-Richtlinien. Hierbei werden die Neuerungen von GRI G4 im Detail analysiert. Kapitel 4 befasst sich mit der Wesentlichkeitsanalyse, deren Ziel, Durchführung und Chancen sowie Probleme beleuchtet werden. Die Fallstudie in Kapitel 5 analysiert Nachhaltigkeitsberichte nach GRI G3/G3.1 und G4, indem verschiedene Unternehmen mit unterschiedlichen Berichtsmodellen (Core und Comprehensive) betrachtet werden. Die Ergebnisse der Fallstudie werden im letzten Kapitel zusammengefasst und in einen Ausblick eingebettet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Nachhaltigkeitsberichterstattung, Global Reporting Initiative (GRI), GRI G4-Richtlinien, Wesentlichkeitsanalyse, Stakeholder, Unternehmensführung, Corporate Social Responsibility (CSR) und Nachhaltigkeitsmanagement. Dabei werden die theoretischen Grundlagen der Nachhaltigkeit und der Nachhaltigkeitsberichterstattung aufgegriffen und anhand von Fallstudien die praktische Anwendung der GRI G4-Richtlinien und der Wesentlichkeitsanalyse in der Praxis beleuchtet.
- Citar trabajo
- Stefanie Schmidt (Autor), 2014, Analyse der GRI G4-Richtlinien. Grundlagen der Nachhaltigkeitsberichterstattung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314245