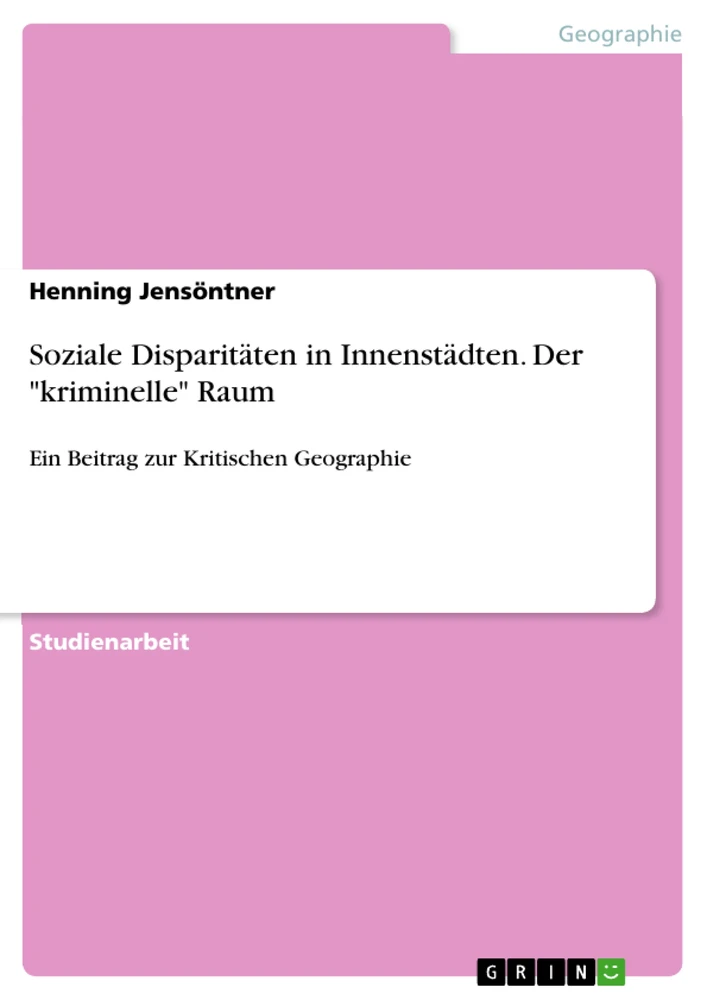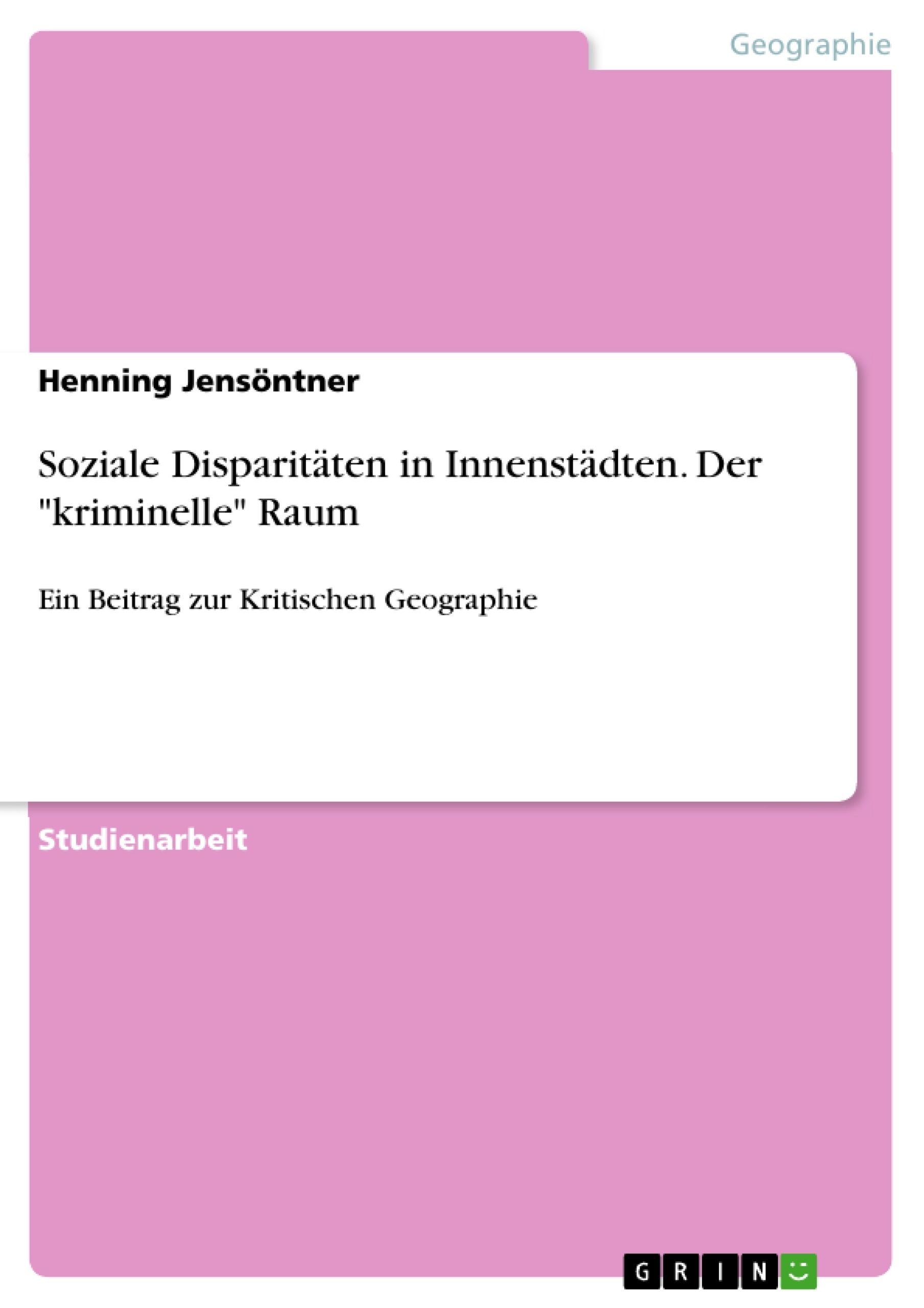In der modernen Humangeographie hat die „kritische Geographie“ eine Schlüsselrolle übernommen. In den 1970er Jahren ersetzte sie im angloamerikanischen Sprachraum die bis dahin sehr quantitativ geprägte Arbeitsweise. Kritisch nahm sie mit ihrer strukturalistischen Ausrichtung Einfluss auf geographische Themen.
In der folgenden Ausarbeitung wird auf die Ursprünge der „Kritischen Geographie“ eingegangen. Dazu zählt ein Diskurs zu den Aussagen des Marxismus und dessen gegenwärtige Strömungen, sowie die nähere Beleuchtung führender „kritisch-geographischer“ Forscher. Des Weiteren wird auf die Kernaussagen und Raumperspektiven eingegangen. Insbesondere Henri Lefebvres Raumkonzept und das Konzept der „scale Debatte“ werden gesondert betrachtet. Hierfür ist es auch notwendig, sich näher mit den, der „Kritischen Geographie“ nahe stehenden, Forschungsströmungen – wie etwa der Politischen Geographie und der Geopolitik - zu beschäftigen.
Die „Kritische Geographie“ bietet in ihrer breiten Auslegung folglich durchaus die Möglichkeit, viele Themenbereiche des Alltags zu untersuchen. Insbesondere der „Ausverkauf der Städte“, damit ist die stetige Privatisierung öffentlichen Raumes gemeint, lassen sich in der Veröffentlichungen häufig wiederfinden. „Wem gehört die Stadt?“ sind häufige Phrasen, mit denen linke Aktivisten ebenso zahlreich auf sich aufmerksam machen.
Ein weiteres Phänomen der Gegenwart, welches durch einen „globalisierten Stadtmarkt“ entstand, führt man unter dem Begriff der „unternehmerischen Stadt“. Städte sind einem weltweiten Konkurrenzkampf unterlegen und nutzen ihre Stellung innerhalb des Stadt-Containerraums zu diesem Zwecke aus. Gemeint ist die Ästhetik einer (Innen-)Stadt: Beispielsweise allgemeine Sauberkeit und (prägende) Architektur. Zu einem sauberen Image zählt auch das Sicherheitsgefühl, die Abwesenheit von Kriminalität. Sicherheit und Kriminalität sind Begriffe, die immer wieder bei politischen Diskussionen und in Wahlkämpfen zu Tage treten. Empfindliche Reaktionen sind die Folge, da ein Gefühl der Sicherheit unabdingbar zum Image eines Ortes dazugehört. Negative, durch Kriminalität hervorgerufene, Erfahrungen werden in den Medien vermittelt und treten in den verschiedensten Formen täglich auf.
In dieser Hausarbeit wird, der „kritischen Geographie“ entsprechend, untersucht, ob eine Gleichschaltung von Raum und Kriminalität stattfindet und wie diese im (historisch-materialistischen) Kontext einzuordnen ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ursprung und Kernaussagen der „Kritischen Geographie“
- 2.1 Die marxistische Theorie und seine Übertragung auf die Kritische Geographie
- 2.1.1 Die blockierte Marx-Rezeption im Westen
- 2.2 Die Raumproduktion nach Henri Lefebvre
- 2.3 Die „scale-Debatte“
- 2.4 Kurze Zusammenfassung der Kernaspekte der „Kritischen Geographie“
- 2.1 Die marxistische Theorie und seine Übertragung auf die Kritische Geographie
- 3. Soziale Disparitäten in (Innen-)Städten anhand eines Praxisbeispiels aus Bremen
- 3.1 Die „kriminelle“ Innenstadt in der Praxis
- 3.2 Legitimation der Betretungsverbote
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Ursprünge und Kernaussagen der Kritischen Geographie, fokussiert auf den Einfluss des Marxismus und die Raumkonzepte von Henri Lefebvre. Sie analysiert soziale Disparitäten in Innenstädten anhand eines Beispiels aus Bremen und hinterfragt die Verbindung von Raum und Kriminalität. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Kritischen Geographie aus der Politischen Geographie und die "scale-Debatte".
- Ursprünge und Entwicklung der Kritischen Geographie
- Einfluss des Marxismus auf die geographische Theorie
- Raumproduktion und Raumkonzepte (Henri Lefebvre)
- Soziale Disparitäten und Kriminalität im städtischen Raum
- Die "scale-Debatte" in der Kritischen Geographie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Kritischen Geographie ein und hebt deren Bedeutung in der modernen Humangeographie hervor. Sie betont den Wandel von quantitativen zu strukturalistischen Ansätzen und diskutiert die Herausforderungen bei der Definition von „kritischer Geographie“, betont dass wissenschaftliches Denken immer kritisch ist, und kündigt die Struktur der Arbeit an, welche die Ursprünge der Kritischen Geographie, die Kernaussagen und ein Praxisbeispiel aus Bremen beleuchten wird. Der Bezug zu aktuellen Phänomenen wie dem „Ausverkauf der Städte“ und der „unternehmerischen Stadt“ wird hergestellt, um die Relevanz der Thematik zu verdeutlichen. Die Arbeit kündigt die Untersuchung der Verbindung zwischen Raum und Kriminalität an.
2. Ursprung und Kernaussagen der „Kritischen Geographie“: Dieses Kapitel untersucht die Ursprünge der Kritischen Geographie im Kontext der Politischen Geographie. Es beschreibt die Konzepte des Naturdeterminismus, Nationalismus, Darwinismus, Staatsorganizismus, Imperialismus und Kolonialismus, die die Politische Geographie des frühen 19. Jahrhunderts prägten. Der Einfluss von Ratzel und die Verknüpfung von Wissen, Raum und Macht werden hervorgehoben. Die Trennung von Geopolitik und Politischer Geographie in der Nachkriegszeit und die spätere Entstehung der „Radical Geography“ als Neu-Konzeptualisierung der Politischen Geographie werden analysiert. Das Kapitel betont die Analyse politisch-geographischer Phänomene und Raum-Macht-Asymmetrien.
3. Soziale Disparitäten in (Innen-)Städten anhand eines Praxisbeispiels aus Bremen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Untersuchung sozialer Disparitäten in Innenstädten und der Frage der Gleichschaltung von Raum und Kriminalität. Es wird ein Praxisbeispiel aus Bremen analysiert, welches untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen Raum und Kriminalität besteht und wie dies im historisch-materialistischen Kontext einzuordnen ist. Die Skalierbarkeit dieses Phänomens auf verschiedene Maßstabsebenen wird ebenfalls hinterfragt. Die Legitimation von Betretungsverboten im Kontext der „kriminellen“ Innenstadt wird kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kritische Geographie, Marxismus, Raumproduktion, Henri Lefebvre, scale-Debatte, Politische Geographie, Geopolitik, Soziale Disparitäten, Kriminalität, Stadt, Raum-Macht-Asymmetrien, Bremen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Kritische Geographie und soziale Disparitäten
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Ursprünge und Kernaussagen der Kritischen Geographie, insbesondere den Einfluss des Marxismus und die Raumkonzepte von Henri Lefebvre. Sie analysiert soziale Disparitäten in Innenstädten anhand eines Beispiels aus Bremen und beleuchtet den Zusammenhang zwischen Raum und Kriminalität. Ein weiterer Fokus liegt auf der Entwicklung der Kritischen Geographie aus der Politischen Geographie und der "scale-Debatte".
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Ursprünge und Entwicklung der Kritischen Geographie, Einfluss des Marxismus auf die geographische Theorie, Raumproduktion und Raumkonzepte nach Henri Lefebvre, soziale Disparitäten und Kriminalität im städtischen Raum, sowie die "scale-Debatte" in der Kritischen Geographie. Ein Praxisbeispiel aus Bremen veranschaulicht die Anwendung der Theorie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Kritische Geographie und ihre Bedeutung, Ankündigung der Struktur und der behandelten Themen. Kapitel 2 (Ursprung und Kernaussagen): Untersuchung der Ursprünge der Kritischen Geographie im Kontext der Politischen Geographie, Einfluss des Marxismus und Raumkonzepte von Lefebvre. Kapitel 3 (Soziale Disparitäten in Bremen): Analyse sozialer Disparitäten in der Bremer Innenstadt, der Zusammenhang zwischen Raum und Kriminalität und die Legitimation von Betretungsverboten. Kapitel 4 (Fazit): Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen.
Welche Rolle spielt der Marxismus in der Kritischen Geographie?
Die Hausarbeit untersucht den bedeutenden Einfluss des Marxismus auf die Kritische Geographie. Sie analysiert, wie marxistische Theorien auf geographische Fragestellungen übertragen wurden und welche Rolle sie bei der Entwicklung der Kritischen Geographie spielten. Die "blockierte Marx-Rezeption im Westen" wird ebenfalls thematisiert.
Wie wird Henri Lefebvre in der Arbeit behandelt?
Die Raumkonzepte von Henri Lefebvre bilden einen zentralen Bestandteil der Arbeit. Seine Theorie der Raumproduktion wird analysiert und in den Kontext der Kritischen Geographie eingeordnet.
Was ist die "scale-Debatte" und welche Bedeutung hat sie?
Die "scale-Debatte" ist ein wichtiger Aspekt der Kritischen Geographie, der in der Hausarbeit untersucht wird. Sie befasst sich mit der Frage der verschiedenen Maßstabsebenen und deren Bedeutung für die Analyse geographischer Phänomene. Die Skalierbarkeit des Beispiels aus Bremen wird ebenfalls diskutiert.
Welches Praxisbeispiel wird verwendet und warum?
Die Arbeit verwendet ein Praxisbeispiel aus Bremen, um soziale Disparitäten in Innenstädten und den Zusammenhang zwischen Raum und Kriminalität zu analysieren. Bremen dient als Fallstudie, um die theoretischen Konzepte der Kritischen Geographie zu veranschaulichen und zu überprüfen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Kritische Geographie, Marxismus, Raumproduktion, Henri Lefebvre, scale-Debatte, Politische Geographie, Geopolitik, Soziale Disparitäten, Kriminalität, Stadt, Raum-Macht-Asymmetrien, Bremen.
- Quote paper
- Henning Jensöntner (Author), 2014, Soziale Disparitäten in Innenstädten. Der "kriminelle" Raum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314137